Chronik eines angekündigten Krieges
Die Ursprünge der gefährlichen Spannungspolitik gegen Russland. Vorwort zum neuen Buch von Marc Trachtenberg und Marcus Klöckner.
„Krieg dem Kriege“ — vom Titel dieses Gedichts des Satirikers Kurt Tucholsky bleibt die westliche Ukraine-Politik uninspiriert. Das Ergebnis ist bekannt: Seit über drei Jahren tobt der Krieg mit Hunderttausenden von getöteten, verwundeten und traumatisierten Soldaten auf beiden Seiten der Front. Die vorliegende „Chronik eines angekündigten Krieges“ greift Ereignisse und Aussagen zum Krieg auf, die den Zeitraum von Anfang 2022 bis zum Frühjahr 2025 umfassen. Anhand einer Vielzahl von Zitaten, aber auch unter Fokussierung auf nachrichtlich relevante Vorkommnisse vollzieht sich der Rekonstruktionsakt eines diplomatischen Totalausfalls. Aussage um Aussage reiht sich aneinander, und viele von ihnen offenbaren, wie bereits die Sprache von Konfrontation und Bellizismus durchtränkt war — und ist. Das Resultat einer Politik, die von Frieden spricht, aber militärisch auftrumpfen will, wird immer deutlicher: Europa droht in den Abgrund des Krieges zu rutschen.
Längst hat die Politik die Weichen auf eine Weise gestellt, die zu der größten Aufrüstung in der bundesdeutschen Geschichte führt. Das eklatante Versagen der Diplomatie zeigt sich Buchseite für Buchseite. Als EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen unmittelbar nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine von einem „barbarischen Angriff“ sprach und Bundeskanzler Olaf Scholz verlautete: „Der russische Überfall auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende“, war der Grundton gesetzt, der auch von vielen anderen ranghohen Politiker des Westens mitgetragen wurde.
Dieser Grundtakt einer Politik, die sagt, der russische Überfall auf die Ukraine bedrohe „unsere gesamte Nachkriegsordnung“, hat von Beginn an die Saat der politischen und militarischen Eskalation in sich getragen.
Die Annahme, Russland verstehe nur die Sprache der harten Hand, führte zu einer dramatischen Lage. Die menschlichen Schäden, das unermessliche Leid, das aus dem sich so lange hinziehenden Krieg hervorgeht, aber auch der politische Trümmerhaufen zwischen Deutschland und Russland zeugen von einem schweren politischen Versagen.
Von Anfang an war für jeden nur halbwegs versierten Analysten zu erkennen, dass bei Russland die Eskalationsdominanz liegt und welcher Schluss daraus dringend zu ziehen gewesen wäre, nämlich: Alles sollte darangesetzt werden, diesen Krieg so schnell wie nur möglich politisch zu beenden.
Vor den Augen der Weltöffentlichkeit passierte jedoch etwas anderes. Politiker fluteten die Schlachtfelder des Krieges mit Waffen, Munition und Panzern. Gewiss: nach Worten der Politik aus bester Absicht, um dem Angegriffenen zu helfen. Die Chronik veranschlagt in erster Linie eine deutsche Perspektive und legt so schonungslos die Grundlinien des Diskurses zum Ukrainekrieg in der Bundesrepublik frei. Sie beinhaltet einerseits zwar auch Ereignisse, die den Ukrainekrieg betreffen, spiegelt aber vor allem auch die Berichterstattung wider. Wenn man so will: eine Chronik der Berichterstattung. Manche Aussagen von Politikern und anderen Akteuren werden den Lesern in Erinnerung geblieben und manche vergessen worden sein. Hier finden sie sich wieder.
Auch wenn die meisten bereits für sich stehend weitreichend sind: Zusammengefasst verdichten sie sich zu jenem Bild, das den politischen Irrweg, den Deutschland bis jetzt weiter beschreitet, zeigt. Diese Chronik besitzt nicht den Anspruch, umfassend zu sein. In einem begrenzten Zeitrahmen und in einem begrenzten Raum können nicht der gesamte Ukrainekrieg und sein Verlauf samt den politischen Debatten mit ihren Verästelungen abgebildet werden. Das ist ohnehin die Aufgabe von Historikern. Die vorliegende Chronik ist als kursorisch zu verstehen, die in ihrer Selektion und Verdichtung aber, so die Hoffnung, eine eigene Aussagekraft entfaltet.
Vorangestellt ist dem Diarium ein aufschlussreicher Text des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Marc Trachtenberg, der zeigt, dass der Konflikt durchaus weitreichende Wurzeln hat. Der Politologe fokussiert in seinem Essay auf Ereignisse rund um die NATO-Osterweiterung zur Zeit, als der Eiserne Vorhang gefallen war. Haben die USA Moskau versprochen, dass die NATO sich nicht weiter gen Osten ausdehnen wird, und haben sie dieses Versprechen gebrochen?
In der öffentlichen Debatte in Deutschland bleiben die Hintergründe des Kriegs und die historischen Zusammenhänge eindimensional. Alles wirkt so, als hätte dieser Krieg keine weitreichende Vorgeschichte.
Und wenn doch einmal tiefere Zusammenhänge in den Vordergrund der Aufmerksamkeit rücken, ist der Umgang mit ihnen von bemerkenswerter Schlichtheit geprägt. Am Ende erfolgen nahezu immer Antworten, die zum Nachteil Russlands sind. Sicher: Die Vorgeschichte des Ukrainekriegs lässt sich zwischen dem Jahr 2014 und dem Kriegsbeginn am 24. Februar 2024 verorten. Allerdings dürfen für eine fundierte historische und politische Einordnung des Kriegs die Ereignisse ab der Zeit 1989/1990 nicht ignoriert werden. Die geostrategischen und tiefenpolitischen Interessen der USA und Russlands, die Weichenstellungen, Dynamiken und Befindlichkeiten im Zuge der NATO-Osterweiterung hallen bis in die heutige Zeit nach.
Auf der einen Seite steht Russland. Ein Land mit eigenen sicherheitspolitischen Interessen. Auf der anderen Seite stehen die USA, steht Europa, steht die NATO, die ebenfalls eigene Interessen verfolgen.
Trachtenberg nimmt uns mit zurück in eine Zeit, in der die Ursachen für die heutigen Zerwürfnisse zwischen Russland und dem Westen liegen.
„Zu diesem Zweck erweckten die US-Regierungschefs bei den Sowjets absichtlich den Eindruck, dass sie auf deren Sicherheitsinteressen Rücksicht nehmen würden, doch dies aus rein taktischen Erwägungen. Das eigentliche Ziel bestand darin, ‚sich die sowjetische Duldung zu sichernʻ — die Sowjets dazu zu bringen, das, was die Amerikaner in Europa tun wollten, mitzutragen“, heißt es in Trachtenbergs Text.
Der Politikwissenschaftler zitiert auch Aussagen des ehemaligen deutschen Außenministers Hans-Dietrich Genscher. Der FDP-Politiker traf sich am 2. Februar 1990 mit seinem US-Kollegen James Baker. Trachtenberg schreibt:
„Aus dem offiziellen Protokoll des US-Außenministeriums über die Pressekonferenz geht eindeutig hervor, dass aus Genschers Sicht die Zusage der Nichterweiterung der NATO nicht nur für Ostdeutschland, sondern für ganz Osteuropa gelten sollte.“
Genscher:
„Vielleicht darf ich hinzufügen, wir waren uns völlig einig, dass es keine Absicht gibt, das NATO-Verteidigungs- und Sicherheitsgebiet nach Osten auszudehnen. Das gilt nicht nur für die DDR, die wir uns nicht einfach einverleiben wollen, sondern das gilt ebenfalls für alle anderen Staaten im Osten [Hervorhebung Verlag]. (…) Ich denke, es ist Teil dieser Stabilitätspartnerschaft, die wir dem Osten anbieten können, dass wir klar und deutlich machen, dass, was auch immer innerhalb des Warschauer Paktes geschieht, auf unserer Seite keine Absicht besteht, unser Verteidigungsgebiet — das Gebiet der NATO — nach Osten auszudehnen.“
Trachtenberg führt weiter aus: „Und das ist noch nicht alles. Man kann sich sogar einen Ausschnitt aus einer Videoaufzeichnung der Pressekonferenz ansehen, der Genschers Ausführungen enthält.“ Demnach wurde gesagt: „Wir (gemeint sind er und Baker) waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt im Übrigen nicht nur für die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell [Hervorhebung Verlag].“ Baker, so merkt Trachtenberg an, stand bei diesen Worten an Genschers Seite.
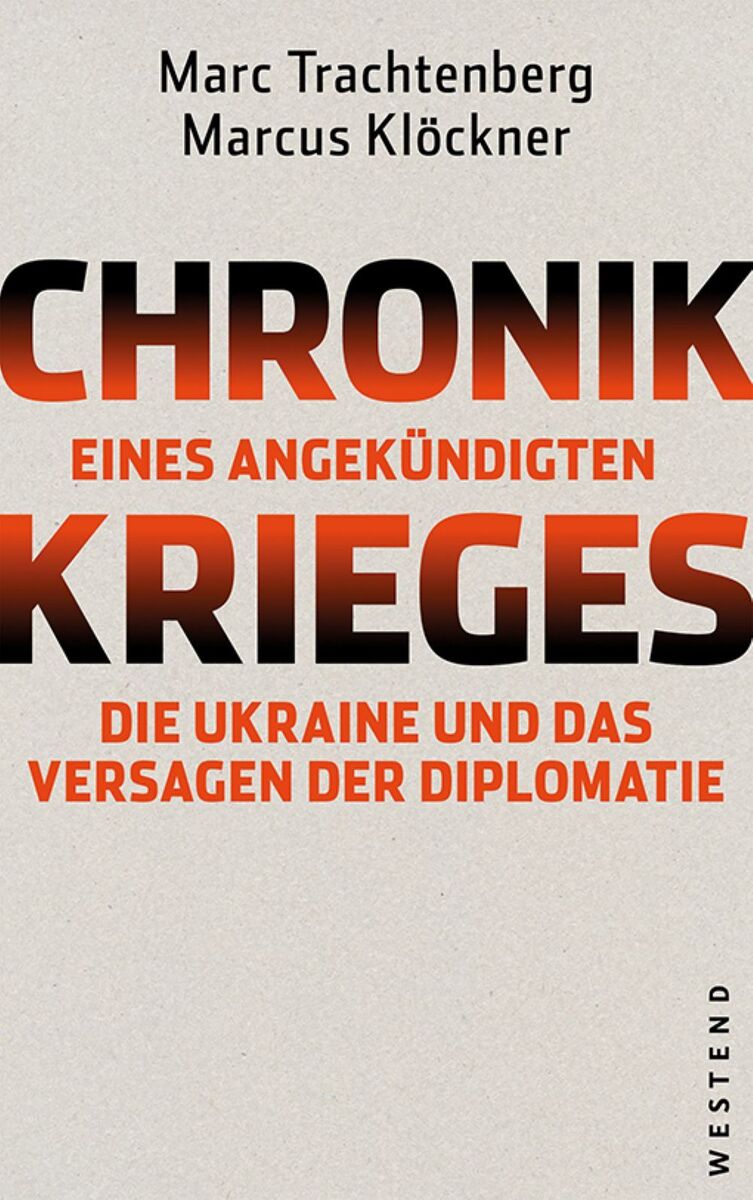
Hier können Sie das Buch bestellen: Buchkomplizen