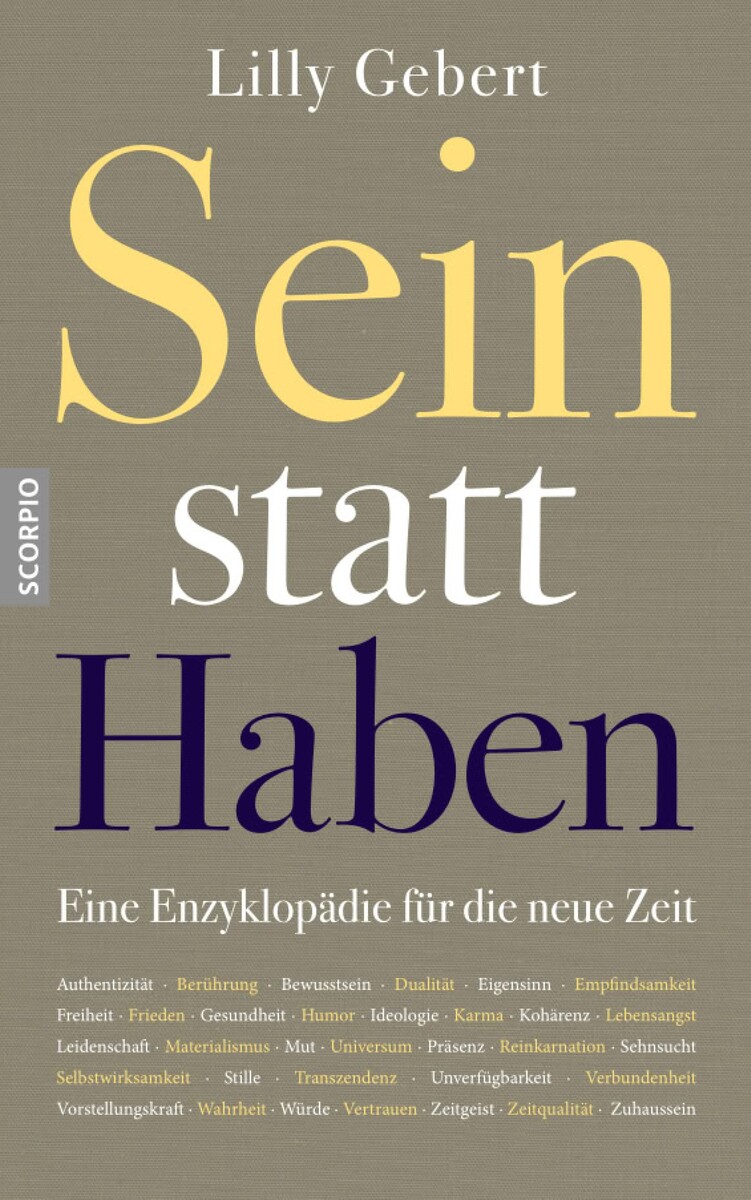Das Fremdsein
Es ist nicht krankhaft, an dieser Welt zu leiden — vielmehr zeugt es von einem gesunden Gefühl dafür, dass vieles hier nicht richtig ist. Exklusivauszug aus „Sein statt Haben“.
„Weltfremd“ — dieses Etikett wird im Tonfall des Vorwurfs verteilt. Wer so bezeichnet wird, fühlt sich in der Regel schlecht und versucht zu beweisen, dass er in Wirklichkeit wunderbar mit dieser Welt zurechtkommt. Fast niemand ist ja gern der Außenseiter, und wenn wir beobachten, dass fast alle anderen Menschen — vermeintlich — bestens mit den Verhältnissen in unserer Gesellschaft und in der materiellen Realität zurechtkommen, fühlen wir uns oft im doppelten Sinn allein: einmal, weil wir an einer seltenen „Krankheit“ zu leiden scheinen, und zum anderen, weil wir unsere Empfindungen mit niemandem teilen können. Die Autorin zeigt in diesem Buchauszug jedoch, dass wir all das auch ganz anders sehen können. Ist denn diese Welt wirklich so großartig, so fehlerfrei, dass es wünschenswert wäre, sich nahtlos in sie einzufügen? Schon der Psychotherapeut Erich Fromm schrieb: „Die Anpassung an eine kranke Gesellschaft ist kein Zeichen von Gesundheit.“ Wer sich immer wieder fremd auf dieser Erde fühlt, sollte damit beginnen, zu sich zu stehen. Vielleicht sieht er manches klarer als seine angepassten Zeitgenossen.
Die Entfremdung.
Sie ist das Lebensgefühl all derer, die dem Schlaf der Welt noch nicht anheimgefallen sind. All jener, die sich fragen, ob die Zeit, in der sie leben, so viel unerträglicher ist als die ihr zuvor gegangenen, oder ob es allein sie sind, die das Leben nicht tragen können. Sie leben jetzt. Und doch fühlt sich dieses „Jetzt“ für sie nicht so an, als sei es zum Leben gemacht.
Die Entfremdung als das Fremdsein in der Welt — womöglich gibt es kein Gefühl, das einen Menschen mehr vom Leben trennt und gleichzeitig versucht, ihn diesem näherzubringen. Denn was ist es, woran der Fremde leidet? An seinem Entkoppeltsein — von der Welt, von seinen Mitmenschen, von sich selbst, während er gleichzeitig nach ihnen hungert. Er wünscht sich Verbindung und fühlt sich dadurch unverbundener denn je. Sind seine Ansprüche zu hoch? Oder ist er es, der der Welt nicht genügt? Wieso sonst scheinen alle anderen sich an ihr zu erfreuen — nur er nicht?
Diesen Zwiespalt des Fremden fasste Albert Camus einst in seinen Tagebüchern zusammen: „Die Tragödie besteht nicht darin, allein zu sein, sondern nicht allein sein zu können. Manchmal würde ich alles hingeben, um durch nichts mehr mit der Welt der Menschen verbunden zu sein. Aber ich bin ein Teil dieser Welt, und so ist es am tapfersten, sie und mit ihr die Tragödie zu akzeptieren“ (1).
Ja, der Weltfremde fühlt sich dieser Welt unverbunden und leidet zugleich daran, an sie gebunden zu sein.
Gerade weil er sich, wie Camus in seinem Sisyphos schreibt, mit ihrem Schicksal verbunden fühlt, hat für ihn „die Erschütterung der Zivilisationen etwas Beängstigendes“ (2). Es ist das Gefühl, gemeinsam mit ihr aus den Fugen geraten zu sein. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber irgendwann zuvor. Und aus diesem Grund gemeinsam in diesem an den Auswirkungen einstiger Verirrungen zu leiden. Oder vielmehr daran, dass es allen anderen an innerem Vergleich und Schicksalsverbundenheit zu fehlen scheint und sie deshalb das Leid der Welt entweder nicht spüren, oder, viel schlimmer, es als normal betrachten.
Aus diesem Ungleichgewicht ergibt sich mitunter der größte Schmerz des Weltfremden: Er scheint allein mit seinem Schmerz. Da ist niemand, der ihn versteht. Niemand, der versteht, woran er leidet, vielleicht nicht einmal er selbst. Das führt leider oft dazu, dass der Weltfremde anfängt, sich selbst zu verleugnen.
Er hält die Schere in seinem Kopf nicht aus. Wenn es allen anderen gut damit zu gehen scheint, die in seinen Augen fehlgeleiteten Züge dieser Zivilisation mitzutragen — warum sollte er, der doch sowieso nichts an dem Risiko ihrer endgültigen Entgleisung ändern kann, als einziger an ihnen leiden, statt ebenfalls von ihnen zu profitieren? … Ja vielleicht, ganz vielleicht, weil der Weltfremde insgeheim weiß, dass jene „anderen“ auch nicht glücklich sind, sie es nur besser verdrängen und verstecken. In diesen Momenten geht es ihm, wie dem Protagonisten aus Michel Houellebecqs Ausweitung der Kampfzone, dessen Arzt ihm auf seine Frage „Bin ich geheilt?“ zu verstehen gab: „Nein, Sie sind jemand, der anders ist und den anderen gleichen möchte. Das ist meiner Meinung nach eine schwere Krankheit.“
Darin liegt das Heilmittel jedes Weltfremden: Wenn er aufhört, sich dafür zu verurteilen, die Falschheit der Welt als falsch zu empfinden. Was nämlich würde passieren, würde er aufhören, sich für seine Weltfremdheit zu schämen und stattdessen anfangen, sie als Geschenk zu sehen?
Denn wo wäre er jetzt ohne sie? Mit wem säße er zusammen? Über welche Dinge würde er reden? Könnte er mit sich alleine sein? Sähe er die Welt so, wie sie ist, und könnte sich ihr gegenüber entsprechend authentisch positionieren? Oder müsste er sich am Ende seines Lebens eingestehen, dieses in Illusionen verbracht zu haben?
Haben wir erst einmal akzeptiert, dass die Dinge so sind, wie sie sind, haben wir ohnehin verloren. Darum besteht zumindest für mich der Weg, dieser entkoppelten Welt nicht anheimzufallen, darin, mich selbst von ihr zu entkoppeln. Mich jeder Zwangsläufigkeit ihres inhärenten Müssens und Sollens dadurch zu entziehen, dass ich mich der Welt entziehe. Ich für mein Gefühl nämlich glaube, dass jedes Gefühl gelebt werden möchte. So auch das Gefühl der Weltfremdheit. Und wer weiß schon, wer oder was uns in die Arme nimmt, wenn wir uns von allen anderen verabschiedet haben? Die Unterwelt? Gott? Wir uns selbst? Welche Welt geht auf, wenn die andere sich schließt?
Nehmen wir unsere Weltfremdheit nicht länger als Ausdruck eines Nichtrichtigseins. Ganz im Gegenteil: Nehmen wir sie als Ausdruck dessen, dass uns noch das Gefühl dafür innewohnt, was in dieser Welt alles nicht richtig ist.
Auf diese Weise können wir nämlich auch mit Stolz das folgende Zitat Ivan Illichs bejahen:
„Aber ich will nicht in diese Welt gehören. Ich will mich in ihr als Fremder, als Wanderer, als Außenseiter, als Besucher, als Gefangener fühlen. Ja, ich spreche von einem Vor-Urteil, also von einer Haltung, nein, nicht einer Haltung, meiner Haltung. Einem Grund, auf dem ich stehe, auf dem ich bestehe…“ (3)
Hier können Sie das Buch bestellen: „Sein statt Haben“