Das Tahiti-Projekt
Die Zerstörung der Welt oder Leben im Ökoparadies? Begleiten Sie den Hamburger Spitzenjournalisten Cording auf seiner Reportagereise. Teil 31.
Eine Vorschau auf das Jahr 2022 — aufgeschrieben mehr als ein Jahrzehnt früher: Die Welt droht in einem Chaos aus natürlichen und menschengemachten Katastrophen unterzugehen. Nur auf Tahiti wächst ein neues ökologisches Paradies heran. Omai, der junge Präsident der Insel, versucht, sein Land zu beschützen. Der Hamburger Spitzenjournalist Cording lässt sich vom Idealismus Omais anstecken und wird unversehens in eine Affäre ungeheuren Ausmaßes hineingezogen. Denn die Mächtigen der Welt haben es auf die Rohstoffvorräte Tahitis abgesehen. Manova veröffentlicht jede Woche ein Kapitel aus Dirk C. Flecks visionärem und spannendem Roman. Hier finden Sie alle vorherigen Teile.
Gegen vier Uhr morgens wurde er wach. Maeva war verschwunden. Er machte sich frisch und stieg hinauf auf die Brücke, um sich zu erkundigen, wo sie sich befanden und wann sie vor Makatea ankommen würden.
„Wir sind nur noch fünfundzwanzig Seemeilen von der Küste entfernt“, sagte der Kapitän. „Vorne fangen sie bereits an, die Fahrt extrem zu drosseln, um den Zug wieder zusammenzuführen. Es sind im Laufe der Nacht doch erhebliche Lücken entstanden im Verbund.“
„Gab es keine Pausen?“
„Nur zwei kurze Verpflegungspausen.“
Er zeigte Cording das Radar. Die Armada hatte die Form einer Kaulquappe — einen aufgeblasenen Kopf und einen langen, dünnen Schwanz. Ein ähnliches, noch größeres Meeresungeheuer näherte sich Makatea von Nordwesten her.
„Sind das die Boote aus dem Rangiroa-Atoll?“
Der Kapitän nickte.
„Was für ein Timing!“, sagte er anerkennend.
Seine goldbetresste Uniform konnte nicht verbergen, dass Maoriblut in seinen Adern floss. Cording erwartete jeden Augenblick, dass er sich mit einem Schrei in den Kriegszustand versetzte. Stattdessen machte ihn der Kapitän auf die rasenden Motoryachten aufmerksam, welche die Armada umrundeten wie Hütehunde. Ihr Motorenlärm überdeckte die heiligen Kriegsgesänge aus den Pirogen. Die reichen Säcke aus Bora-Bora, Moorea, Tahaa und Huahine unterstützten die „tahitianische Sache“ aus purem Eigennutz, dachte Cording grimmig. Eine raumgreifende Umweltverschmutzung war das Letzte, was diese Milliardäre sich auf ihrem paradiesischen Grundbesitz gefallen ließen.
Er bedauerte erneut, dass er auf dieser Fähre zum Zuschauer verdammt war. Er verließ die Brücke und hangelte sich an der Reling entlang Richtung Vorschiff. Dort angekommen, ließ er sich in die Taurolle neben den Poller sinken. Er sah Maevas Silhouette, die sich im Takt der Kriegsgesänge wiegte.
„Hörst du sie singen?“, fragte er sie.
„Ja.“
„Und? Wie sind sie drauf, deine Krieger?“
„Sprich nicht so ...“, ermahnte ihn Maeva lachend und winkte ihn zu sich.
Sie beugte sich weit nach vorn und deutete auf die Delphine und Tümmler, die der Fähre in eleganten Sprüngen voraus eilten.
„Es sind Hunderte, die unsere Pirogen begleiten. Du wirst sehen.“
Im Osten kündigte sich die Dämmerung an. Cording erschrak, als er plötzlich Scheinwerfer aufflammen sah. Die gleißenden Lichtfinger glitten über die Armada. Der Pirogenzug war von Kriegsschiffen in die Zange genommen worden. Aber anders als Cording, der sich geblendet die Hand vor die Augen hielt, reagierten die Frauen und Männer in den Booten sehr gelassen.
Von Bord der amerikanischen Zerstörer wurden Omais Krieger im Stile einer Bahnhofsdurchsage aufgefordert, sofort umzukehren. Viel Zeit für eine unbeobachtete Schweinerei blieb den Marines nicht mehr, der Himmel zog bereits sein schönstes Violett auf. Plötzlich fielen Schüsse. Warnschüsse. Schschschschschttt .... über die Köpfe der sturen „Steinzeitindianer“ hinweg. Schschschschschttt ... Hatte Samuel Wallis 1767 nicht ähnlich gehandelt vor Tahiti?
Die Zerstörer drehten unversehens bei, als über ihnen der weiße Wal am Himmel erschien. Er hatte Videoscreens an den Außenhäuten, auf denen die militärische Nötigung dokumentiert wurde. Cording und Maeva liefen zurück in die Bar, um die Übertragung live im Fernsehen zu verfolgen. Der Skycat befand sich jetzt über Makatea. Das Zusammenfließen der beiden Pirogenschwärme war ein berauschender Anblick. Wie ein Strom aus flüssigem Honig legten sie sich um die Insel. Die Hebetanker steckten fest. Cording wunderte sich über die erstaunlich hohe Zahl an Segel- und Motoryachten, an Fischerbooten und Luxuskatamaranen, die sich dem Zug auf der nächtlichen Reise angeschlossen hatten. Viele hatten Transparente aufgehängt oder ihre guten Wünsche einfach auf die Segel geschrieben.
Omai ließ sich auf seinem Thron bis auf fünf Meter an den Bug der „South Pacific“ rudern, der über ihm im hohen Bogen aufschoss. Sie standen sich gegenüber, das Königs-Kanu und der Supertanker. Was für eine grandiose Inszenierung! Der Mann im weißen Gewand und der schwarze Moloch! Von unten und von oben. Aus der Ameisen- und der Vogelperspektive, auch von der Seite: Größenunterschiede. Die Fratze der Macht, von vorne und von hinten. Der Mut der Polynesier konnte neu bemessen werden.
Kapitän Willis schüttelte immer wieder ungläubig den Kopf. Das Bild, das sich ihm und seinen Offizieren von der Brücke der „South Pacific“ aus bot, war überwältigend. Die ganze Insel war im weiten Umkreis von Kanus umzingelt. Bunte Boote, soweit das Auge reichte.
Wieso hatten die Geheimdienste nicht rechtzeitig Wind von der aufwendigen Aktion bekommen? Die Boote mussten sich doch irgendwo gesammelt haben!
Aber was hätte es ihnen genützt, wenn sie vorbereitet gewesen wären? Was konnten sie diesem friedlichen Aufmarsch der Polynesier schon entgegensetzen? Die Marineführung schien das ähnlich zu sehen, sie hatte die Kommandanten der Zerstörer inzwischen angewiesen, jedes Scharmützel zu vermeiden. Willis seinerseits zögerte den Befehl, die Schürfarbeiten wieder aufzunehmen, trotz des wachsenden Drucks aus Dallas Stunde um Stunde hinaus. Es wäre unverantwortlich gewesen, die unter ihnen treibenden Nussschalen den Turbulenzen und dem Lärm der Förderketten auszusetzen, die diese rund um die Hebetanker auslösten.
Welche Blamage für unser Land, dachte er, und entdeckte sein Gesicht kurz darauf durch den Feldstecher starrend auf der Außenhaut des Skycats wieder. Unwillkürlich trat er einen Schritt zurück. Er hatte keine Lust, vor einem Millionenpublikum den Bösen zu geben, er war nicht verantwortlich für das politische Desaster seiner Regierung. Schlimm genug, dass ihn Washington seit gut sechs Stunden im Unklaren darüber ließ, wie mit der Situation zu verfahren sei, während sie von den Kriegern der Südsee an der Küste Makateas festgezurrt wurden wie Gulliver in Lilliput.
Die Mannschaft der „South Pacific“ hatte sich längst vollständig an Deck begeben, um das faszinierende Schauspiel hautnah mitzuerleben. Viele winkten ihren Besatzern zu, nachdem sie mitbekommen hatten, dass sich auch Frauen in den Kanus befanden. Kapitän Willis zog sich in seine Kajüte zurück und studierte das neueste „Strategiepapier“ von Global Oil, das eben per E-Mail eingetroffen war. Demnach sollten sie in ihrer Tätigkeit unbeirrt fortfahren. Jeglicher Kontakt zu den Einheimischen habe zu unterbleiben. „Verhandlungen werden nicht geführt!“, hieß es lapidar.
Nach Meinung des Vorstandes würde sich der Spuk innerhalb der nächsten 48 Stunden von alleine auflösen, dann nämlich, wenn den polynesischen Besatzern die Verpflegung ausging. Da war was dran. Willis fragte sich nur, warum niemand den irreparablen Imageschaden kalkulierte, den die USA und China gerade vor den Augen der ganzen Welt erlitten.
Willis schaltete den Fernseher ein und sah, wie zwei seiner Besatzungsmitglieder dem Gesang der Krieger von oben herab mit obszönen Gesten begegneten. Er forderte die Bordwache auf, die Männer festzunehmen.
Der Strand von Makatea war ein einziges Leuchtfeuer in dieser Nacht. Die im Abstand von fünfzig Metern lodernden Feuer aus gesammeltem Strandgut ließen die Phosphatklippen erglühen und zauberten die flackernden Silhouetten der umzingelten Hebetanker aus dem Dunkel. Cording, Maeva und Steve hatten sich mit einem der Verpflegungsboote übersetzen lassen, die im unermüdlichen Einsatz waren, um die Krieger an Land mit Obst und Wasser zu versorgen.
Die Pirogen dümpelten eng vertäut auf dem Wasser. Ihre Besatzungen hatten sich bei Sonnenuntergang an den Strand begeben, um sich im warmen Sand von den Strapazen der Überfahrt zu erholen. Omai saß im Kreise seiner Mannschaft und starrte entrückt in die Flammen. Rudolf fing die drei Ankommenden ab. Maeva begriff als Erste, dass dies nicht der Moment war, ihren Bruder in seiner Meditation zu stören. So hockten sich Maeva, Cording und Steve im Abstand von zehn Metern dazu und lauschten dem rauen Sprechgesang der Krieger, der Omais stille Zwiesprache mit den Schutzgeistern untermalte.
Cording war bewusst, dass er gerade Zeuge von etwas wurde, was der Welt trotz der Totalen, trotz aller indiskreten Großaufnahmen, die EMERGENCY TV lieferte, verborgen blieb. Er befand sich im spirituellen Zentrum des Widerstands.
Während auf dem zu Wasser gegangenen Skycat von der Solidaritätskundgebung auf dem Place de la Concorde in Paris berichtet wurde, bat Omai die Götter am Strand von Makatea in aller Bescheidenheit um Beistand. Und wie es aussah, mit Erfolg.
Für die US-Marine wäre es ein Leichtes gewesen, die hölzernen Pirogen in Treibholz zu verwandeln. Aber die offene Flanke, die Omai ihnen anbot, hätte sich nach Lage der Dinge keine Macht der Welt zunutze machen können, ohne dass sich dieser Sieg für sie sofort ins Gegenteil verkehrte. Hier haben wir es wohl mit dem friedlichsten Feldzug zu tun, den die Welt je gesehen hatte, fuhr es Cording durch den Kopf. Er war wirkungsvoller als jede bewaffnete Auseinandersetzung, wirkungsvoller als alle Guerillakriege und Terroranschläge zusammen. Weil er die Herzen der Menschen erreichte. Und die Herzen der Menschen waren hungrig geworden nach Gerechtigkeit.
Präsident Selby hatte sein Kabinett zu einer Sondersitzung zusammengerufen. Außer den Ministern waren noch Francis D. Copland sowie Selbys Chefberater Dennis Phelbs anwesend. Sie wollten darüber beraten, wie man der polynesischen Herausforderung am Wirkungsvollsten begegnen konnte, die die beiden Supermächte USA und China derart in Misskredit brachte. Pekings Standpunkt war bekannt. Die Chinesen drängten auf eine gewaltsame Lösung. Ihr Argument: solange die in China entwickelten Sammelroboter, die bis zu einer Tiefe von sechstausend Metern schürfen konnten, technisch noch nicht vollständig ausgereift waren, hatte man keine andere Wahl, als sich an dem flacheren Mangangürtel zwischen Tahiti und Makatea zu bedienen, wenn man keinen Versorgungsengpass riskieren wollte.
Zur Überraschung aller, die sich an diesem Morgen am Kabinettstisch einfanden, ging der Präsident jedoch mit keinem Wort auf die aktuelle Problematik ein. Er verkündete in knappen Worten die Entlassung des Energieministers Ray Manzarek, des Finanzministers Hubert Brill und des NSA-Chefs Francis D. Copland. Anschließend löste er die Versammlung so schnell wieder auf, wie er sie einberufen hatte. Eine Begründung für seine spektakuläre Entscheidung gab er nicht. Nicht einmal sein engster Vertrauter Dennis Phelbs war über die Hintergründe informiert. Dafür durfte dieser wenig später im Oval Office Zeuge werden, wie der Präsident der Vereinigten Staaten den Befehlshaber der Südpazifikflotte, Admiral Morgan, telefonisch anwies, die Zerstörer unverzüglich aus den tahitianischen Hoheitsgewässern zu entfernen. Ein entsprechender Befehl des Weißen Hauses erging auch an den Kommandanten der „South Pacific“.
Während Phelbs noch konsterniert nach Worten rang, wies Selby seinen herbeizitierten Stabschef an, eine Pressekonferenz für morgen früh um zehn Uhr einzuberufen.
„Was wollen Sie der Presse erzählen?“, fragte Phelbs, der immer noch nicht glauben mochte, was in den letzten Minuten passiert war.
„Ich werde zurücktreten“, antwortete Selby ruhig.
Phelbs war geschockt. Der Präsident, dessen Zögerlichkeit die Nerven seiner Mitarbeiter im Laufe seiner dreijährigen Amtszeit mehr als einmal strapaziert hatte, der auch auf internationalen Meetings als Zauderer galt, agierte in dieser heiklen Situation so entschlossen wie nie zuvor. Der Befreiungsschlag schien ihm gut getan zu haben. Phelbs hatte den Mann, dessen politische Karriere er seit fünfzehn Jahren begleitete, noch nie so entspannt gesehen. Brandon Selby war gewiss kein großer Präsident, ein großer Mensch war er allemal. Vielleicht würde er gar in die Geschichte eingehen. Als erster Präsident im Weißen Haus, der den American Way of Life öffentlich in Frage stellte.
„Lassen Sie mich für einen Augenblick allein, Dennis“, sagte Präsident Selby lächelnd, „es steht mir nämlich noch die schwierige Aufgabe bevor, Mrs. Selby von meiner Entscheidung zu unterrichten ...“
Kapitän Willis empfing den Befehl aus Washington mit großer Erleichterung. Da die komplizierten Hebetechniken noch unbenutzt in den Bäuchen der Tanker schlummerten, würde es ihnen möglich sein, die Stätte der Schmach relativ schnell zu verlassen. Auch wenn sich die Polynesier erstaunlich friedlich verhielten, ein Belagerungszustand barg immer das Risiko, dass sich die feindlichen Lager aneinander entzündeten.
Willis hielt es nicht nur für seine Pflicht, den weiß gewandeten Häuptling über die neueste Entwicklung zu unterrichten, er empfand es als Ehre, einem Mann gegenüber treten zu dürfen, dessen Courage zur Zeit die ganze Welt begeisterte. Er ließ ein Zodiac wassern, was in den Pirogen, die nahe der Bordwand dümpelten, für Unruhe sorgte. Zusammen mit seinem ersten Offizier, der des Französischen einigermaßen mächtig war, kletterte er das Fallreep hinunter und ruderte behutsam durch ein sich nur zäh öffnendes Bootsspalier die dreihundert Meter zum Bug der „South Pacific“. Selbst in der warmen Morgensonne der Südsee strahlte der Stahlkoloss eine Kälte aus, die ihn frösteln ließ. Das lag sicher auch an den Fratzen schneidenden Gesichtern, die ihn begleiteten und denen seine Blicke so gut es ging auszuweichen versuchten.
Omai erwartete den Kapitän auf seinem Thron. Wäre da nicht das über Nacht eingetroffene deutsche Kreuzfahrtschiff im Hintergrund zu sehen gewesen, und würde nicht der Skycat am Himmel kreisen, Willis hätte sich beim Betreten des Königskanus um einige Jahrhunderte zurückversetzt gefühlt. Er nahm Omais Einladung an und setzte sich. Sein Offizier blieb stehen. Nachdem sich der Kommandant vorgestellt hatte und sie sich einige Minuten schweigend gegenüber gesessen hatten, bedeutete Omai dem Gast mit einer sanften Handbewegung, sein Anliegen vorzutragen.
„Ich darf Ihnen mitteilen“, begann Willis, „dass der amerikanische Präsident soeben den Abzug aller drei Hebetanker aus den polynesischen Hoheitsgewässern befohlen hat.“
Omai neigte kaum merklich den Kopf.
„Ich habe Order, die Schiffe unverzüglich in Fahrt zu setzen“, ergänzte Willis. „Um Unfälle zu vermeiden, ist es allerdings erforderlich, dass sich Ihre Boote aus der Bucht entfernen. Ich lasse nicht eher ablegen, bis alle Tanker vollständig aus der Umklammerung befreit sind.“
Wieder verneigte sich Omai wortlos und Willis tat es ihm gleich.
Als der Kapitän eine halbe Stunde später auf die Brücke der „South Pacific“ trat, war die Schneise aufs offene Meer bereits großzügig geöffnet worden. Nach einer Stunde waren die Turbinen warm gelaufen. Willis gab den Befehl zum Ankerlichten. Wie geprügelte Hunde schlichen die Tanker davon, begleitet von einem infernalischen Triumphgeheul, das in diesem Moment auf vielen Plätzen der Welt begeistert aufgenommen wurde.
In Dallas rammte Robert McEwen seine Zigarre in den Aschenbecher und verlangte eine Direktverbindung ins Weiße Haus. Er wusste nicht, dass Präsident Selby gerade auf dem Weg zur Pressekonferenz war, um seinen Rücktritt zu verkünden.
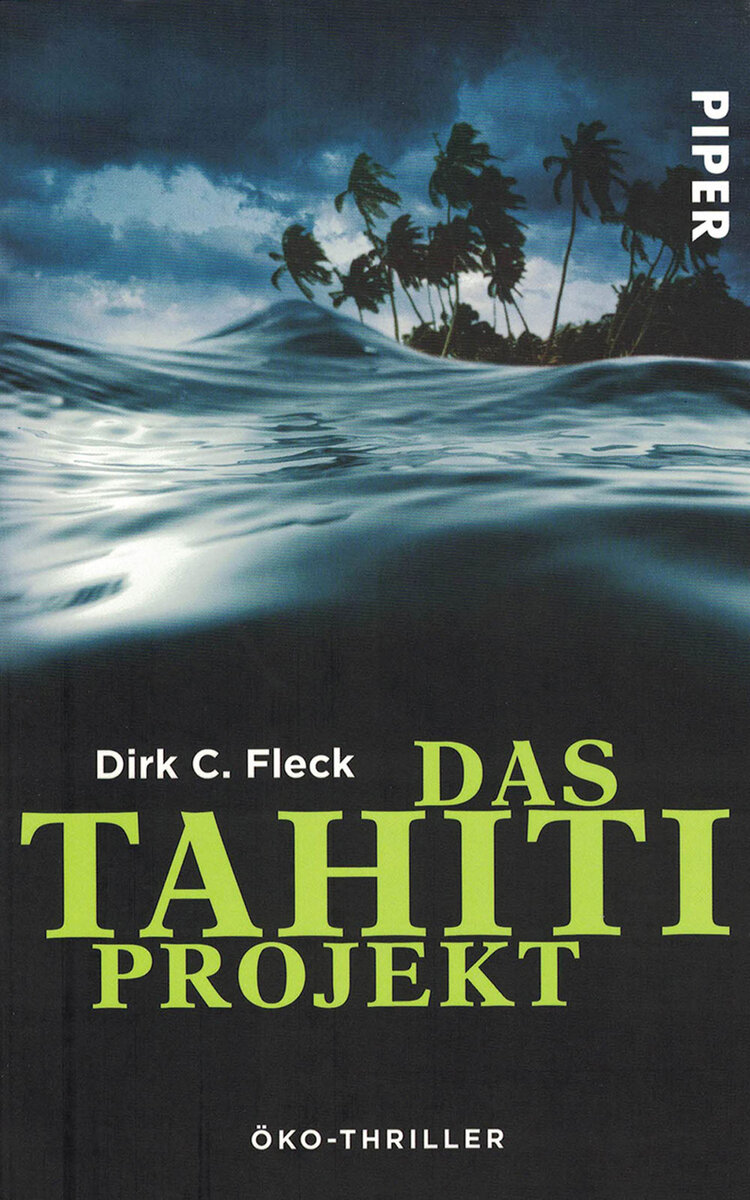
Hier können Sie das Buch bestellen: equilibrismus.org