Das Tahiti-Projekt
Die Zerstörung der Welt oder Leben im Ökoparadies? Begleiten Sie den Hamburger Spitzenjournalisten Cording auf seiner Reportagereise. Teil 32.
Eine Vorschau auf das Jahr 2022 — aufgeschrieben mehr als ein Jahrzehnt früher: Die Welt droht in einem Chaos aus natürlichen und menschengemachten Katastrophen unterzugehen. Nur auf Tahiti wächst ein neues ökologisches Paradies heran. Omai, der junge Präsident der Insel, versucht, sein Land zu beschützen. Der Hamburger Spitzenjournalist Cording lässt sich vom Idealismus Omais anstecken und wird unversehens in eine Affäre ungeheuren Ausmaßes hineingezogen. Denn die Mächtigen der Welt haben es auf die Rohstoffvorräte Tahitis abgesehen. Manova veröffentlicht jede Woche ein Kapitel aus Dirk C. Flecks visionärem und spannendem Roman. Hier finden Sie alle vorherigen Teile.
Auf Tahiti erwarteten die Menschen fieberhaft die Rückkehr ihrer erfolgreichen Armada. Zehntausende hatten sich an den Stränden versammelt und schauten erwartungsvoll aufs Meer hinaus. In der Hauptstadt war der Boulevard Pomare für den Verkehr gesperrt und zu einer einzigen Garküche umfunktioniert worden, in der die erschöpften Krieger beköstigt werden sollten. Auf zwei Kilometern Länge reihte sich eine Roulotte an die nächste. Die ganze Stadt duftete nach Fisch, Gemüse und Obst. Hunderte von Frauen kauerten entlang des Hafenbeckens und flochten ihren Heldinnen und Helden Blumenkränze. Tanzgruppen aus ganz Polynesien probten ihren großen Auftritt. Es herrschte eine Atmosphäre, als sei der Weltfrieden für immer garantiert.
Cording war für die Rückfahrt in den Skycat gestiegen, weil Paul Rooney ihm gesagt hatte, dass sie erst wieder aus Papeete berichten würden, wenn die ersten Boote zurück kamen. Da Maeva unbedingt neben Omai im Königskanu sitzen wollte (was ihr auch gestattet wurde), und da Steve auf der „Auckland Ferry“ mit dem Laptop beschäftigt war, hielt er es für sinnvoll, so schnell wie möglich nach Tahiti zurückzukehren. Er wollte die Stimmung vor Ort atmen. Aber der Skycat ging nicht wie versprochen vor Papeete zu Wasser, er drehte eine flache Runde nach der anderen über die Köpfe der Menschen, die sich in ihren Empfangsvorbereitungen sichtlich belästigt fühlten.
Anstatt jetzt unter ihnen zu weilen, musste Cording in diesem geschlossenen Luftstudio mit ansehen, wie gnadenlos der Regisseur die Gefühle der Polynesier missachtete, um seine Bilder zu bekommen. Irgendwann schwirrten sie ab Richtung Papenoo, um die wartenden Massen an den Stränden zu filmen. Auf einigen Monitoren des Aero-Studios war die Armada zu sehen. Cording hätte gerne seinen Kopf aus dem Fenster gesteckt, um nach ihr Ausschau zu halten, aber das ging nicht, er steckte ja fest in dieser Gummizelle, in der er blind geworden war für die Außenwelt — wo man ihm Augenprothesen in Form von Kameras verpasst hatte.
„Sie kommen“, bemerkte der Regisseur und schaltete ins Begleitboot.
Cording sah die Berge Tahitis am Videohorizont auftauchen, die er von hier aus vermutlich mit Händen greifen könnte, wenn dieses Fluggerät denn über ein Fenster verfügt hätte ...
„Cut und Ende!“, rief Rooney. „Laßt uns abhauen! Den Rest übernehmen die Außenteams.“
„Wo geht’s hin?“, wollte Cording wissen.
„Zurück zum Flugplatz. Die Australier benötigen den Skycat dringend über Sydney. Irgendetwas scheint da aus dem Ruder gelaufen zu sein. Sie wollen keine Infromationen herausgeben, aber die Bilder bei Google Earth belegen deutlich, dass sie begonnen haben, die Stadt zu evakuieren. Tja, so ist das ... Es gibt doch tatsächlich noch andere Probleme auf der Welt. War aber ein verdammt spannendes Spektakel, finden Sie nicht?“
Cording schwieg. Rooney hatte ihm gerade in unnachahmlich schlichter Weise zu Bewusstsein gebracht, dass er die Erde unterscheiden musste: in Tahiti und den Rest der Welt. Im Rest der Welt hatte von nun an er nichts mehr zu suchen.
Als er in Faaa endlich aus dem Skycat steigen durfte, war Omais Königskanu längst in den Hafen eingelaufen. Es würde noch Stunden dauern, bis auch die letzte Piroge von ihrer Mission zurückgekehrt war. Und mit ihr Steve auf der „Auckland Ferry“. Die Fähre diente als „Besendampfer“ am Ende der Armada. Was tun? Maeva würde er in dem Getümmel in und um Papeete nicht finden. Vielleicht sollte ich nachhause gehen, Mike anrufen und zu schreiben anfangen, dachte Cording.
Dann aber besann er sich eines Besseren und tauchte ein in den fröhlichen Karneval rund um den Boulevard Pomare, der ihn bis tief in die Nacht gefangen hielt. Die Klänge* der großen und der kleinen Trommel, der Nasenflöte, der Meerschnecke und der Ukulele, die die vier traditionellen tahitianischen Tänze* begleiteten, vibrierten in den Straßen. Beim Betrachten der Tänze, des Otea, des Hivinau, des Aparima und des Paoa wich auch das letzte Quäntchen Müdigkeit aus seinen Gliedern.
Omai hatte sich für einige Tage von seinen Amtsgeschäften zurückgezogen. Niemand wusste, wie lange die Auszeit dauern würde. Auch Rudolf nicht, dem sein Aufenthaltsort als Einzigem bekannt war. Aber auch Rudolf kam an Omai nicht heran, er hatte den strikten Befehl erhalten, ihn nicht zu stören. Außer in einem ganz bestimmten Fall, und dieser Fall war soeben eingetreten. Die UNO vermeldete, dass Generalsekretär Bagdar Singh Tahitis Präsidenten eingeladen hatte, vor der Vollversammlung in Genf über seine Visionen für eine bessere Welt zu sprechen.
Als Omai kurz darauf gut gelaunt im Regierungspalast erschien, ließ er als erstes Cording und Steve in sein Büro bitten. Er erzählte den beiden von der Einladung aus Genf, die für das Tahiti-Projekt so etwas wie die Krönung darstellte.
„Ohne euren Beistand, ohne euer Wissen, eure Phantasie und euren Einsatz wären wir verloren gewesen“, sagte er gerührt. „Ich möchte euch dafür im Namen aller Polynesier von Herzen danken. Als Zeichen unserer Anerkennung hat das Parlament beschlossen, euch die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen.“
Cording wusste um die Bedeutung eines solchen Erlasses, er war wie ein Ritterschlag, der nur wenigen Fremden zuteil wurde. Er ging auf Omai zu und umarmte ihn — das hatte er noch nie getan, das gehörte sich auf Tahiti eigentlich auch nicht. Steve und Omai machten es richtig: zum Zeichen ihres gegenseitigen Respekts legten sie sich die Fäuste auf die Brust.
„Ihr dürft zwar bei uns bleiben“, fügte Omai verschmitzt lächelnd hinzu, „aber Polynesier seid ihr damit noch lange nicht. Polynesier wird man erst, wenn man sich uns mit Haut und Haaren verschreibt ... Wenn das Verdienst, das euch zum gleichwertigen Mitglied unserer Gesellschaft gemacht hat, auch auf euren Körpern abzulesen ist. Mit anderen Worten: wenn ihr euch die Erfolgsgeschichte der letzten Wochen tätowieren lasst, und zwar auf traditionelle Weise ...“
Omais Sekretärin schaute hinein und meldete, dass ein gewisser Brandon Selby aus Montana in der Leitung sei.
„Er sagt, du wüsstest schon, um wen es sich handelt.“
Omai setzte sich hinter seinen Schreibtisch und nahm den Anruf entgegen.
„Mr. President!“, begrüßte Omai den Anrufer. „Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Sie haben sich als sehr weitsichtig erwiesen. Ihren Rücktritt bedaure ich ...“
„Um ehrlich zu sein, Omai“, sagte Selby, „ich hätte es nicht so weit kommen lassen dürfen, ich hätte mich niemals vor den Karren des Energie-Multis Global Oil spannen lassen dürfen. Aber jetzt ist die Sache ja ausgestanden. Eigentlich wollte ich Sie nur beglückwünschen, Sie haben einen fabelhaften Sieg errungen. Sie haben der Welt bewiesen, das man einer finanziell hochgerüsteten Allianz aus Machtgeilheit, Ignoranz und Hochmut mit friedlichen Mitteln erfolgreich begegnen kann. Dafür möchte ich Ihnen meine Anerkennung aussprechen. Aber überheben Sie sich nicht in der Rolle des Hoffnungsträgers, zu der die Medien Sie zur Zeit hochstilisieren!“
„Es sind die Wünsche der Menschen, die zählen, nicht meine Person“, antwortete Omai. „Die Welt besteht aus manifestierten Wünschen. Und die Wünsche der Menschen sind groß zur Zeit. Aber zu Ihnen, Mr. President: was werden Sie jetzt tun?“
„Ich werde mich um das Amt des Gouverneurs von Montana bewerben. So ganz aussichtslos sind meine Chancen nicht. Der Rücktritt hat mir eine Menge Sympathien eingebracht ... Sollte ich gewinnen, werde ich versuchen, Montana herauslösen aus den Vereinigten Staaten, um die erste Öko-Republik Nordamerikas auszurufen. Kann sein, dass ich dann einige Amtshilfe nötig habe ... Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alle erdenkliche Kraft, Omai.“
„Danke, Mr. President. Wann immer Sie Hilfe benötigen, rufen Sie mich an. Ich habe mich über Ihren Anruf gefreut, er bedeutet mir viel. Auf Wiedersehen.“
Mike Kühling kannte nicht viele Menschen, denen Zutritt in die Etage des Tycoons gewährt wurde. Nicht einmal seine Vorgängerin Lydia Parker hatte das verlagsinterne Heiligtum jemals betreten. Entsprechend nervös bestieg er den Expresslift, der für gewöhnlich nur dem Mann an der Spitze des Konzerns vorbehalten war. Was war so wichtig, dass der Verleger ihn zu sich in den 57. Stock bat? Eigentlich konnte er sich die Einladung nur durch den immensen Erfolg erklären, den EMERGENCY seit der Live-Übertragung aus der Südsee weltweit verbuchen konnte.
Als sich die Fahrstuhltür mit leisem Glockenschlag öffnete, betrat Kühling einen langen Gang, auf dem ihm zwei Schiebetüren aus Panzerglas den Weg versperrten, die sich aber auftaten, als er ihnen auf dem chinesischen Seidenläufer lautlos entgegen schritt. Am Ende des Flurs befand sich der Empfangsraum, in dem Matlocks Sekretärin hinter einer konvexen Glaswand residierte, auf der ein Spruch von Albert Einstein eingraviert war: „Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“
„Sie dürfen eintreten“, sagte die Dame.
Kühling klopfte an die schwere Eichentür.
„Gehen Sie einfach hinein“, ermunterte ihn die Sekretärin lächelnd.
Rupert Matlock erhob sich hinter seinem Schreibtisch, legte dem Gast zur Begrüßung jovial den Arm um die Schulter und führte ihn an die Fensterfront, von wo aus sie einen herrlichen Blick über die Docklands und auf die Themse hatten.
„Sie sind gefeuert, Mike!“, hörte er Matlock just in dem Moment sagen, als die Sekretärin das Kaffeeservice auftischte.
Kühling bekam weiche Knie.
„Setzen wir uns!“, sagte Matlock und nahm in dem schweren Ledersessel Platz, während sich sein Chefredakteur auf die Couch sinken ließ.
„Das hat gut getan!“, brummte der Verleger. „Ich wollte die Kündigung doch zumindest einmal laut ausgesprochen haben. Aber so sehr es mich auch drängt, Sie von Ihrer Funktion zu entbinden, so sehr sind mir in dieser Angelegenheit die Hände gebunden. Jetzt, da unser Haus vor aller Welt die grüne Fahne der Gerechtigkeit gehisst hat, würde es einen verdammt schlechten Eindruck machen, wenn ich ausgerechnet jenen Mann entlasse, der diesen Ruck ins engagierte Ökolager zu verantworten hat. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht?“
„Ich versteh nicht recht, Sir ...“
„Natürlich nicht. Sonst wären Sie wohl kaum so dumm gewesen, unser Flaggschiff EMERGENCY im Alleingang inhaltlich komplett neu zu positionieren. Mein Gott, Kühling! Sie wissen doch, wie das Spiel funktioniert. Dass wir mit Global Oil einen unserer potentesten Anzeigenkunden verloren haben, kann ich verschmerzen. Die haben sich selbst ins Bein geschossen, und tun gut daran, wenn sie das Maul halten. Sollen sie ihren Werbetat ruhig anderswohin verschieben. Sie werden schon merken, dass sich ein so gründlich ramponiertes Image mit den Mitteln der klassischen Werbung nicht reparieren lässt. Aber was ist mit den anderen? Was, wenn unsere Inserenten zu befürchten beginnen, dass sie ihre falschen Versprechungen im Zentralorgan des ökologischen Widerstands abgeben? Ich sag Ihnen, die Sache ist hochgefährlich. Sie müssen diesem Ökotrend im Blatt unbedingt ein Ende setzen. Vor allem kein Wort mehr über Polynesien und Omai, das bringt uns in Teufels Küche. Haben wir uns verstanden?“
„Ja, Sir.“
Matlock geleitete Kühling zur Tür.
„Die Berichterstattung aus Tahiti war übrigens hervorragend“, sagte er zum Abschied, „sowohl im Blatt als auch im TV. Saubere Arbeit, wirklich. Aber Job ist Job. Ich verlass mich auf Sie.“
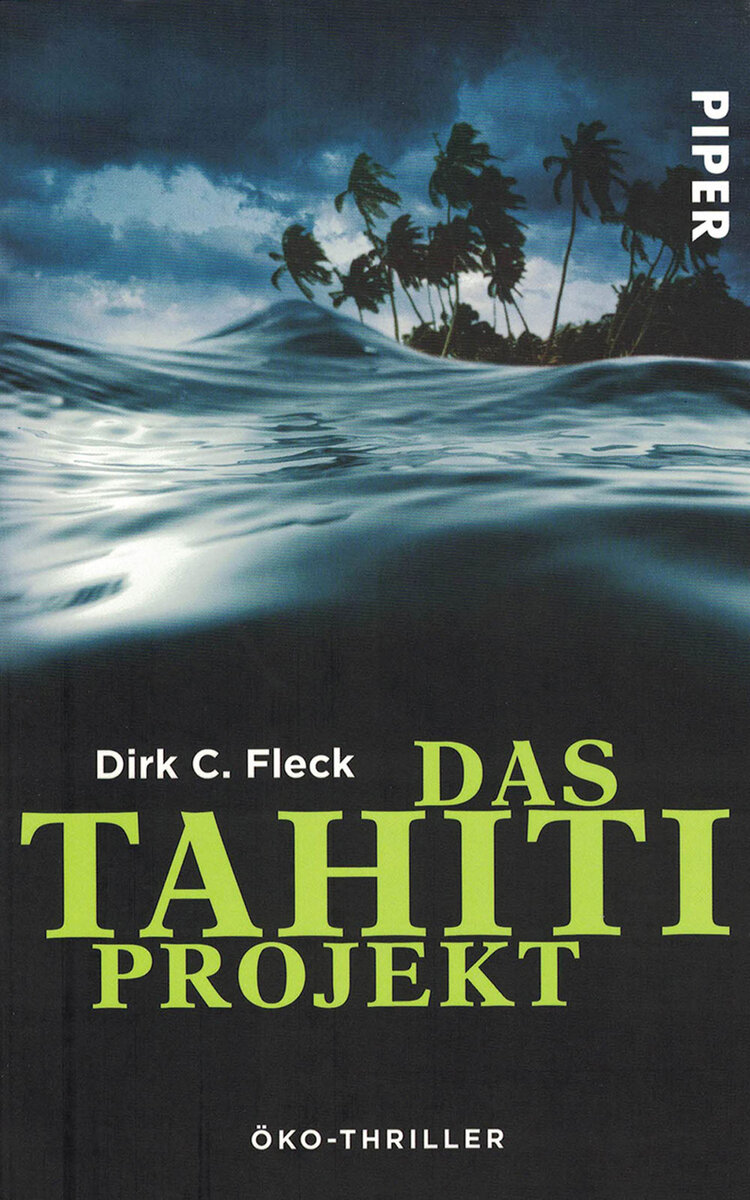
Hier können Sie das Buch bestellen: equilibrismus.org