Die Amerikanisierung des Orients
Der in Saudi-Arabien verbotene Roman „Salzstädte“ beschreibt die Zerstörung einer Kultur aus einer für viele Westler neuen Perspektive.
Von einer tribalen Wüstengesellschaft zur Ölmonarchie — Abd ar-Rahman Munif unternimmt in „Salzstädte“ auf über 500 Seiten eine wenig verschlüsselte literarische Nachzeichnung der Entwicklung Saudi-Arabiens. Zurück bleiben Beklommenheit und eine immense Trauer. Das Schicksal der Menschen des Wüstenstaats ist plötzlich mit dem eigenen Leben verstrickt.
Eine tiefe Traurigkeit ergreift das Gemüt. Die Ohnmacht der Bewohner zweier vergessener Wüstenorte, als eines Tages die Fremden auftauchen. Die Blauäugigen kommen mit der Erlaubnis der Regierung zu ihnen und dementsprechend in den Genuss der üblichen Gastfreundschaft. Niemand versteht, was die Weißen bei ihnen wollen. Sie sprechen sogar Arabisch.
Die Geschichte beginnt in Wadi-al-Ujun, dem Tal der Wasserquellen — mitten in der Wüste.
Ein bekannter und etwas eigentümlicher Bewohner der Oase, Mut’ib Haddal, äußert nach und nach seine Bedenken und warnt die anderen immer eindringlicher. Doch das Schicksal nimmt seinen Lauf und auf einmal geschieht das Unvorstellbare:
„Als die Maschinen sich dröhnend in Bewegung setzten, stieß er einen durchdringenden, schmerzlichen Schrei aus: ‚Schade um dich, Wadi al-Ujun, schade!‘
Jenes Treiben war eine wahrhaft irrwitzige Ankündigung des Untergangs. Und wenn es jemanden gibt, der sich dieser lange zurückliegenden Tage erinnert, jener Tage, an denen es einen Ort namens Wadi al-Ujun, einen Mann namens Mut’ib Haddal, eine Wasserquelle, Bäume und Menschen besonderer Natur gegeben hatte — wenn es noch jemanden gibt, der sich zu erinnern vermag, so sind es immer wieder diese Erinnerungen, die sein Herz bewegen.
Die Erinnerung an die Maschinen, wie sie sich wie hungrige Wölfe auf die Palmen und Feigenbäume stürzten, sie zu zerreißen begannen und sie, einen nach dem anderen, zu Boden warfen. Wie sie danach den Boden platt walzten und die Bewässerungskanäle zuschütteten. Sobald sie mit einer Baumgruppe fertig waren, stürzten sie sich mit der gleichen Gier und Wildheit auf die nächste.
Die Bäume taumelten und neigten sich, ehe sie zu Boden fielen, sie schrien, klagten verzweifelt, stießen einen letzten schmerzlichen Ruf aus, als protestierten sie. Sie fielen um, als wollten sie sich mit dem Boden vereinen, um erneut aus ihm hervorzubrechen.
So begann das Gemetzel von Wadi al-Ujun, und es dauerte an, bis alles vernichtet war. Mut’ib Haddal beobachtete dessen Anfang, doch er wartete das Ende nicht ab. Die Männer, die der Lärm der besessenen Maschinen angelockt hatte, und die nun dastanden und das Geschehen verfolgten, erwachten langsam aus ihrem Staunen. Sie drehten sich um und sahen Ibn Haddal und sagten viele traurige Dinge. Sie sagten, zum ersten Mal in ihrem Leben hätten sie einen Mann wie Mut’ib Haddal weinen sehen. Seine Tränen seien lautlos geflossen. Er sei ganz still gewesen, habe kein Wort gesagt, nicht geflucht und nicht gestöhnt. Seiner Kehle sei kein einziger Laut entstiegen, nur die Tränen seien geflossen.“
Das geschieht auf Seite 99 von 555 Seiten. Zuvor tauchte der Leser in das Leben der Bewohner dieser außergewöhnlichen Oase ein, erlebte die Geselligkeit und auch Streitigkeiten mit, ging mit den Frauen zur Wasserquelle und beobachtete das merkwürdige Treiben der Amerikaner. Und unweigerlich wird auch der Leser von dieser Trauer ergriffen. Fühlt, wie einst auch auf dem Boden, wo er heute in der zugebauten Welt lebt, Bäume ausgerissen wurden, um Wohlstand zu erschaffen — und nach und nach auch die Menschen ebenso entwurzelt wurden wie die Palmen von Wadi al-Ujun.
Und dabei bleibt es nicht. „Die Firma“, wie das amerikanische Ölunternehmen im ganzen Roman genannt wird, braucht auch einen Hauptsitz am Meer, um ihren kostbaren Schatz dann per Schiff in die Welt zu transportieren. Ihre Wahl fällt auf Harran, wo ebenfalls die Häuser der Einwohner einfach abgerissen werden. Dafür errichten die Amerikaner dann Lager: eines für sich, das sie mit Stacheldraht umzäunen und in dem sie die arabischen Arbeiter große Häuser mit Pool und Garten für sich bauen lassen; ein anderes für die Arbeiter, in dem sie Baracken mit Metalldächern aufstellen, in denen sich die Hitze staut.
Ein Einwohner Wadi Al-Ujuns, Ibn Rached, hatte sich mit der Aussicht auf Macht und Geld schnell mit den Amerikanern verbündet und lebt inzwischen auch in Harran. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Männer aus den durch die Wüste ziehenden Karawanen anzuheuern. Er verspricht ihnen vorübergehende Arbeit mit guter Bezahlung.
Einige der neuen Arbeiter stammen ebenfalls aus Wadi Al-Ujun. Zunächst stellen sich die Araber ungeschickt an, da sie noch nie mit Maschinen gearbeitet haben. Ihr Stolz ist verletzt, als die Amerikaner sich auch noch über sie lustig machen. Sie lernen schnell, um ihre Würde zurückzugewinnen und den Fremden zu zeigen, was sie können. Und so bekommt die Firma, was sie braucht: Männer, die in der unerbittlichen, feuchten Hitze Harrans den ganzen Tag hart schuften, um alles nach den Vorstellungen der Amerikaner zu bauen — den Hafen, eine Straße durch die Wüste und die Pipeline von Wadi Al-Ujun nach Harran. Dabei werden sie mit dem Versprechen von Wohlstand für sich und ihre Familien hingehalten.
Bei der ersten Lohnzahlung sind sie überwältigt, zum ersten Mal so viel Geld in den Händen zu halten. Zuvor brauchten sie es nicht, denn sie hatten ihr Land und ihre Lehmhäuser oder Zelte. Doch sie glauben noch daran, dass sie mit dem Geld bald neues Land und neue Häuser kaufen können. Viele beschließen, länger zu bleiben, um mehr Geld zu sparen. So auch Swailih Hudaib, der Neffe von Mut‘ib Haddal, denn er ist verliebt und braucht Geld, um heiraten zu können.
Das traurige Schicksal der Männer wird besiegelt, als Ibn Rached sie überzeugt, ihre Kamele — auf denen sie aus der Wüste nach Harran gekommen waren — zu verkaufen, da sie sie nun nicht mehr bräuchten.
„Zum ersten Mal hatten die Männer das Gefühl, eine endgültige Entscheidung treffen zu müssen. Man forderte von ihnen, sich vom wertvollsten zu trennen, das sie besaßen. Jeder von ihnen hatte geschuftet und sich abgerackert, um eine Kamelstute oder einen Hengst kaufen zu können, und wenn sie ihre Reittiere heute verkauften, so würden sie in absehbarer Zeit keinen Ersatz beschaffen können. Und das bedeutete, dass sie an dieses Kaff gefesselt waren, dass sie für lange Zeit, vielleicht sogar für immer hier bleiben mussten.
Fawwas‘ Kamelstute war ein Geschenk seines Vaters (Mut’ib Haddal) und hatte ihn während der vergangenen zwei Jahre begleitet. (…) Er konnte sie nicht einfach an einen Fremden verkaufen. (…) Swailih spürte sofort, was Fawwas bedrückte. Spät in der Nacht, als die meisten Arbeiter bereits schliefen, forderte er Fawwas auf, mit ihm nach draußen zu gehen, da er keinen Schlaf finde und mit ihm sprechen wolle.
In der Stille der Nacht, an diesem nunmehr namenslosen Ort, dessen Häuser zerstört worden waren, hätte Swailih gerne so viel gesagt, doch er war verlegen und zögerte. Unvermittelt begann er die Worte, die sein Herz beschwerten, hinauszusingen.
Sein Gesang glich einem heimlichen Geständnis. Er besang Watfa und seine Liebe zu ihr (…). Für sie wollte er alles in Kauf nehmen, in die Fremde gehen und sich plagen. Wenn er aber genug Geld gespart hätte, würde ihn nichts mehr halten (…). Nach einer Weile flüsterte er leise:
‚Ich vergehe vor Liebe, Gott stellt mich auf die Probe. Du musst mir helfen, Vetter!‘
(…)
‚Ich halte es hier nicht mehr aus, ich muss weg von hier!‘, sagte (Fawwas) wütend.
War es Swailihs verzweifelter Blick, den Fawwas in der Dunkelheit mehr spürte als sah? (…) Oder hatte er ihm irgendwie zu verstehen gegeben, dass er ihm den Todesstoß versetzen würde, wenn er ihn jetzt im Stich ließe? Irgendetwas bewog Fawwas dazu, weiter zu seinem Vetter zu halten. Er war bedrückt und fühlte sich einsam an diesem fremden Ort.“
Auch wenn die orientalische Wüstenkultur und ihre Einwohner einem deutschen Leser exotisch anmuten, so ist das Gefühl, das der Autor des Romans vermittelt, sehr vertraut. Und immer wieder lauert die Verbindung zwischen diesen Menschen und dem heutigen Leser im Hintergrund. Von dort kommt das Öl, das auch den deutschen Alltag heute antreibt. Dort holt sich die Megamaschine der Moderne seit jeher ihren Antrieb.
Abd ar-Rahman Munifs Worte landen im Herzen. Sie machen begreiflich, was Wohlstand wirklich bedeutet. Wie viele Menschen leiden darunter, ihn zu erschaffen? Wie viele von ihnen sind sich dessen noch nicht einmal bewusst, weil sie zu den Privilegierteren gehören, die nicht in einer Fabrik oder in der Wüste beim Bau einer Pipeline arbeiten müssen? Doch auch heutige Büromenschen spüren eine gewisse Sehnsucht in sich. Nach Lebendigkeit, nach Verbindung, nach Freiheit. Nach Zugehörigkeit. Nach Sinn.
Der Autor beschreibt das Gefühl der Menschen des erst wenige Jahre zuvor gegründeten Saudi-Arabiens. Und auch das vermag der Roman: Die Differenzierung zwischen der saudischen Regierung und der Bevölkerung in Erinnerung zu rufen, die bei medialer Berichterstattung immer wieder untergeht. Der Leser von „Salzstädte“ trauert mit den Menschen in Wadi al-Ujun und Harran um ihre Träume und Wurzeln.
„Die Menschen fühlten das Unglück über sich hereinbrechen und die Furcht sie umzingeln. (…) Es stimmte schon, dass die Firma jetzt bezahlte, doch was sie heute mit einer Hand erhielten, gaben sie morgen mit der anderen wieder aus. Die Preise stiegen täglich, und das Kapital sammelte sich in den Händen weniger. (…) Die ‚Personalverwaltung‘ hatte angekündigt, die Firma werde Häuser für die Arbeiter bauen, und ein jeder werde seine Familie nachholen können und allabendlich in sein eigenes Heim zu seinen Kindern gehen. Doch die Jahre waren vergangen, und kein einziges Haus war gebaut worden. Stattdessen zwängten sie sich jede Nacht in die verfluchten Baracken, in denen sich von Tag zu Tag die Hitze heftiger staute und der Schmutz weiter anhäufte.
Die Arbeiter hingen diesen Gedanken nach und gedachten ihrer Familien. Sie hatten das Gefühl, von der Trauer überwältigt zu werden. Und die Bewohner Harrans, die in ihre Gesichter schauten und sich gegenseitig anblickten, konnten das Unglück und die Sorge der Männer nachempfinden und wurden selbst vom Kummer übermannt.
Obwohl sie nicht frei von Angst waren, trauten sie sich, Dinge zu sagen, die sie sonst, ohne diesen Zorn, niemals ausgesprochen hätten. Warum lebten sie ein solches Leben und die Amerikaner ein ganz anderes? Warum verbot man ihnen, sich den Häusern der Amerikaner zu nähern oder die Schwimmbäder auch nur anzuschauen oder einen einzigen Augenblick im Schatten eines Baumes stehen zu bleiben? Die Amerikaner brüllten, sie sollten sich fortmachen und verjagten sie wie Hunde. (…)
Und der Emir? War es wirklich ihr Emir, der sie verteidigte und beschützte? Oder war es der Emir der Amerikaner?“
Stellen sich nicht viele Deutsche auch die Frage, wem ihre Regierung eigentlich dient? Ist es nicht eine erstaunliche Parallele zu unserem heutigen Gefühl, dass die eigenen Volksvertreter „den Amerikanern“ oder besser gesagt „amerikanischen Unternehmen“ helfen die Mehrheit der Menschen zu knechten?
Gleichzeitig wird in Europa durch Medien und Politiker eine Angst vor der Islamisierung des Abendlandes geschürt, während das bereits geschehene Unheil, die „Amerikanisierung“ der Welt, die Entwurzelung der Menschen, unsichtbar bleibt.
„Amerikanisierung bezeichnet (…) den Wandel einer Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur oder Person in Richtung der vorherrschenden Gegebenheiten in den USA, beziehungsweise hin zum Leitbild des so genannten ‚American Way of Life‘“ (1).
Es ist erstaunlich, dass der „American Way of Life“ noch immer von vielen als positiv eingeschätzt wird. Die Medien leisten ganze Arbeit. Bleibt doch nicht verborgen, wie viel Armut inmitten von „Wohlstand“ noch herrscht und dass diejenigen, die am härtesten arbeiten, oft am wenigsten verdienen. Alle anderen haben zwar materiell, was sie zum Leben brauchen, und manchmal sogar noch mehr — und sind dennoch depressiv oder gestresst.
Welch eine Wohltat zwischen all den nüchternen Analysen über Geopolitik jenseits von gefühlskalten, verkopften Meinungen die warmen Worte eines arabischen Autors zu fühlen, der das Schicksal der menschlichen Seele im Rausch der Moderne so treffend beschreibt.
Der Großteil der Menschen, Tiere und Natur wird im Namen eines „Wohlstands“ ausgebeutet und zerstört, den niemand wirklich genießen kann — die einen nicht, weil sie nie etwas davon abbekommen, und die anderen nicht, weil sie feststellen, dass all ihr Hab und Gut sie nicht glücklich macht, wenn sie keine Verbindung mehr zu sich selbst, ihren Wurzeln und dem Leben haben.
Abd ar-Rahman Munif vermag es, erstarrte Herzen aufzubrechen und die Verbindung zwischen Menschen verschiedener Kulturen herzustellen. Ignoranz weicht unweigerlich Mitgefühl — für das Schicksal einer fremden Kultur, das sich doch so vertraut anfühlt.
Ein lesenswerter Roman, der Brücken baut und zum Nachdenken anregt.
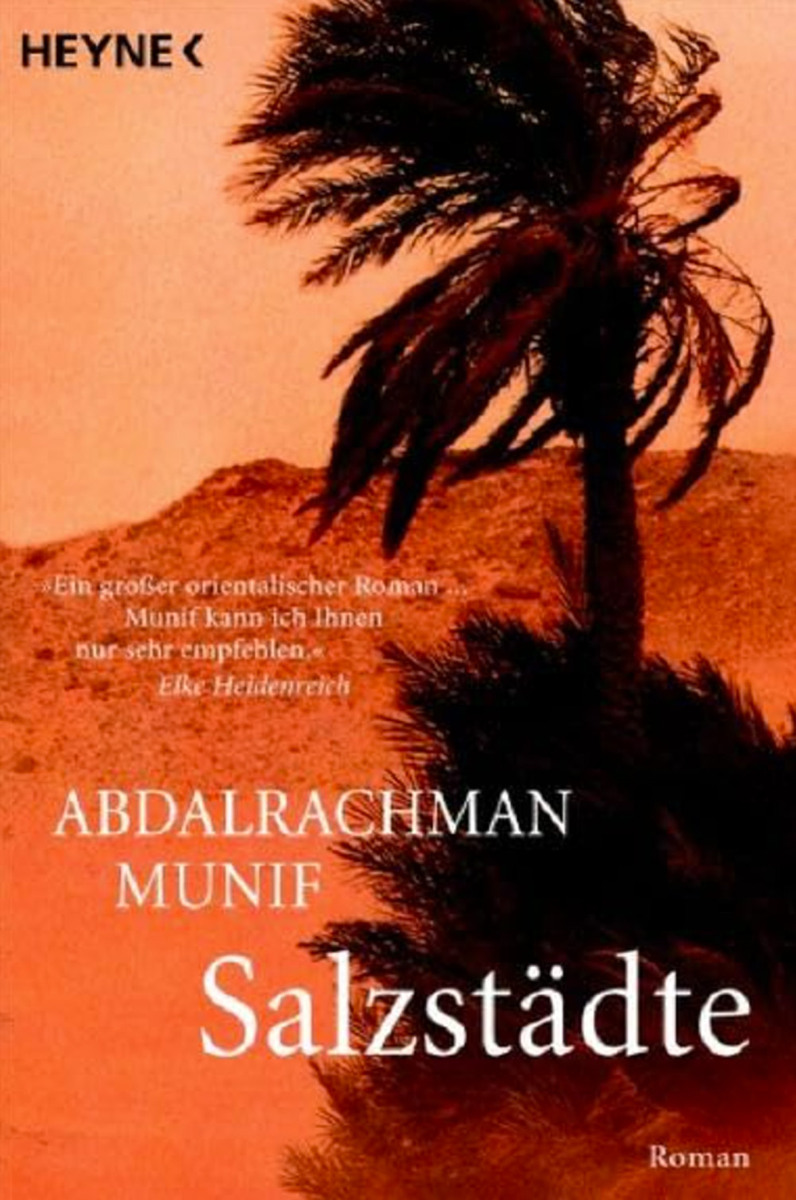
Buch nur noch gebraucht erhältlich.