Die Plünderung der Wälder
Nicole Maron beschreibt in Ihrem Buch „Kahlschlag im Amazonas“ den rücksichtslosen Palmöl- und Kakaoanbau in Peru, betrieben von einem undurchsichtigen Geflecht aus global agierenden Konzernen.
Unter dem Deckmantel von Nachhaltigkeit und ethischer Produktion zerstören internationale Konzerne enorme Flächen südamerikanischen Regenwalds. Sie betreiben Raubbau an Natur und Artenvielfalt genauso wie am Lebensraum lokaler Gemeinschaften. Die Journalistin Nicole Maron recherchierte mehrere Jahre vor Ort und legte nun mit ihrem Buch eine Beschreibung der Zustände in Reportagenform vor. Besonders befasst sie sich mit dem Fall von Dennis Melka, einem tschechisch-amerikanischen Unternehmer, der eine umstrittene Rolle in dieser Geschichte spielt.
„Die in diesem Buch erzählte Geschichte ist leider kein Einzelfall. Es gibt auf der Welt tausende von Geschäftsmännern wie Dennis Melka, deren Konsortien ganz ähnlich funktionieren. Ich hätte genauso gut über sie schreiben können. Schliesslich fechte ich hier keine persönliche Fehde aus, sondern versuche, die Funktionsweise eines Systems aufzuzeigen, das auf der ganzen Welt grossen Schaden anrichtet.“
Über zwei Jahre lang hat die Schweizer Journalistin Nicole Maron in Lateinamerika zum sogenannten „Melka-Fall“ in Peru recherchiert. Sie arbeitete Akten, Gerichtsdokumente, Geschäfts- und Medienberichte durch. Sie beklebte ihre Wände mit Mindmaps der verschlungenen Geschäftsbeziehungen und Standorte. Sie reiste auf die Plantagen und in den Regenwald, redete mit Betroffenen, etwa mit Kleinbauern und Indigenen, die vom Regenwald leben und denen durch Abholzung ihre Lebensgrundlage entzogen wird. Mit Menschenrechtsaktivisten und Umweltanwälten, die versuchen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Auf der Grundlage ihrer Recherche hat sie ein sehr spannendes Buch geschrieben: „Kahlschlag im Amazonas“, gerade erschienen im PapyRossa Verlag. Im Mai ist sie auf einer Lesereise in Deutschland, am 1. Juni auch in Zürich.
Was ich jetzt aufschreibe, steht so nicht in ihrem Buch. Und die Autorin bestätigt es auch auf Nachfrage nicht, wie man im unten verlinkten Podcast nachhören kann. Ich glaube zwar, dass sie mehr oder weniger das denkt, was ich hier schreibe, aber das ist — und das sage ich hier noch einmal ganz deutlich — meine persönliche Meinung. Denn Nicole weiß, dass sie für jedes nicht zweihundertprozentig belegte Wort verklagt werden könnte.
Worum geht es? Um einen der unzähligen, aber wenigen gut dokumentierten Fälle von rücksichtslosem, kaltschnäuzigem, ausschließlich an maximalem Profit interessierten Raubtierkapitalismus. Es geht um kapitalistische Konsortien, die wie Heuschreckenschwärme über unseren Planeten rasen und dabei ausbeuten und zerstören, was sich zu Geld machen lässt, Bauern und Indigene um ihr Land prellen, die Widerständigen unter ihnen bedrohen, einschüchtern und unter Druck setzen und sich selbst quasi unangreifbar machen in ihren Firmengeflechten. Diese Leute spielen Katz und Maus mit Richtern, Gesetzen, regionalen Regierungen, überziehen Kritiker und Aktivisten mit endlosen Klagen, Drohungen und Verleumdungen und lassen sich dann für all das obendrein noch mit Preisen für „nachhaltige und ethische Werte“ auszeichnen.
Wenn die Machenschaften — wie diesmal in Peru — doch einmal auffliegen, müssen die Drahtzieher keine Strafe fürchten. Sie ziehen einfach ins nächste Eldorado weiter und hinterlassen Firmengeflechte, mit denen sich die Gerichte noch Jahrzehnte beschäftigen können.
Dennis Melka, ein tschechisch-amerikanischer Geschäftsmann, ist wahrscheinlich nicht einmal besonders dreist gewesen — seine Strategie entspricht vermutlich schlicht dem Standard global agierenden Unternehmertums. Nachdem er bereits am Palmölboom in Malaysia teilhatte — erfolgreich aus finanzieller Sicht, aber völlig ruinös für die Artenvielfalt, den Regenwald und die Kulturen der dort lebenden Indigenen —, fand er 2010 ein noch erfolgversprechenderes Land für Palmöl- und dann auch für Kakaoanbau: Peru.
Das notwendige Finanzkapital kam von europäischen Investoren, denen Melka — dank Billiglöhnen, null Steuern und steigenden Preisen — neben 300 Prozent Gewinnmarge auch „einen Weg zu ethisch produziertem Kakao“ versprach.
Diese Betonung entsprang nicht etwa einer sozialen Ader, sondern einer nüchternen Marktanalyse:
„Die oben genannten Faktoren (der Ethik und Nachhaltigkeit) dürften uns einen erheblichen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verschaffen; auch aufgrund der allgemeinen Tendenz des globalen Süßwarenmarkts, Kakaobohnen aus zuverlässigen, ethischen und langfristigen Quellen zu beziehen.“
Dennis Melka gründete 2011 in Peru ein Geflecht aus 25 Unternehmen, mit denen er es über die nächsten Jahre schaffte, 13.000 Hektar Land, davon etwa 80 Prozent Primärwald, zusammenzukaufen — teilweise von Regierungen, teilweise Stück für Stück von Kleinbauern —, ihn zu roden und darauf Kakao- beziehungsweise Palmölmonokulturen anzupflanzen.
Moment mal — ist das nicht verboten? Ist nicht Peru, wie auch die anderen Amazonasstaaten, viele Verpflichtungen eingegangen, seinen Primärwald zu schützen? Hat das Land dafür nicht Gelder von der UNO, der EU und anderen Ländern bekommen? Hat nicht Peru den Vertrag zum Schutz von Wäldern in indigenem Besitz ratifiziert? Viermal ein Ja — und dennoch werden immer größere Waldflächen Perus unwiederbringlich zerstört, die Artenvielfalt zerstört, die Bewohner ihrer Lebensgrundlagen beraubt.
In diesem Fall ging die Abholzung schneller, als die Behörden und Gerichte sie aufhalten konnten — so sie denn überhaupt wollten. Und darin waren sie sich nicht einig, denn schließlich versprach der Anbau „Arbeitsplätze“, „Entwicklung“, Schulen.
Die finanziell gut ausgestatteten Rechtsabteilungen der Unternehmen fanden zudem etliche Gesetzeslücken, die es erlaubten, Gerichtsprozesse bei Bedarf endlos hinauszuzögern — und sie fanden immer wieder auch geneigte Bürgermeister, Richter oder Journalisten. Währenddessen gingen der Kahlschlag und die Produktion von Kakao beziehungsweise Palmöl weiter — bis heute. Die Liste an Verfahren, Urteilen, Strafen, Revisionen und Berichten ist lang — und die Ergebnisse bilden einen Schlingerkurs. Nicole Maron formuliert es so:
„Wie bei einem Pingpong-Spiel in Zeitlupe reichen die Ämter Dokumente mit juristischen Argumentationen, den Ergebnissen von Inspektionen sowie Debatten über Zuständigkeiten hin und her.“
Möglicherweise — und das sage wiederum ich — waren nicht alle Richter, Beamten, Journalisten so unabhängig wie gewünscht.
Doch der ganz große Coup Melkas, für den er fast 100.000 Hektar von der Regionalregierung kaufen wollte, scheiterte. 2016 wurden seine Unternehmen von der Londoner Börse ausgeschlossen. Als die Vorwürfe und Verfahren zu dicht wurden, verließ Dennis Melka Peru für immer. Seine Unternehmen verkaufte er — zumindest offiziell. Die Produktion von Palmöl und Kakao aber geht weiter. Zwar heißen die beteiligten Firmen jetzt anders, aber außer den Namen änderte sich nicht viel; es sind zum großen Teil dieselben Beschäftigten, Geschäftsführer, Aktionäre wie in den alten Firmen. In der Rechtsnachfolge für diese Verbrechen ist — niemand.
Es war für Nicole Maron keine einfache Aufgabe, diese Recherche über mehrere Jahre durchzuführen. Im Bewusstsein der Erfahrungen vieler Kritiker, die von den Rechtsabteilungen für die kleinsten Fehler verklagt wurden, suchte sie für alle Fakten akribisch Originaldokumente. Auch behauptet sie im Buch nichts: Sie schreibt im Reportagestil, nimmt uns Leser mit in den Regenwald, in ihre Überlegungen und Erkenntnisse, und lässt die Quellen und die Interviewpartner für sich sprechen.
Dennoch geht die Buchautorin davon aus, dass sie oder ihr Verlag vor Gericht kommen könnten.
„Das ist ein sehr ungleiches Machtverhältnis für kleine NGOs, Zeitungsorgane oder unabhängige Journalisten, wenn sie viele Jahre lang zu Gerichtsverhandlungen müssen — selbst wenn sie am Ende recht bekommen.“
Ein ziemlich wirkungsvolles Zensurmittel, finde ich. Umso dankbarer dürfen wir für den Mut der Autorin sein — und für den ihres Verlags, der sich das Risiko genau überlegt hat und einging.
Man könnte glauben, so ein Buch sei bitter und pessimistisch. Doch es gibt noch eine ganz andere Ebene darin. Nicoles Herz schlägt kräftig für die indigene Kosmovision der lateinamerikanischen Ureinwohner und für die Magie des Regenwaldes, in dem sie bereits mehrere Jahre gelebt hat. Mit diesem Herz stellt sie auch die Frage, was denn wohl in einem Menschen wie Dennis Melka vorgehen mag:
„Ob er es schafft, jegliche Gedanken an Umwelt- und Menschenrechte auszuschalten und sich über seinen geschäftlichen Erfolg, sein ständig wachsendes Firmenimperium und seine prall gefüllten Bankkonten zu freuen?“
Wenn ja, dann vielleicht nicht für immer.
„Am Ende ist die Natur doch stärker. Geschäftsleute wie Dennis Melka denken zwar, dass sie unbescholten davonkommen, wenn sie die Ressourcen plündern. Dass sich der Regenwald nicht wehren kann, wenn sie mit ihren Motorsägen kommen, jahrhundertealte Baumwesen töten, Pflanzen aus dem Boden reissen und die Vegetation niederstampfen. Doch ich bin überzeugt: Sie täuschen sich. Denn der Urwald hat eine ganz eigene Dynamik, eine ganz eigene Macht. Er ist eine weitgehend unerforschte, fast magische Sphäre, in deren Innerem sich Mysterien verbergen, die wir nur erahnen können.“
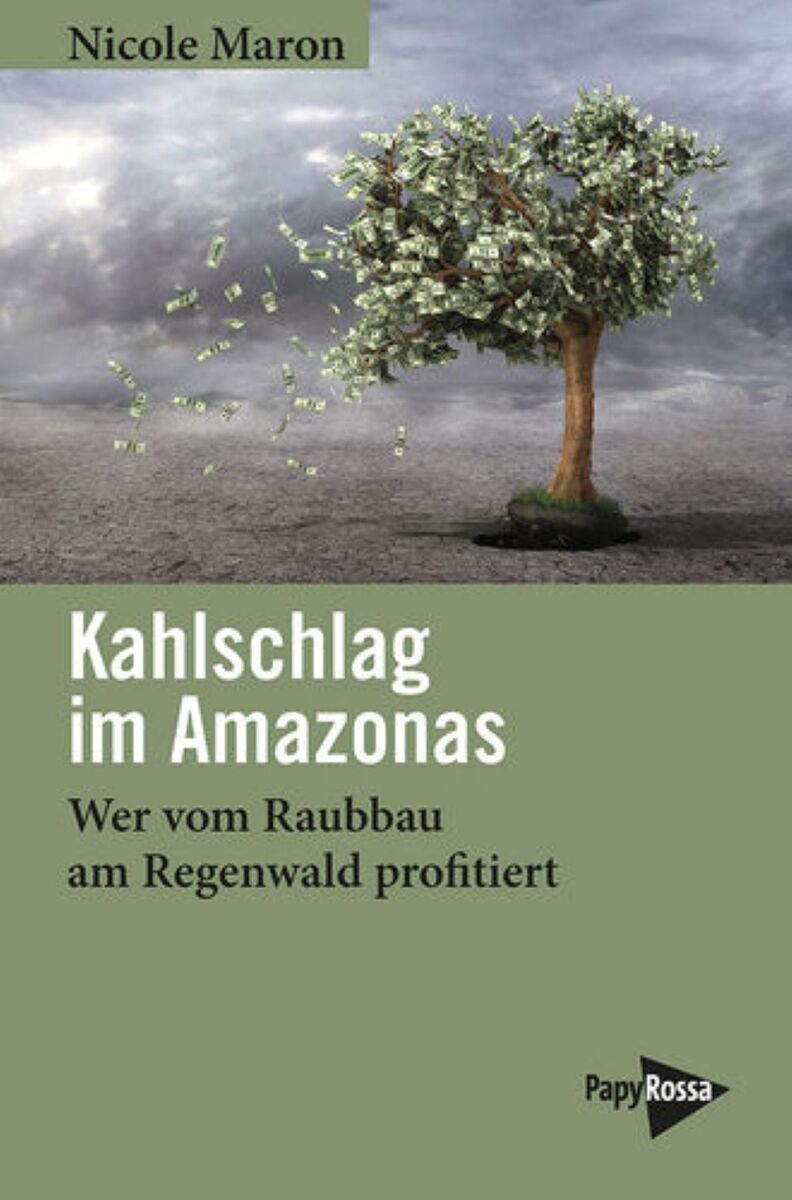
Hier können Sie das Buch bestellen: PapyRossa Verlag
Lesereise von Nicole Maron im Mai 2025
- Mai, 18 Uhr: Christstraße 9, Bochum
- Mai, 18 Uhr: Düsternstraße 10, Hamburg
- Mai, 18 Uhr: Schumannstraße 10, Berlin
- Mai, 18 Uhr: Eugensplatz 5, Stuttgart
- Mai, 18 Uhr: Belfortstraße 52, Freiburg i. B.
- Mai, 18 Uhr: Bruderstraße 5a, München
- Juni, 17:30 Uhr: Seebacherstrasse 3, Zürich