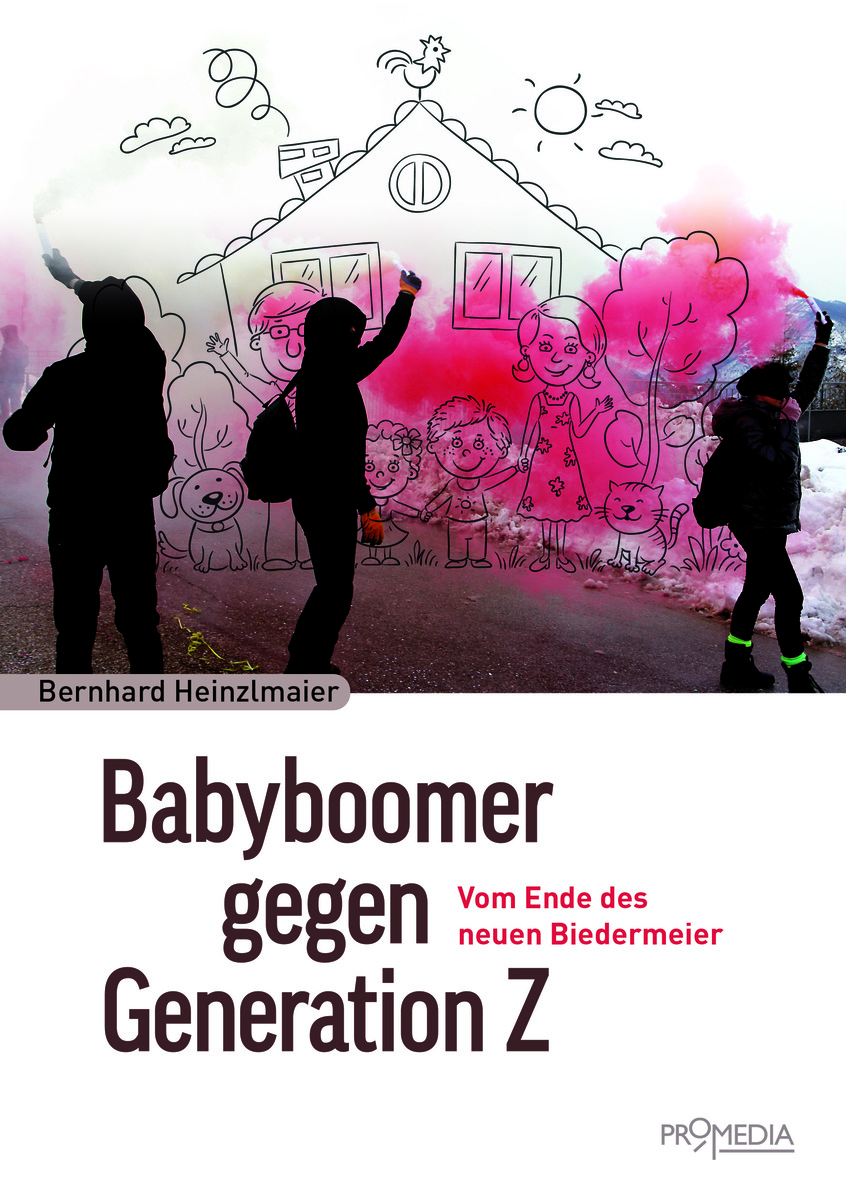Generation Zerbrechlich
Am Bildschirm festgewachsen, von der Realität abgeschottet: Jüngere Menschen muss man oft wie rohe Eier behandeln. Exklusivauszug aus „Babyboomer gegen Generation Z“.
Fragil, fahrig und immer auf dem Sprung, ihren Gesprächspartnern Rassismus, Sexismus oder irgendeinen anderen „Ismus“ um die Ohren zu hauen — so erleben Ältere oft die Angehörigen der sogenannten Generation Z. Von einem Überangebot an Zerstreuungsmöglichkeiten gelangweilt, suchen sie nach immer noch mehr kurzfristig wirksamen Reizen, welche sie aber letztlich innerlich leer zurücklassen. Die viele „Bildschirmarbeit“, ergänzt durch verwöhnende Eltern, hat viele in dieser Altersgruppe zu Fremden werden lassen in einer Realität, die sie nicht verstehen und von der sie sich oft überfordert fühlen. Dazu kommt eine Art politische Überempfindlichkeit, die Neigung, sich als Opfer zu fühlen. Der Umgang mit „woken“ Jugendlichen gleicht oft einem Eiertanz, mit dem Ziel, das Beleidigtsein des Gesprächspartners zu vermeiden und die zahlreichen herumstehenden weltanschaulichen Fettnäpfchen zu umschiffen. Das alles sind Verallgemeinerungen — gewiss. Der Autor packt sie aber in unterhaltsame und durchaus erhellende Prosa. In einem weiteren Buchkapitel bekommen in den nächsten Tagen auch die in ihrem Vergreisungsprozess weiter fortgeschrittenen „Babyboomer“ ihr Fett weg.
Insbesondere die Jüngeren scheinen in einer Art kollektiven ADHS-Symptomatik gefangen. Sie sind auf ständige Reizstimulation angewiesen, um nicht in Langeweile oder gar in Depressionen zu versinken. Die Angst vor der lähmenden Tristesse ist der Grund für ihre Nervosität, die sie niemals still sitzen lässt. Wenn sie sich nicht durch nervöses Herumflippen ablenken können, muss sich etwas emotional Bewegendes auf einem der vielen Bildschirme ereignen, von denen sie immerfort umgeben sind.
Überhaupt scheint es der „Horror vacui“, die panische Angst vor der Leere zu sein, der die Menschen dazu treibt, nahezu ohne Unterbrechung aktiv zu sein. Erich Fromm meint in seinem Buch „Die Furcht vor der Freiheit“, Arbeit und Erfolg als Hauptziele des Lebens übten eine so große Anziehungskraft auf die Menschen aus, weil sie Angst vor der Einsamkeit und der kritischen Selbstreflexion in Zeiten der Ruhe und der Ereignislosigkeit hätten. Lieber hält man sich in Betriebsamkeit, als in einer Entspannungsphase in quälende Sinnfragen zu stürzen.
Noch nie existierte eine Generation, die sich so schnell, weil ständig überstimuliert, gelangweilt hat, und noch nie war die Konzentrationsfähigkeit einer Altersgruppe so unterentwickelt wie die der heute die Schulen und Universitäten bevölkernden Generationen Z und Alpha.
Als Alphamenschen werden die nach 2010 Geborenen bezeichnet, die neu aufkommende Alterskohorte, die die Generation Z als die emblematische kulturelle Repräsentation der Jugend demnächst ablösen wird. Ein hervorstechendes Merkmal der Generation Z und ein weiteres Beispiel für den gravierenden Gegensatz zwischen den Alten und den Jungen ist deren ausgeprägte Fragilität und deren theatralische Opfermentalität.
Noch keine Generation hat sich dermaßen verfolgt und ungerecht behandelt gefühlt. Ein scharfes Wort genügt, und schon erfolgt ein oft inszeniert erscheinender Zusammenbruch und die Vorhaltung mangelnder Achtsamkeit an den Kommunikationspartner. Die gesamte Gesellschaft wird als Hort des Bösen und der Destruktion empfunden. Überall lauern Verwerfungen und Defekte. Und diese identifizieren die Jüngeren als genuinen Bestandteil der gesellschaftlichen Strukturen.
Rassismus gilt nicht mehr als negative Eigenschaft konkreter Individuen, sondern er ist strukturell, das heißt Behörden, dem Schulsystem, den Universitäten und dem ganzen politischen System eingeschrieben. Das Böse lauert also nicht mehr im Individuum, es hat sich quasi von diesem gelöst und ist nun in jedes Gesetz, jede mediale Berichterstattung und jede Institution, so als wäre es gasförmig, auf geheimnisvolle Weise eingedrungen.
Würde ein rechter Politiker so einen Humbug von sich geben, er würde als Verschwörungstheoretiker etikettiert und aus der Gemeinschaft der Rechtschaffenen ausgeschlossen. Wenn jedoch die woke Community empirisch absolut nicht begründbare Behauptungen aufstellt, werden sie zur unumstößlichen Wahrheit stilisiert, an die keiner zu rühren wagt. Die Mikroaggressionen, von denen die woke Community immer wieder spricht, sind ebenso wie die bis an die Grenzen des Nichts verdünnten Wirkstoffe der Homöopathie noch nie nachgewiesen worden. Dennoch seien sie wirksam. Wäre die woke Bewegung nicht an den Universitäten hoch angesehen und anerkannt, würde man sie eine obskurante Verschwörungsbewegung nennen. Doch wer wagt es schon, gegen die Wissenschaft, die sich heute als unhintergehbare Wahrheitsinstanz inszeniert, aufzubegehren ?
Jonathan Haidt über die Gefahren der sozialen Medien
Wenn junge Menschen ihre sozialen Beziehungen in die virtuelle Welt verlagern, werden diese Beziehungen entkörperlicht, asynchron und manchmal austauschbar. In der virtuellen Welt, wo Content ewig weiterlebt und für alle sichtbar ist, können selbst kleine Fehler große Kosten verursachen. Unter Umständen werden Fehler von zahlreichen Personen scharf kritisiert, zu denen man gar keine grundlegende Beziehung aufweist. Auf Entschuldigungen reagiert man oft mit Spott, und jedes Signal von Akzeptanz oder Versöhnung ist möglicherweise gemischt oder vage.
Statt Erfahrungen bei der Bewältigung sozialer Probleme zu sammeln, bleibt ein Kind oft mit dem Gefühl zurück, sozial inkompetent zu sein, an Status verloren zu haben und weitere soziale Kontakte fürchten zu müssen. Daher ist es kein Widerspruch, wenn ich sage, Eltern sollten ihre Kinder in der realen Welt weniger überwachen, in der virtuellen Welt jedoch mehr – indem sie das Eintauchen in diese verzögern. Die Kindheit entwickelt sich auf der Erde, und die kindliche Antifragilität ist abgestimmt auf irdische Verhältnisse.
Die woke Ideologie, mit der wir alle seit 20 Jahren geradezu drangsaliert werden, ist die Weltanschauung der Generation Z und sie spiegelt die Infantilität von verweichlichten Kindern wider, die von ihren Helikopter-Eltern verhätschelt und von der Realität des Lebens abgeschottet wurden, sodass sie nicht die nötige „Antifragilität“ entwickelten, um in der Welt der Erwachsenen zu bestehen.
Woher kommt nun diese Fragilität und die fehlende Resilienz der Generation Z ? Eine ernst zu nehmende Antwort auf diese Frage gibt der amerikanische Psychologe Jonathan Haidt in seinem Buch „Generation Angst. Wie wir unsere Kinder an die virtuelle Welt verlieren und ihre psychische Gesundheit aufs Spiel setzen“. Nach Haidt besteht das Grundübel der Kindererziehung unserer Zeit darin, dass Kinder von ihren Helikopter-Eltern manisch vor den Gefahren der gesellschaftlichen Realität geschützt werden, sich hingegen in der toxischen Welt der digitalen Plattformen völlig unkontrolliert bewegen dürfen. Dort lauern Bedrohungen auf sie, die ihre Gehirne irreversibel schädigen können.
Haidt spricht sogar von einer „Neuverdrahtung“ der Gehirne, die durch übermäßigen Konsum von sozialen Medien entsteht. Diese Neuverdrahtung bewirkt, dass eine ganze Generation durch ein smartphonebasiertes Freizeitverhalten zu Risiko-Vermeidern umerzogen und in eine damit im Zusammenhang stehende ständige Verteidigungshaltung gedrängt wird. Im Gegensatz dazu wäre, so Jonathan Haidt, die spielebasierte Freizeit der natürliche Weg, um bei Jugendlichen die Lust auf die Entdeckung von Unbekannten und auf neue Erfahrungen zu wecken. Doch die spielebasierte Freizeit wird von den digitalen Medien gnadenlos verdrängt. Kinder und Jugendliche verbringen heute täglich mehrere Stunden vor Bildschirmen, lassen sich passiv unterhalten, anstatt aktiv zu handeln und so wertvolle Erfahrungen zu sammeln.
Am Ende entsteht ein Menschentypus, der sich hinter Bildschirmen versteckt, weil er Angst vor den medial unvermittelten Begegnungen des wirklichen Lebens hat, das Bestehende jeder Veränderung vorzieht und in eine ständige Abwehrhaltung gegenüber ungeschützten und damit riskanten Handlungsweisen verfällt.
Die durch übermäßigen Konsum digitaler Medien ausgelöste Umbildung der Gehirne bewirkt, dass junge Menschen zu wahren „Angstwesen“ werden. Um Verletzungen zu vermeiden, stellen sie das sonst für Jugendliche typische explorative Verhalten ein und schließen sich ängstlich von der gesellschaftlichen Realität ab. Bevor man sich die Abfuhr von einem wirklichen Menschen abholt, flüchtet man lieber in virtuelle Liebesgeschichten, die auf Netflix und anderen Streaming-Diensten rund um die Uhr laufen. Zu diesem psychopathologischen Kontext gehört auch der überbordende Wunsch der Generation Z nach sogenannten „Safe Spaces“. Ein Safe Space ist nichts anderes als ein Ort, von dem Personengruppen ausgeschlossen sind, die sich nicht konform den Gesetzen der Wokeness verhalten oder interne Diskurse durch kritische Gegenpositionen stören könnten.
Während frühere Generationen, beispielsweise die 1968er-Bewegung, die Anti-Atombewegung, die Friedensbewegung oder gar die Protestbewegung gegen den Opernball, die Konfrontation mit der erstarrten Erwachsenenwelt suchten, flieht man vor Gegensätzen, Widersprüchen und Konfrontationen. So wie sich das Kleinkind hinter Mutter oder Vater vor den Bedrohlichkeiten der Welt versteckt, verbergen sich die Woken hinter einem Dickicht von Konventionen und restriktiven gesetzlichen Regelungen, die der Politik abgerungen wurden.
Hier können Sie das Buch bestellen: „Babyboomer gegen Generation Z: Vom Ende des neuen Biedermeier“