Rausch am Rande des Niedergangs
In der „Spätlese“ von Egon W. Kreutzer wird die Welt zur Kenntlichkeit montiert.
Egon W. Kreutzer hat über Jahre eigene Denkpfade eingeschlagen. In gewissem Sinne war er einer der ersten deutschen Dissidenten mit einem eigenen Blog. Und er ist stets für sich geblieben, hat sich nirgendwo einbinden lassen, auch nicht in die Dissidenz. Nun hat er mit „Spätlese“ ein Buch geschrieben, in dem er weder die Welt noch die deutschen Zustände noch sich selbst schont. Auch nicht den Leser, der für diese schonungslose Lektüre mit einem wunderbar literarischen Text belohnt wird. Daniel Sandmann hat ihn schon zweimal gelesen.
„Als er die scharfe Linie der fernen Hügel erkannte, die seinem Blick die Sicht auf alles Dahinterliegende verwehrten, wusste er nicht mehr zu sagen, ob er das, was er jetzt sah, in diesem Augenblick sah, oder ob er nur visuell erinnerte, was er einmal gesehen hatte.“
Werfen Sie in einem großen Raum, einem Kirchenschiff meinetwegen, Ihren Blick an Wände und Decken, so ändert sich die Projektionsfläche naturgemäß, indem Sie sich in diesem Raum verschieben. Und es gibt die Räume, die sind so konstruiert, dass Sie den Raum immer anders erfahren. Sie sehen andere Räume. Das Buch „Die Spätlese“ von Egon W. Kreutzer ist ein solcher Raum. Lesen Sie es zweimal, haben sie zwei Bücher gelesen. Zehn Lektüren, zehn verschiedene Bücher.
„Du sollst nicht lesen. Lesen schadet der Dummheit. (...) Überhaupt ist dieses Buch voll mit Gedanken, auch wenn es so aussieht, als sei es nur voll mit Buchstaben oder Druckerschwärze.“
Ich werde in dieser Rezension nicht erklären können, was dieses Buch „ist“. Eine Etikettierung ist nicht möglich. Allein schon deshalb fällt es aus dem System. An eine Zusammenfassung ist nicht zu denken, die KI, die mit etwelchen Größen aus der Dissidenz souverän schwafelt, diese bestätigt und am Ende vereinnahmt, wird hier als Leser versagen. Bestimmt ist es kein Corona-Buch, das Wort kommt kein einziges Mal vor.
„Es war an der Zeit, als die getöteten Wörter wie Laub von den Bäumen fielen, so dass man durch die Reste der Sätze hindurch stets direkt in den reinen, klarblauen Himmel blicken konnte. (...) Und da war niemand mehr, der noch um sie hätte trauern können.“
Es wird keine Ideologie und kein Modell gezeichnet. Es wird keine Optimierung, sei sie finanzieller oder spiritueller Art, verkauft und die Geschichten, die es darin gibt, gehen nicht zu Ende. Denn das Ende dieses Buches ist der Anfang. Und dass Zeit eine Illusion ist, steht bereits auf dem Buchdeckel.
„Achte nur auf das, was unauslöschlich ewig ist.“ Und unauslöschlich ewig ist nur der Augenblick, in dem zu verweilen Faust wie nichts sonst fürchtet. Und weil bei der Lektüre der Augenblick im Text liegt, ist alles auf das Textjetzt fokussiert. Ganz und gar und vollumfänglich. Das fordert und bereichert.
„Wo hört der Körper auf, ein Mensch zu sein — wo fängt der Mensch an, Körper zu sein? Wo fängt der Mensch überhaupt an?“
Was treffen Sie in diesen Text-Augenblicken an? Sie treffen auf Gedachtes, ja, unentwegt, aber als sinnliches Ereignis. Sie treffen auf Gedanken als Sprengstoff. Und es wird am Ende und also am Anfang des Buches gewarnt: „Die nächste Seite unbedingt überschlagen.“ (...) „Diese Seite nicht lesen!“ Über Recht und Gerechtigkeit wird nicht doziert, es werden stattdessen Geschichten erzählt, Szenen. Und wenn Jürgen Elsässer im Bademantel in der Bäckerei auftaucht, dann ist das kein Storytelling. Vielmehr überführt Kreutzer den Zustand der deutschen Justiz spielerisch in ein Bild, das gerade auch in seiner grotesken Komik den zivilisatorischen Niedergang zeichnet. Die „Kraft“ der Narrative („Wir schaffen das“ qua Schlachtruf eines „inversiven Humanismus“) wird geradezu morbid — und natürlich gefährlich — mit einer aus allen Rudern gelaufenen „Katzenkolonie“ eingefangen, der Verlust von Ethik und Gewissen als gänzlich „natürlicher“ Prozess mit einer Episode vorgeführt, in der eine Frau einfach mal so ermordet wird und sich der Mörder daraufhin wieder mit seinen Turnschuhen befasst.
„Wenn die Vernunft das Ende ihrer Fahnenstange erreicht hat, kann sie dort nicht einfach verweilen. Es gibt dort keine komfortable Sitzgelegenheit und keinen Partyservice.“
Kreutzer destilliert das „Menschenmögliche“ aus verschiedenen Versuchsanlagen heraus, indem er menschliches Handeln um verschiedene „Pole“ der Kultur- und insbesondere der biblischen Geschichte wickelt. Im Dunstkreis von Topoi wie „Ich wasche meine Hände in Unschuld“ und „Kreuziget ihn!“ wird eine Zivilisation deutlich, die jede Verantwortung, ja selbst den Begriff dafür, verloren hat.
Plastisch wird das mit dem Rausschmiss einer störenden Frau aus einer „Volkspartei“, sei es die SPD, seien es die Grünen, und mit einer nächtlichen Szene aus dem Bundestag aufgezeigt, eine Szene, die in ihrer automatisiert-monströsen Sinnleere als Sinnbild für „unsere Demokratie“ fungiert.
„In den Höhenlagen, auf dem schmalen Streifen zwischen Baumgrenze und ewigem Eis, wo sich die Ideen Platons noch in Reinform erhalten hatten...“
Die Kernschicht, in der die Thematik des rationalen Denkens — und dessen Verlust als Ausdruck des „Niedergangs“ — wie ebenso die gegen diesen Niedergang gestellte Suche nach Wahrheit und Sinn verhandelt wird, besteht indes aus biografischen Splittern — sie mögen auch autobiografisch sein —, die sich phasenweise zu Zeitbildern aus der Vorkriegs- und Nachkriegsgesellschaft verschränken. Die Abhängigkeit von Geschichte — und Geschichten — von der Perspektive des Erzählers wird hierbei ganz besonders und äußerst köstlich vorgeführt.
„Da kam ich also her. Stammte von einem Wirt, einer früh verstorbenen Malermeisterstochter, einer Schneidertochter und einem kriegsversehrten 20er-Jahre-Glücksritter ab...“
„Einspruch, Einspruch, Einspruch.“
„Oh Shit! Hätte ich vielleicht früher erwähnen sollen. Wissen Sie, die Figur am Küchentisch, also ich vorher, das war ein Neger. (...) Die Hautfarbe ist mir beim Umschreiben geblieben. Irgendwie hat er Gefallen daran gefunden, einen Neger im Manuskript zu haben.“
Die „Wahrheit“ auch und gerade dieses Buches entsteht im Disput verschiedener Figuren, namentlich des Erzählers und der Ich-Figur, deren Biografie erzählt wird. Dieser Widerstreit zwischen Er- und Ich-Figur, zwischen Autor und Figur, aber auch zwischen Autor und Lektor spiegelt nicht nur psychologische Konflikte, sondern auch Machtverhältnisse, von denen auch dieses Buch explizit nicht verschont bleibt.
Dass Kreutzer über Macht nicht doziert, sondern sie als Spiel vorführt — eine wunderbare Geschichte aus dem Orient mit einem Märchenerzähler, der seine Geschichten der antizipierten Sicht des Kalifen anpasst, ist in diesem Zusammenhang als Destillat herauszustellen —, trägt wesentlich zur Qualität des Buches bei. Dass in diesen Machtverhältnissen teilweise eine Faust-Mephisto-Konstellation durchschimmert, gehört mit zur kulturgeschichtlichen Anlage dieses Buches. Wer setzt wen? Wer schreibt wen? Wer ist der wirkliche Autor? Wer konstruiert Wirklichkeit? Das sind die radikal-romantischen wie auch politisch eminent wichtigen Fragen, welche der Autor, wie gesagt, spielerisch aufwirft und für den Augenblick beantwortet, beispielsweise anhand einer Kaffee-trinkenden Ich-Figur, die nach einer politischen Wende — weg vom woken Zeitgeist — über Verlag, Lektor und Autor den Freiraum für andere Eigenschaften bekäme...
„Er hat seine Vorstellung davon, wie ich sein sollte.“
„Ich begann daran zu zweifeln, ob ich wirklich ICH sei, fragte mich, ob nicht vielleicht sogar er mein wirkliches ICH sei.“
„Dann fügte ich mich. Warum? Weil ich nicht als verkrüppelte Totgeburt in einem abgebrochenen Manuskript enden will.“
Wer Texte aus dem letzten Jahrhundert kennt, mag versucht sein, in Kreutzers „Spätlese“ zuweilen Parallelen mit Spielarten der Literatur aus den 1960ern und 1970ern zu erkennen. Auch das Fragmentarische der Romantik ist anwesend. Vom „Geist“ her liegt darüber hinaus eine Nähe zu Hesse vor — nicht zuletzt, weil die Suche nach „Wahrheit“ an einigen Stellen tief ins Spirituelle führt, das sich zuweilen allerdings ebenso als Spielanlage der Macht erweist. Indes, am Ende ist es exakt dieses eine Buch und nichts weiter. Dass der Text sich selbst als Text hinterfragt, hat auch Auswirkungen auf die Struktur. Allein die Art und Weise, wie erzählt wird, ist eine schöne Zumutung und ein Ausrufezeichen gegen die auf Verkauf angelegte Banalität und Aalglattheit der meisten Literatur aus den letzten zwei Jahrzehnten.
„Was ist ein Selbstfindungsprozess anderes als ein Herumirren in einem Labyrinth ohne Ausgang?“
Ich komme zur Zusammenfassung für „Crash Test Dummies“: Die Bewegungen des Denkens an sich und verschiedener Perspektiven werden in den zusammenmontierten szenischen Miniaturen wunderhaft entfaltet. Immer wieder ergeben sich verschiedene Strukturprinzipien. So werden biografische Teile über das Schöpfungsprinzip aus der Bibel (Tag 1 bis 7 plus zwei Zusatztage) „abgewickelt“. Zum Ausdruck kommt sowohl über die Struktur des Buches wie auch über den Inhalt ein fundamentales Interesse daran herauszufinden, was dem Menschen schlechthin, vor allem aber dem Menschen dieser Zeit möglich ist. Wo seine Begrenzungen liegen, seine toten Felder und sein vielleicht noch vorhandenes „Potential“ für Erkenntnis. Stilistisch gestaltet Kreutzer die verschiedenen Textarten so souverän, als hätte er zeit seines Lebens literarisch gearbeitet.
„Gelöscht wurde schon immer. Da unterscheidet sich die Bibel nicht von Facebook.“
Das Politischste an diesem Buch, das als Geistesfutter sehr zu empfehlen ist, ist keine ideologische Aussage, keine politische Position, es ist liegt im Lesen des Buches selbst begründet: Wer das liest, der nährt seinen Hippocampus, ob er will oder nicht. Einen politischeren Beitrag und ein besseres Mittel gegen Indoktrination und digitale Aushöhlung gibt es nicht.
„Die nächste Seite unbedingt überschlagen — sie enthält einen sehr, sehr gefährlichen Gedanken, vielleicht den gefährlichsten überhaupt auf der Welt.“
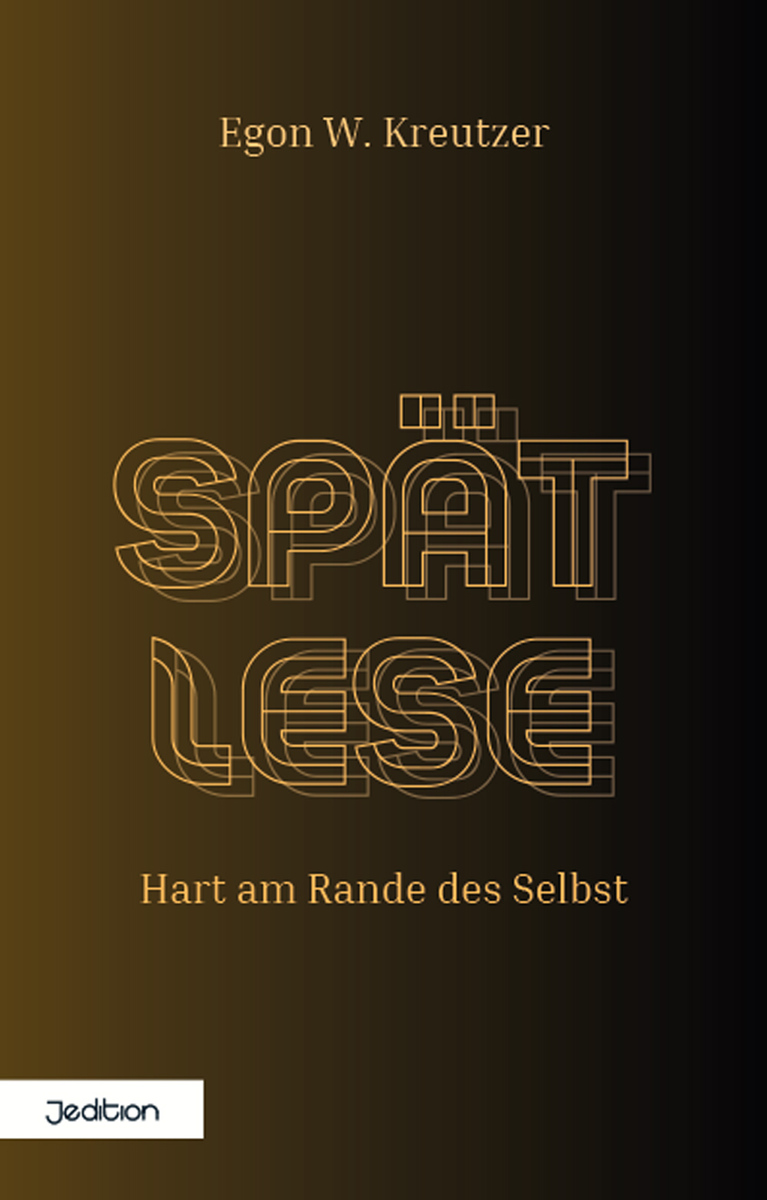
Hier können Sie das Buch bestellen: Massel Verlag