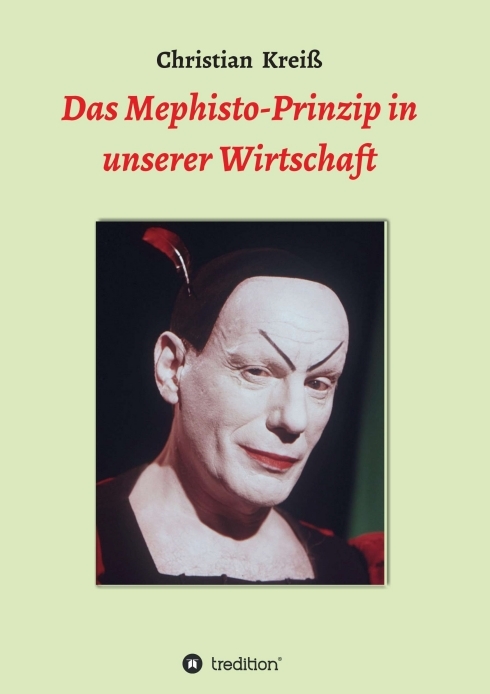Weltanschauung im Wissenschaftsgewand
Die Ökonomie an deutschen Hochschulen gründet auf unwissenschaftlichen Grundannahmen und propagiert Egoismus als oberste Maxime wirtschaftlichen Handelns.
Wer sich im akademischen Diskurs zu wirtschaftlichen Themen bewegt, dem kann der Eindruck aufdrängen, es handele sich bei der Ökonomie um eine von Moral befreite Zone. Wirtschaftliche Vernunft wird oft gleichgesetzt mit Gewinnmaximierung — die sich, so die verbreitete Annahme, ja ganz automatisch positiv auf das Gemeinwohl auswirkt. Wie willkürlich die Axiome sind, auf denen die Wirtschaftswissenschaften fußen, merkt man erst, wenn man sie einmal gründlich hinterfragt. Wer eine menschliche und nachhaltigere Wirtschaft anstrebt, muss den Mut aufbringen, scheinbar Selbstverständliches anzuzweifeln.
Die Wirtschaftswissenschaften treten heute, wie der Name schon sagt, als Wissenschaft auf. Das ist aber nicht korrekt. Denn praktisch alle heutigen wissenschaftlichen Analysen, Modelle, Aufsätze und Politik-Empfehlungen zu oder über Ökonomie im weitesten Sinne ruhen auf einer kleinen Anzahl weltanschaulicher Grundannahmen oder Axiome. Diese Grundannahmen selbst haben aber nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern sind rein weltanschauliche, man könnte auch sagen religiöse oder irreligiöse Annahmen. Diese Annahmen und die daraus abgeleiteten politischen Maßnahmen sind meiner Einschätzung nach nicht nur falsch, sondern sehr schädlich für unsere Gesellschaft und unser Miteinander (1). Abgesehen davon, dass diese Axiome asozial und verderblich sind, führen sie dazu, dass diejenigen jungen Menschen, die Wirtschaftswissenschaften studieren, keine Chance mehr haben, sich unabhängig, frei und tolerant über Wirtschaftsabläufe zu informieren. Denn es wird in den Wirtschaftswissenschaften de facto ausschließlich auf dem Boden dieser Grundannahmen diskutiert, unterrichtet und geforscht.
Wer also aktuell in Deutschland Wirtschaft studiert, begibt sich daher, im Normalfall ohne es zu wissen und ohne es zu merken, in ein hermetisch abgeschlossenes Dogmen-Netz, in dem er gefangen wird und vergeblich zappelt, um wieder herauszukommen. Das alles geschieht sehr subtil und hochintelligent. Denn alternative Meinungen, Analysen, Empfehlungen existieren in unserem Wissenschaftssystem der Ökonomie de facto nicht mehr, und zwar praktisch ohne, dass es jemand innerhalb der Fakultäten oder in der breiten Öffentlichkeit wirklich merkt.
Die allermeisten Hochschul-Ökonomen werden sagen: Ich darf doch denken und sagen und unterrichten, was ich will, wir haben doch Wissenschaftsfreiheit. Das stimmt auch. Aber nur für diejenigen, die es ins System hineingeschafft haben, die sich den Grundannahmen im Vorfeld unterworfen haben.
Nicht jedoch für diejenigen, die alternative Meinungen vertreten, die die Axiome kritisieren oder ihnen widersprechen.
Wirklich alternative Meinungen, grundlegend alternative Ansätze existieren in der heute herrschenden Mainstream-Ökonomie nicht mehr. Sie werden sie auch praktisch nicht mehr diskutiert, sondern schlichtweg ignoriert. Das alles geschieht ganz subtil und leise. Daher erfahren die Ökonomie-Studenten auch gar nichts mehr darüber, dass man Ökonomie auch ganz anders, menschlicher, denken und analysieren könnte, statt so, wie die jungen Leute es heute unterrichtet bekommen, nämlich stark auf Egoismus bauend, Egoismus propagierend, in den Egoismus treibend – und damit unsere Gesellschaft und die Welt langfristig ruinierend.
Ich möchte in keiner Weise Ökonomie-Kolleginnen oder Kollegen einen persönlichen Vorwurf machen, das liegt mir ganz fern. Die allermeisten Kolleginnen und Kollegen sind sympathisch und angenehm und wie jeder andere Mensch auch – einfach von ihrer Weltanschauung überzeugt – sonst hätten sie diese ja nicht. Aber, worüber die meisten Menschen nicht nachdenken: Auch sie sind in gewissem Sinne Opfer des Systems.
Es geht mir ausschließlich um Systemfragen: Warum unser Wirtschafts-Wissenschaftssystem, besser: -Glaubenssystem so gut, so effizient, so subtil und so brillant intelligent funktioniert im Ausschließen anderer, alternativer, unliebsamer Meinungen, Ansätze und Modelle, nicht um irgendwelche persönlichen Vorwürfe an Ökonomen.
Die sieben Weltanschauungs-Annahmen der heutigen Wirtschaftswissenschaften
Direkt oder indirekt baut unsere gesamtes Wirtschafts-Wissenschaftssystem auf folgenden etwa sieben Grundannahmen oder Axiomen auf:
- Zinseszins ist gut, richtig und wichtig,
- Eigentum in beliebiger Höhe ist wichtig und richtig (property rights-Theorie),
- Unternehmen müssen ihre Gewinne maximieren,
- Konkurrenz und Wettbewerb sind wichtig und gut,
- Unersättlichkeit (Gier),
- Konsumenten folgen dem Modell des homo oeconomicus, sind rational und maximieren ihren Nutzen (Utilitarismus),
- Die unsichtbare Hand des Marktes sorgt dafür, dass das egoistische Verhalten der einzelnen * Marktteilnehmer (Haushalte und Unternehmen) in das Wohl der Allgemeinheit überführt wird.
Wissenschaft oder Weltanschauung?
Dass es sich bei diesen sieben Grundannahmen oder Glaubensüberzeugungen nicht um Wissenschaft, sondern um Weltanschauung handelt, kann man sich leicht verdeutlichen:
Statt Unersättlichkeit beziehungsweise Gier könnte man beispielsweise als Leitmotiv über die Volkswirtschafts-Lehrbücher den bekannten Satz von Gandhi schreiben:
„Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier“. (2)
Oder Aussagen von Lao Tse: „Es gibt keine größere Sünde als viele Wünsche, es gibt kein größeres Übel als kein Genüge kennen, es gibt keinen größeren Fehler als haben wollen.“ (3)
Oder man könnte auch Martin Luther zitieren:
„Es ist mancher, der meint, er habe Gott und alles genug, wenn er Geld und Gut hat, verlässt und brüstet sich darauf so steif und sicher, dass er auf niemand etwas gibt. Siehe, dieser hat auch einen Gott, der heißt Mammon, das ist Geld und Gut, darauf er all sein Herz setzt, welches auch der allergewöhnlichste Abgott ist auf Erden.“ (4)
Wären dies die Leitmotive unserer Ökonomie-Modelle, dann würden völlig andere Ergebnisse und völlig andere Politik-Empfehlungen herauskommen.
Statt Konkurrenz und Wettbewerb könnte man auch Kooperation betonen, wie es Christian Felber sehr überzeugend tut (5). Statt unlimitierter Eigentumsanhäufung könnte man eine Obergrenze für Eigentum einführen. Christian Felber schlägt 10 Millionen Euro vor (6).
Statt Gewinnmaximierung für private Aktionäre könnte man Genossenschaftsmodelle und gemeinwohlorientierte Stiftungen als Geschäftsmodell für Unternehmen vorschlagen. (7) Oder einfach, wie es Anfang der 1980er Jahre noch üblich war, als ich Ökonomie studiert habe: Dass der Zweck von Unternehmen ist, einfach gute Produkte und Dienstleistungen zu erbringen und nicht die Gewinne zu maximieren.
Statt Zinseszins könnte man die Gedanken von Silvio Gesell unterrichten, dass Geld keinen Zinsertrag bringen darf, sondern sich im Wert systematisch verringert, also Freigeld beziehungsweise Schwundgeld statt unser heutiges Fiat-Geld. (8) Oder man könnte die buddhistisch inspirierten Geldmodell-Gedanken von Karl-Heinz Brodbeck (9) diskutieren, der zugleich starker Kritiker der weltanschaulichen Grundlagen unserer Wirtschaftswissenschaften ist, wie beispielsweise der Titel eines seiner Bücher zeigt: „Die fragwürdigen Grundlagen der Ökonomie. Eine philosophische Kritik der Wirtschaftswissenschaften.“ (10) Statt Nutzenmaximierung und Utilitarismus, wie sie vor allem der Nobelpreisträger für Ökonomie Gary Becker propagiert, könnte man Rücksichtnahme, Mitleid und Menschlichkeit propagieren.
Kurz: Man könnte zu allen obigen Axiomen im Grunde genommen auch ziemlich genau das Gegenteil annehmen. Denn es handelt sich hier nicht um Wissenschaft, sondern um Weltanschauung, um religiöse oder irreligiöse Grundüberzeugungen.
Bei Verstoß gegen die sieben Axiome keine Wissenschaftskarriere
Niemand bekommt in Deutschland – und meiner Einschätzung nach in den allermeisten anderen westlichen Industrieländern – normalerweise eine Professur der Ökonomie, wenn er auch nur gegen eines der Axiome verstößt, geschweige denn, wenn er gleich mehrere in Frage stellt. Das heißt, auf unseren Ökonomie-Lehrstühlen landen praktisch ausnahmslos Menschen, die auf die obigen sieben Axiome ausgerichtet sind. Wer anders denkt, bekommt keine Promotion und erst recht keine Habilitation, ja im Regelfall nicht einmal eine Bachelor- oder Masterarbeit. Das heißt nicht, dass die heutigen Lehrstuhl-Inhaber unsympathische oder gar unintegre Menschen wären, im Gegenteil. Die allermeisten Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, sind von ihren Theorien und Erklärungen überzeugt und glauben, damit den jungen Menschen Gutes und wichtiges Wissen zu unterrichten.
Wie in den Wirtschaftswissenschaften Egoismus propagiert wird
Leider besteht aber de facto der Ökonomie-Unterricht direkt oder indirekt sehr stark im Propagieren von Egoismus. Das zeigen auch diverse Untersuchungen. (11) Von einem der bis heute wichtigsten und einflussreichsten Begründer der neueren Ökonomie, dem Nobelpreisträger Milton Friedman, wird gutes, soziales Verhalten von Managern geradezu verteufelt: Unternehmenslenker, die nicht der Gewinnmaximierung, sondern einem sozialen Gewissen folgen, für Langzeitarbeitslose Beschäftigung schaffen, Diskriminierung verringern, Umweltverschmutzung vermeiden, missbrauchen ihre Macht, seien Heuchler, die anderer Leute Geld – nämlich das der Aktionäre – verschleudern, Betrüger, missachten die Demokratie und untergraben die Grundlagen einer freien Gesellschaft. (12) Kurz: Manager, die Gutes tun, die das Allgemeinwohl fördern wollen, statt die Gewinne für die Aktionäre zu maximieren, sind böse. Milton Friedman hat heute unter Ökonomen interessanterweise immer noch einen guten Ruf.
Also: Wer Soziales, Verantwortungsvolles, Gutes will, schafft Schlimmes oder Böses und diejenigen am Marktgeschehen beteiligten Akteure, die ausschließlich ihre egoistischen Eigeninteressen verfolgen, fördern gerade dadurch die soziale Wohlfahrt, obwohl sie das gar nicht beabsichtigt haben. Dieser Schlüsselgedanke ist wirklich grandios in seiner Verdrehungskunst. Dadurch wird aller Egoismus in Altruismus überführt. Dadurch wird aller Egoismus im Wirtschaftsleben legitimiert. Dadurch kann jeder ruhig guten Gewissens Egoismus predigen. Konsequent zu Ende gedacht folgt aus diesem menschheitsschädigenden Gedanken logisch zwingend: Ein Ökonom darf nicht nur, sondern muss geradezu Egoismus predigen und fördern.
Wirtschaftsethik heute
Im führenden deutschen Lehrbuch zur Wirtschaftsethik wird konsequenterweise genau dieser Schluss gezogen. Christoph Lütge und Matthias Uhl scheuen sich in ihrem 2018 erschienen Buch „Wirtschaftsethik“ nicht, das Hohelied auf den Eigennutz zu singen:
„Man kann das Eigeninteresse – innerhalb der geeigneten Rahmenordnung – gewissermaßen als eine „moderne Form der Nächstenliebe“ begreifen (…). Es gilt also nicht mehr der traditionelle Gegensatz zwischen gutem, altruistischen Verhalten und schlechtem Egoismus.“ (13)
Es lohnt sich, auf diese Aussagen genauer einzugehen. Eigeninteresse ist eine moderne Form der Nächstenliebe. Das Wort „Nächstenliebe“ ist eine Anspielung auf das Neue Testament, die Autoren sagen dadurch gewissermaßen: Jesus würde heute Eigenliebe predigen statt Nächstenliebe. Damit sind wir am moralischen Kern angelangt. Das Neue Testament wird in einer seiner Kernaussagen ins Gegenteil gewendet. Das Christentum wird in sein Gegenteil verkehrt. Das gilt aber nicht nur für das Christentum. Auch praktisch alle anderen Religionen bauen auf der Überwindung des Egoismus auf, insbesondere Buddhismus und Islam, aber auch Judentum oder Schamanismus.
Die zentralen Aussagen der modernen Ökonomie sind also in ihrem Kern nicht nur antireligiös, sondern religionszerstörend. Denn wenn die Kerntugenden der Religionen zerstört werden, ist das ein Frontalangriff auf die Religion schlechthin. Das zeigt gerade auch der andere Schlüsselsatz im Buch „Wirtschaftsethik“: „Es gilt also nicht mehr der traditionelle Gegensatz zwischen gutem, altruistischen Verhalten und schlechtem Egoismus.“ (14)
Ein Kerngedanke praktisch aller Religionen ist die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, wobei fast immer Altruismus mit Gutem, Egoismus mit Bösem verbunden ist. Die Aufhebung dieses Gegensatzes bedeutet die Aufhebung und Verdrehung jeglicher Ethik und Moral in ihr Gegenteil.
Das gilt aber nicht nur für die beiden Wirtschaftsethiker oder Philosophen Lütge und Uhl. Sie ziehen lediglich ehrlich die logische Konsequenz aus dem ökonomischen Lehrgebäude. Der lange Zeit wohl bekannteste deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn sagte ganz Ähnliches:
„Die Wirtschaft ist keine ethische Veranstaltung. Wer sich ihr mit moralischen Ansprüchen nähert, hat die Funktionsweise der Marktwirtschaft nicht verstanden.“ (15)
Was Sinn nicht bedenkt: Auch er selbst steht auf einem weltanschaulichen Boden, indem er die sieben Grundaxiome voraussetzt.
Diese wenigen Beispiele zeigen, dass die Grundlagen unserer heutigen Wirtschaftswissenschaften tief in religiöses, ethisches Gebiet führen, die nichts mit Wissenschaft zu tun haben. Diese weltanschaulichen oder religiösen, besser: antireligiösen Grundlagen werden aber selten diskutiert und erst recht nicht ernsthaft in Frage gestellt. Und wer sie in Frage stellt, bekommt keinen Lehrstuhl für Ökonomie, ja nicht einmal einen Doktor in Ökonomie.
Das Lehrsystem der heutigen Ökonomie läuft, logisch konsequent zu Ende gedacht, darauf hinaus, was Lütge und Uhl ehrlich auf den Punkt bringen: Der Gegensatz zwischen gutem Altruismus und schlechtem Egoismus wird aufgehoben und soll aufgehoben werden. Ethik und Moral werden aufgehoben und sollen aufgehoben werden. Das heutige Ökonomie-Gedankensystem, das wohl an den meisten westlichen Hochschulen vertreten wird, ist in seinem Kern unethisch, unmoralisch, unmenschlich und führt meiner Einschätzung nach in die Zerstörung.
Derzeitige Gegenansätze der herkömmlichen Mainstream-Ökonomie kurieren nur an den Symptomen und laufen daher ins Leere.
Heute gibt es in den Wirtschaftswissenschaften eine zunehmende Fülle von Theorien und Studiengängen, die sich mit Nachhaltigkeit/Sustainability, Corporate Social Responsibility, ökologischem Verhalten, externen Effekten und so weiter auseinandersetzen. Das sind sehr sympathische Ansätze.
Allerdings werden sie meiner Einschätzung nach strukturell ins Leere laufen, so lange die zu Grunde liegenden Axiome nicht aufgehoben werden. Solange beispielsweise die Unternehmen zur Gewinnmaximierung gezwungen sind, dürften alle solche gut gemeinten Ansätze versagen. Es führt dann im Wesentlichen zu Greenwashing, das sich immer weiter verbreitet. (16)
Jeder Ökonom sollte den Mut haben, das wirkliche Übel zu benennen und zu eliminieren, die falschen, schädlichen Weltanschauungs-Grundannahmen. Gewinnmaximierung, Nutzenmaximierung, Zinseszins, unbeschränkte Vermögensanhäufung, Egoismus und Gier werden dafür sorgen, dass Nachhaltigkeit, Sustainability, CSR und so weiter zu Placebo-Maßnahmen degradiert werden, die zu Greenwashing, Heuchelei und Bürokratie führen statt zu einer menschlichen, umweltverträglichen Wirtschaftsweise, wie es viele junge Menschen ersehnen. Dadurch wird den jungen Studenten Sand in die Augen gestreut, statt ihnen die Wahrheit zu sagen. Viele junge Menschen spüren das auch.
Das Grundübel unseres Wissenschaftssystems: Der Staatszwang
Das Kernübel des geschilderten Systems, das dafür sorgt, dass die Axiome nicht angetastet werden können, ist der Staatszwang in unserem Hochschulwesen. Sowohl die Gründung neuer Hochschulen unterliegt sehr hohen staatlichen Auflagen, wie auch der laufende Betrieb: Bestehende Studiengänge müssen durch Staatszwang regelmäßig akkreditiert werden. Die Akkreditierungen erfolgen durch Professoren anderer, verwandter Studiengänge von anderen Hochschulen oder durch externe Akkreditierungs-Agenturen. Beide, sowohl die Kolleginnen und Kollegen wie die Agenturen, sind auf die sieben Grundaxiome ausgerichtet. Wer gegen eines oder gar mehrere der sieben Grundannahmen verstößt, wird nicht akkreditiert und kann damit nicht (mehr) unterrichten. Andersdenkende Studiengänge oder gar Hochschulen werden dadurch heute de facto staatlich verboten.
Das prägt auch die führenden westlichen Ökonomie-Wissenschafts-Journale. Auch hier sind die prüfenden „Reviewer“, die Ökonomen, die entscheiden, ob ein Artikel veröffentlicht wird oder nicht, alle durch die sieben Grundaxiome hindurchgegangen, Bachelor, Master, Promotion, haben sie verinnerlicht und reagieren meist befremdet, wenn jemand eines der Axiome ernsthaft infrage stellt. Auch die Wissenschaftsjournale zementieren daher die sieben Axiome.
Was wir dringend tun müssten
Es wäre ungeheuer leicht, ein freiheitliches, tolerantes und plurales Bildungssystem aufzusetzen, wo die meisten Unterrichtenden in den Wirtschaftswissenschaften nicht mehr direkt oder indirekt Egoismus predigen müssen: Durch Bildungsgutscheine für alle Studenten:
Jeder zu einem Studium qualifizierte junge Mensch, nicht nur die Ökonomie-Studenten, bekommt einen monatlichen Bildungsgutschein, beispielsweise in Höhe der derzeitigen tatsächlichen monatlichen Kosten für das Studium, und kann sich damit bei den Universitäten oder Hochschulen seiner Wahl bewerben. Wird er aufgenommen, erhält die Hochschule die Zahlung durch den Gutschein.
Die Gründung von Hochschulen wird entbürokratisiert und vereinfacht. Die Träger der Hochschulen müssen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und dürfen nicht gewinnorientiert arbeiten, sondern beispielsweise als gemeinnützige GmbH oder in einer anderen gemeinnützigen Rechtsform. Wissenschaftsministerien brauchen wir nicht mehr. Das spart Kosten und vor allem eine Unmenge an Bürokratie ein.
Durch Neugründungen von Hochschulen im Zuge des Gutscheinsystems würde das pädagogische und wissenschaftliche Wetteifern der Hochschulen untereinander dafür sorgen, dass sich die besten durchsetzen. Das dürften diejenigen sein, die die besten Hochschullehrerinnen und -lehrer haben und die meisten und besten Bewerber erhalten. Im Laufe weniger Jahre wird sich bei Unternehmen und für den Staatsdienst herausstellen beziehungsweise herumsprechen, welche Hochschulen die geeignetsten Absolventen hervorbringen.
Alle Arten von staatlich verpflichtenden Akkreditierungen – die in der Regel bürokratisch, langwierig, ineffizient und freiheitsberaubend sind – werden überflüssig. Gute, freie Hochschulen – auf dem Boden des Grundgesetzes – werden gute und freie Absolventen hervorbringen, die sich auch im Wirtschaftsleben und im Staatsdienst bewähren werden.
Geben wir jungen Menschen die Chance auf freie, plurale, umfassende, tolerante Bildung! Erziehen wir junge Menschen zu starken, selbstständig denkenden Menschen! Lasst uns ein unabhängiges, freies und tolerantes Hochschulwesen einführen!