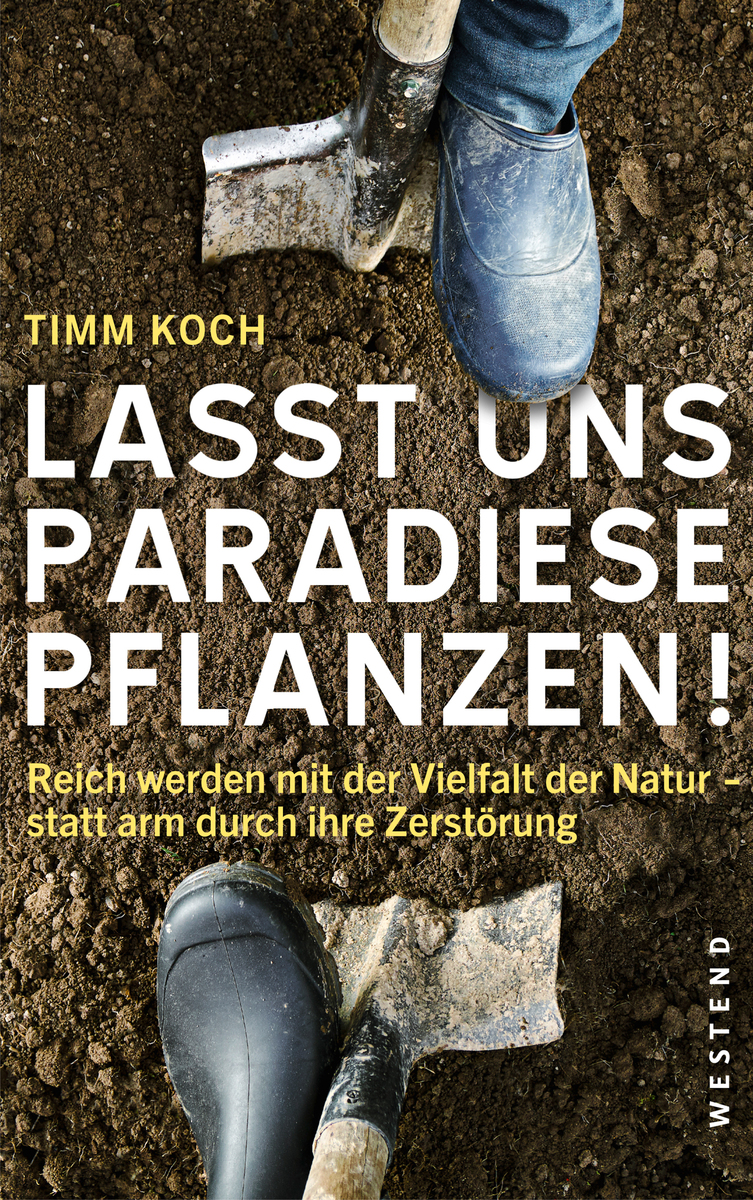Nahrhafte Vielfalt
Waldgärten verbinden Biodiversität mit Naturnähe und sind ein Gegenentwurf zu umweltschädlichen Monokulturen. Exklusivauszug aus „Lasst uns Paradiese pflanzen“.
Mitte der 1990er-Jahre erwarb der englische Informatiker Martin Crawford in der Grafschaft Devon im Südwesten Englands einen Acker, der zwei Morgen maß. Das sind etwas weniger als ein Hektar. Dort begann er mit wissenschaftlicher Methodik ein agrarisches Experiment, das bis heute andauert. Ihn trieb die Erkenntnis, dass einjährige Pflanzen wie zum Beispiel Mais, Hanf oder Getreide in der Natur eher selten vorkommen, aber durch die Agrarwirtschaft in weiten Teilen unserer Welt trotzdem das Landschaftsbild bestimmen. Diesem unnatürlichen Zustand wollte er begegnen, indem er begann, eine essbare Landschaft zu kreieren, die vor allem aus mehrjährigen Pflanzen besteht. Ein Waldgarten entstand, den er mittlerweile auf rund vier Hektar erweitern konnte und in dem heute über 500 Pflanzenarten gedeihen, die er sämtlich auf Essbarkeit und angenehmen Geschmack getestet hat. Crawfords Ziel war es, mit der Natur zu arbeiten statt gegen sie. Exklusivauszug aus „Lasst uns Paradiese pflanzen“ als Beitrag zu unserem „Nahrung“-Spezial.
Er machte sich klar, wie Pflanzengesellschaften unter natürlichen Bedingungen funktionieren und wie man sich diese Erkenntnisse im Hinblick auf den menschlichen Nahrungserwerb zunutze machen kann. Heraus kam ein essbarer „Forest Garden“, der als eine Art Mimikry der Natur gedacht ist. Er besteht im Wesentlichen aus sieben Schichten:
- Große Nuss- und Obstbäume wie Walnüsse, Esskastanien oder Süßkirschen
- Kleine Obst- und Nussbäume wie Äpfel, Sauerkirschen oder Haselnüsse
- Sträucher wie Johannis-, Stachel- oder Himbeeren
- Kräuter wie Bärlauch oder Wegwarte (Zichorie)
- Wurzelfrüchte wie Rüben oder Kartoffeln
- Bodendecker wie Erdbeeren oder Preiselbeeren
- Schlingpflanzen wie Weinreben, Hopfen oder Kiwis
Zusätzlich pflanzte er eine Reihe von Gewächsen, deren Aufgabe es ist, Stickstoff aus der Luft im Boden zu binden. Diese bezeichnet man als Leguminosen oder Schmetterlingsblütler. Zu ihnen zählen Hülsenfrüchte, wie etwa Erbsen oder Bohnen, Sträucher, wie zum Beispiel der Ginster, aber auch Bäume, wie die aus dem südlichen Nordamerika stammende Robinie. Dieser schnell wachsende Baum liefert Blütennektar, der bei Bienen sehr beliebt ist. Sein äußerst hartes, dauerhaftes Holz kann den Einsatz von Tropenhölzern im Außenbereich verzichtbar machen.
Außerdem macht sich Martin Crawford Totholz zunutze, indem er darauf Pilze zieht. Da er ein Zeitgenosse ist, der nicht an menschliche Allwissenheit glaubt, beließ er es nicht bei Gewächsen, deren Nutzen ihm auf den ersten Blick ins Auge sprang, sondern setzte auch auf eine ganze Reihe anderer Pflanzen, deren Aufgaben im Ökosystem Waldgarten sich ihm nicht auf den ersten Blick erschlossen haben, die aber trotzdem wahrscheinlich irgendeinen Sinn ergeben, weil sie zum Beispiel nützliche Insekten oder Vögel anlocken.
Crawfords Waldgartensystem ist, wie gesagt, ein Experiment und für ihn selbst eher ein Hobby. Inwieweit die Aufmerksamkeit durch Besuchergruppen sich finanziell für den Engländer auszahlt, vermag ich nicht einzuschätzen. Kritiker sagen dem Waldgarten nach, dass er zwar in den Tropen durchaus unter den landwirtschaftlichen Anbausystemen das produktivste sein kann, dies jedoch nicht für die gemäßigten Breiten mit ihrer kurzen Vegetationsperiode und auch nicht für den Mittelmeerraum gilt. Es gibt wohl tatsächlich einen guten Grund, warum bei uns die Menschheit seit Jahrtausenden auf einjährige Pflanzen, wie etwa Weizen oder Roggen, setzt. Getreide liefert große Mengen Nahrung und gedeiht als Windbestäuber zudem unabhängig von Bestäuberinsekten. Einjährige Pflanzen wie die Erbse kommen mit ihrer stickstoffbindenden Eigenschaft der Bodenqualität zugute.
Ich denke, dass Waldgartensysteme trotzdem eine Zukunft bei uns haben sollten. Die Möglichkeiten, giftfrei große Mengen Nahrung mit ihnen zu generieren, spielen erst mal eine untergeordnete Rolle. Wenn wir mit Ausgleichszahlungen aus Bidi-Abgaben (Bidi steht für Biodiversitätszertifikate, Anmerkung des Autors) den europäischen Bauern einen finanziellen Anreiz bieten, Waldgärten zu pflanzen und damit Biodiversität zu fördern, werden die Bauern Waldgärten pflanzen.
Artenerhalt ist schließlich kein Luxus, sondern die Voraussetzung für eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten!
Ob die Politik das Bidi-Konzept in großem Stil umsetzen wird, ist natürlich fraglich. Auf jeden Fall wird Zeit vergehen. Beschleunigt würde ein solcher Prozess ganz bestimmt, wenn, genau wie beim Klima, im Investmentbanking das Wort vom großen Geld die Runde machte und Biodiversität eine Lobby bekäme. In den hinteren Kammern meines Hirnkastens höre ich eine böse Stimme, die ruft:
„Hey Banker! An korrupten Politikern herrscht nach wie vor kein Mangel. Das wisst ihr selbst am besten. Bestecht sie doch mal so richtig, damit die Sache mit dem Biodiversitätszertifikatehandel ruckzuck Wirklichkeit wird. Was beim halbherzigen CO2-Schwindel so gut geklappt hat, kann noch mal funktionieren. Nur dass ihr diesmal etwas richtig machen könnt. Entdeckt endlich die Ökologie als Riesenchance, euch langfristig und nachhaltig den Geldbeutel zu füllen, ohne dass ihr zum Hassobjekt werdet! Nutzt die Werkzeuge, die ihr habt, euer Kapital und euren Einfluss mal zur Abwechslung für die Natur und nicht gegen sie. Mit ein wenig Fantasie wird es euer Schaden nicht sein. Lasst es ruhig auf ein kleines Gemetzel unter den Anhängern eurer Zunft ankommen, die weiterhin auf die Geschäftsmodelle von Agrochemie und Agropharma setzen. Stoßt die ewig Gestrigen in den Abgrund. Seht in den Pestizidfabrikanten endlich das, was sie sind: Konkurrenz, die mit allen Tricks zukunftsfähige Formen der Landnutzung ausbremst. Nutzt dieselben Tricks gegen sie! So etwas macht euch doch Spaß und gehört anscheinend zum Spiel dazu. Die sieben essbaren Stockwerke des Waldgartens werden euch dabei ein zuverlässiger Verbündeter sein.“
Bis das große Geld den wahren Wert ökologisch durchdachter Wirtschaftsformen für sich entdeckt hat, kann jeder Einzelne von uns, der über ein entsprechendes Grundstück verfügt, die Idee für sich aufgreifen und selbst einen Waldgarten konzipieren.
Gleiches gilt natürlich für das Heer der Waldbesitzer. Jeder dieser Menschen hat es in der Hand, eine nahrungsreiche Insel für vom Aussterben bedrohte Vögel, Insekten und Säugetiere zu schaffen. Diese Insel wird mit wenig Arbeitsaufwand auch den Waldgärtner gut versorgen. Städteplaner sollten das Konzept im Kopf haben, wenn sie den nächsten Park planen. Die Urban Community von morgen könnte im Frühjahr mit dem Gemüsemesser vor der Haustür Bärlauch ernten, im Sommer Kirschen und Pflaumen pflücken und im Herbst in saftige Äpfel und Birnen beißen. Schulen und Kindergärten könnten anhand von Waldgärten lernen, wie die Förderung von Artenvielfalt in Kombination mit guter Ernährung funktioniert, und mitmachen. Das Schöne an ihnen ist ja gerade, dass sie mit wenig Arbeit funktionieren, was für viele Kinder gegenüber dem herkömmlichen Schulgarten, falls er überhaupt existiert, ein deutliches Plus in Sachen Fun-Faktor bedeuten dürfte. Nicht nur die Biolehrer werden jubeln über einen essbaren Schulhof, auf dem zur Brutsaison der seltene Pirol sein Nest baut, in dem nachts Eulen und Fledermäuse beobachtet werden können und der geradezu einlädt zu Exkursionen in die geheimnisvolle Welt der Käfer und Hautflügler.
Philipp Gerhardt wäre nicht der Mann, der er ist, wenn er nicht auch so einen Waldgarten zu seinem Habitat zählen könnte. Nicht weit von seinem Zuhause steht ihm mit gleichgesinnten Menschen aus der Nachbarschaft ein großzügiges Areal zur Verfügung, wo Haselnüsse, Walnüsse, Esskastanien, Aronia-Apfelbeeren und vieles mehr gepflanzt wurde. Das Gelände liegt an einem Kanal; er nimmt mich mit auf einen Streifzug. Zwischen den Gehölzen wächst Rote Bete und anderes Gemüse. Es gibt auch einen Bienenstand. Obwohl der Waldgarten noch jung ist, ist es ein malerischer, verwunschener Ort. Dafür sorgen die alten Eschen-Ahorne, die hier gedeihen. Zusätzlich sorgen der Schatten und die wasserfördernde Wurzeltätigkeit der Neubürger aus Nordamerika dafür, dass die jungen fruchtbringenden Gehölze in der Sommerhitze nicht verdorren. Eines Tages werden sie wohl den Nussbäumen weichen müssen. Jeder Garten ist ein dynamisches System. Absterben und Verschwinden gehören genauso dazu wie Neupflanzungen und Erhaltungsschnitte.
Das Schöne an diesem Waldgarten ist das Gefühl der Gemeinsamkeit, das er vermittelt. Hier leben nicht nur Haselnusssträucher mit Meisen, Igeln und Menschen zusammen. Die Menschen können an der großzügigen Grillstelle auch untereinander zu ihren Gemeinsamkeiten finden.
Sicherlich muss hier und da ausdiskutiert werden, wer was wohin pflanzen darf oder soll. Trotzdem gefällt mir dieses Konzept gemeinsamen Gärtnerns besser als die abgezäunte Welt der Schrebergärten, wo jeder für sich alleine wirtschaftet und strenge Regularien herrschen.
In einer sonnigen Ecke zeigt mir Gerhardt die Kastanienwälder der Zukunft. Sie drängeln sich in hölzernen, etwa bauchnabelhohen Pflanzkisten. Bei ihrem Anblick kommt mir das Konzept „Forest in a box“ von Andrew St. Ledger in den Sinn. Dies sind wirklich Wälder in Boxen. Hunderte Esskastanien einer Ertragssorte warten darauf, ausgepflanzt zu werden, zu mächtigen Bäumen heranzuwachsen und auf Jahrhunderte hinaus Mensch und Tier mit ihren leckeren, vitaminreichen, nahrhaften, glutenfreien Früchten zu versorgen, die auch noch voller Proteine und wertvoller Mineralstoffe stecken. Die Kisten sind mit Bedacht so hoch gebaut, dass die Schösslinge lange Wurzeln entwickeln. Diese werden in ein ebenso tiefes Pflanzloch gesteckt, damit sie von vornherein möglichst nah am Grundwasser dran sind. Das erhöht gerade bei den trockenen, heißen Sommern, wie wir sie aus den vergangenen Jahren kennen, die Anwachschancen erheblich.
Lasst uns an diesem Punkt Philipp Gerhardt und seinen Entwurf für die brandenburgischen Paradieswelten verlassen und einen Blick auf die Waldgärten der Tropen werfen.
Die Plantagenwirtschaft, die sich heute in vielen tropischen Ländern vorfinden lässt, ist Ausdruck einer Art kolonialistischer Arroganz, welche die Nordmenschen bei ihren Eroberungen im globalen Süden seit jeher im Gepäck hatten.
Für die Kolonialherren der Vergangenheit mussten große Monokulturen ganz bestimmte Güter, wie etwa Kaffee oder Rohrzucker, in Masse liefern, je nachdem, nach welchen exotischen Lebens- und Genussmitteln der Markt zu Hause in Europa gerade verlangte. Anstelle sich bei den in ihren Augen minderwertigen Kulturen altbewährte Anbautricks und Methoden abzuschauen, setzte man lieber auf Plantagen. Immerhin war bereits das Eroberervolk der Römer mit dem Plantagenbau recht erfolgreich gewesen; gleichzeitig eignet er sich prima zum Versklaven und Unterdrücken — zu Dingen also, an denen sich Menschen zu erfreuen scheinen, die sich gerne zu Herren über andere machen. Dass die römischen Plantagen in komplett anderen Klimazonen lagen, interessierte erst mal nicht. So übersah man, dass die tropischen Landbausysteme viel besser funktionieren, eine wesentlich höhere Resilienz aufweisen und auch viel produktiver sind.
Unter dem Vorzeichen des Neokolonialismus hat sich bis heute nicht viel geändert. Neben modernen Formen der Sklaverei, denen sich die Landarbeiter und Kleinbauern ausgesetzt sehen, findet durch die Plantagenwirtschaft eine nicht wiedergutzumachende Zerstörung der Biodiversität der tropischen Länder statt. Nicht zufällig kommen gerade in den Ländern der Tropen exzessiv Pestizide zum Einsatz. Die Lebensformen dort sind so vielfältig, dass erst einmal besonders viel zerstört werden muss, bevor die Plantagenwüste wachsen kann. Mangels Aufklärung und begünstigt durch Behörden, die noch leichter zu korrumpieren sind als in den westlichen Industrienationen, kommen immer mehr hochgefährliche Mittel zum Einsatz. Nicht selten werden sie in Europa hergestellt, obwohl ihr Einsatz hier längst verboten ist.
Allein in Brasilien hat sich dadurch der Pestizidverbrauch in den vergangenen Jahren um 150 Prozent gesteigert. Allein die Flächen, auf denen in Brasilien — in der Regel genmanipuliertes — Soja angebaut wird, sind in Summe viermal so groß wie Portugal. Gerade genmanipulierte Pflanzungen verschlingen Unmengen an Ackergiften. Dies ist hauptsächlich ein Problem für die lokale Bevölkerung, deren Trinkwasser vergiftet und deren Böden ausgelaugt werden. Es ist aber auch ein Problem für die Menschen im globalen Norden, bei denen die Rückstände der Gifte auf dem Teller landen.
Vor allem ist es aber eben eine Katastrophe für die Artenvielfalt.
Wo früher ursprünglicher Regenwald wuchs und heute die Mähdrescher rollen, werden schon bald Wüsten entstehen. Es wird Zeit, dass die Menschheit begreift, dass die großen Monokulturen genauso auf den Müllhaufen der Geschichte gehören wie die Verbrennung fossiler Rohstoffe oder die Atomkraft.
Die Einführung eines Bidi-Systems darf natürlich bei den globalen Lieferketten nicht aufhören. Mit ihrer Marktmacht könnte die Europäische Union erreichen, dass sich Länder der Tropen wie Brasilien auf traditionelle Systeme zurückbesinnen. Diese Systeme heißen: Waldgärten! Bei uns ist die Vielfalt der verschiedenen Obstarten relativ eingeschränkt, denn es dominiert vor allem die Pflanzenfamilie der Rosengewächse (Rosaceae). Dazu gehören Äpfel, Birnen, Quitten genauso wie Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren und auch Kirschen, Pflaumen oder Aprikosen. An auf Bäumen wachsenden Fettfrüchten hat Mitteleuropa Walnüsse und Haselnüsse zu bieten, an Stärkefrüchten die Esskastanie.
In den Tropen hingegen ist die Vielfalt an Früchten schier umwerfend. Auf meinen Reisen durch Mexiko, Mittel- und Südamerika kam es vor, dass ich Tag für Tag eine neue Frucht kennenlernte, eine köstlicher als die andere. Mangos, Bananen, Avocados und Papayas sind inzwischen überall hinreichend bekannt. Aber wer hat hierzulande schon mal in eine Mangostane, eine Chico Sapote, eine Sapote Negro oder eine Mamey gebissen? Man denke nur an all die verschiedenen Palmenarten, deren Früchte von uns verwertet werden können: Neben der Kokospalme gibt es als Fettfruchtlieferanten die Macauba-Palme und die aus Afrika stammende Ölpalme. Für Stärke wird im Amazonasgebiet seit jeher die Pfirsichpalme angebaut.
Die Liste ließe sich beliebig erweitern. Insgesamt liefern rund einhundert Palmenarten essbare Früchte. Ölpalmen sind als Monokultur eine deprimierende Angelegenheit. Vor allem, wenn ihretwegen in Indonesien die Orang-Utans ausgerottet werden. In einem Waldgartensystem hingegen können sie eine prima Sache sein. Weiter kann die aus dem Südseeraum stammende Brotfrucht als Stärkelieferant genauso dienen wie der in Mesoamerika heimische Brotnussbaum. Der Brotnussbaum liefert auf einem Hektar Land so viele nahrhafte Proteine wie zehn Hektar Mais. In Kombination mit der schier unendlichen Vielfalt an leckeren und nahrhaften Früchten bietet sich natürlich auch der Anbau von wertvollen Edelhölzern in solchen Systemen an. Das vom Aussterben bedrohte Holz Pernambuk des fast verschwundenen brasilianischen Küstenregenwalds oder auch Schlangenholz bringen im Handel höchste Preise und werden gern für die Fertigung von Musikinstrumenten eingesetzt. Teakplantagen gibt es in den Tropen schon viel zu viele. Vor allem in Weltgegenden, wo der Teakbaum nicht heimisch ist, verdrängen sie die heimische Vegetation und damit auch die dort bereits natürlich vorkommenden edlen Hölzer.
Auch in einem tropischen Waldgarten gibt es sieben Schichten. Wegen der im Vergleich zu gemäßigten Klimazonen viel intensiveren Sonneneinstrahlung kann ein solches System sehr dicht gepflanzt sein. Als kleine Bäume taugen Kakao, Chirimoya, Zitrusbäume oder Stachelannonen. In die Strauchschicht können Kaffee und Bananen gepflanzt werden. Bei Kletterpflanzen fallen mir neben den in Sachen Hochhausbegrünung bereits erwähnten Maracuja und Drachenfrüchten auch noch der Pfefferstrauch oder die Vanille ein. In der Wurzelzone wachsen auf Lichtungen in den tropischen Wäldern Maniok, Süßkartoffel oder Yams, deren oberirdische Teile die Krautschicht bilden. Allein der Überfluss an Baumfrüchten würde reichlich Mast für die artgerechte Schweineweide geben. Natürlich würde sich zwischen den Obstkulturen auch Platz für die Haltung von Rindern finden. In Lateinamerika etwa wird Rindfleisch zwar in immer größeren Mengen erwirtschaftet, die heimische Bevölkerung kann es sich aber oftmals selbst kaum leisten, weil es zu teuer ist. Obwohl in den Anden Ecuadors entlang der Überlandstraßen überall Kühe grasen, habe ich dort nie ein saftiges Steak auf den Teller bekommen. Rindfleisch wird exportiert. Wahrscheinlich isst eine amerikanische Katze mehr Rindfleisch als ein ecuadorianischer Rinderzüchter aus dem Volk der Quechua.
Es gibt viele berechtigte Kritikpunkte an der Rinderzucht in den Tropen. Aus zehn Kilometern Höhe sah ich vom Flugzeug aus über Brasilien ganze Flusssysteme, wo für die gewaltigen Herden aus Dschungel Savanne wurde, deren offen daliegende, rote Erde auf den degradierten Flächen bis hoch zu mir sichtbar war.
Trotz aller berechtigten Kritik darf an diesem Punkt beschämenderweise nicht unerwähnt bleiben, dass es vielen Kühen Lateinamerikas wesentlich besser geht als ihren bemitleidenswerten Verwandten im industrialisierten Europa, die ihr Dasein zum größten Teil in Ställen fristen müssen.
In den Bergen Perus und Ecuadors sahen Nilufar und ich viele kleinbäuerliche Betriebe, in denen die Tiere ein artgerechtes Bilderbuchleben im Freien zwischen schattenspendenden Bäumen führten. In einer aus Waldgärten bestehenden tropischen Kulturlandschaft ist für sie genauso Platz wie für Hühner, Truthühner, Ziegen und Schafe. Nicht zu vergessen die Schweine! In den Tropen Asiens und Lateinamerikas gibt es viele optimal ans Klima angepasste Rassen. Wenn in der Reifezeit niemand mehr weiß, wohin mit all den Mangos und Avocados und sonstigen Früchten, die die Baumriesen in Massen liefern, setzen die Schweine den Überfluss in leckeres Fleisch und Fett um. Wenn Brasilien auf der vierfachen Fläche Portugals anstelle von Soja auf Waldgärten setzen würde, wäre dies mittelfristig aus betriebswirtschaftlicher Sicht sicherlich einträglicher und aus volkswirtschaftlicher Sicht vernünftiger, weil es wieder Jobs dort generieren würde, wo heute vorwiegend Maschinen zum Einsatz kommen.
Hier kommen wir an einen entscheidenden weiteren Punkt, den sozialen Aspekt. Seit jeher waren vor allem landwirtschaftliche Großbetriebe anfällig für Strukturen, die nicht nur die Natur ausbeuten, sondern auch die Menschen. Egal, ob marokkanische Orangenpflücker in Spanien, rumänische Spargelstecher in Deutschland oder haitianische Zuckerrohrschneider in der Dominikanischen Republik. An viel zu vielen Orten der weltweiten Nahrungsproduktion leisten Menschen auf anderer Leute Land harte Arbeit für schlechtes Geld, in prekärer Abhängigkeitslage, die nicht selten de facto als Sklaverei gelten müsste. Sie stehen in einer Tradition, die bereits auf den Latifundien der alten Römer bestand und ihre grauenvolle Fortsetzung auf den Baumwollfeldern Alabamas fand.
Anhaltend schlechte Lebensbedingungen sorgen naturgemäß für Unmut unter den Geschädigten. Nimmt dieser Überhand, kann es leicht zu Revolten und Umstürzen der liebgewonnenen Ordnung kommen. Dann ist bei Landbesitz schnell die Eigentumsfrage gestellt. Auch dies war bereits bei den alten Römern so. Durch Gesetze und die gezielte Ansiedlung ehemaliger Legionäre auf enteignetem Großgrundbesitz begegnete man auf Druck einer zunehmend unzufriedenen, landlosen Bevölkerung den Auswüchsen der Latifundienwirtschaft.
Die Geschichte der Landreformen ist fast so alt wie die der Sklaverei. Deswegen lieben Landgrabber und Agrarkonzerne große Maschinen. Dem Traktorpiloten kann man ruhig einen halbwegs fairen Lohn zahlen. Mit seiner Maschine bearbeitet er Flächen, auf denen vorher Hunderte schuften mussten. Man nimmt einfach, wo immer es geht, den Faktor Mensch aus dem System.
Als junger Mann absolvierte ich einige Semester eines landwirtschaftlichen Grundstudiums an der Ostberliner Humboldt-Universität. Ich erinnere mich lebhaft an meine Mathematikprofessorin, die uns immer wieder an verschiedenen Beispielrechnungen folgenden Dreisatz üben ließ: Wie viel Geld muss ich investieren, um zwei Stellen in meinem Betrieb abzubauen und am Ende wieder dasselbe Geld zu haben? Es war eine Nullsummenrechnung auf Kosten der Jobs. Ich erlaubte mir die Frage, warum wir nicht andersherum rechnen würden: Wie viel Geld muss ich investieren, um zwei Stellen zu erhalten beziehungsweise zu schaffen und am Ende wieder dasselbe Geld zu haben? Die Professorin, die bemerkenswerterweise einige Jahre zuvor noch dem sozialistischen Lehrbetrieb zugearbeitet hatte, reagierte unangenehm berührt und erklärte lapidar, die Menschen, die in der Landwirtschaft ihren Job verlören, sollten sich halt anderswo eine Arbeit suchen.
Es war übrigens dieselbe Person, die uns staunenden Studierenden erklärte, warum so viele ihrer Kollegen an der landwirtschaftlichen Fakultät an Krebs stürben. Dies sei auf Rechenfehler zurückzuführen. Sie hätten sich schlicht in der Giftigkeit der Pestizide verrechnet und versäumt, gespritztes Obst ordentlich mit einem Tuch abzuwischen, ehe sie davon im Rahmen ihrer Arbeit kosteten. Solche und andere Dinge lernte ich in den 1990er-Jahren an der Universität. Ich frage mich, wie es heute dort zugeht.
Zurück zu den Waldgärten. Es ist klar, dass schweres Gerät hier genauso wenig zu suchen hat wie Kunstdünger oder Pestizide. Obwohl ich der Robotik beim naturverträglichen Bewirtschaften unserer Nahrungskulturen eine große Zukunft vorhersage, wird menschliche Arbeit in solchen Systemen wohl erst einmal unentbehrlich sein. Natürlich schützen auch Agroforstsysteme als solche nicht vor ausbeuterischen Strukturen. Dennoch: Wer das Land, das er bewirtschaftet, mit höchstem Respekt behandelt, der behandelt vielleicht auch seine Mitmenschen besser. Fairness hat sich noch immer ausgezahlt.
Hier können Sie das Buch bestellen: „Lasst uns Paradiese pflanzen! Reich werden mit der Vielfalt der Natur – statt arm durch ihre Zerstörung“