Wie verschieden literarische Sichtweisen sein können und wie aktuell Fassbinders Diagnose ist, das zeigt Peter Menne in „Dramatisierung eines Romans“, einer literaturwissenschaftlichen Studie, die zwei Werke vergleicht – und sie an zugrundeliegende gesellschaftliche Wirklichkeit rückkoppelt: Gerhard Zwerenz' Roman „Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond“ und Fassbinders „Der Müll, die Stadt und der Tod“. Wir veröffentlichen Auszüge aus dem Buch, die sich speziell dem Themenkreis „Antisemitismus/Philosemitismus“ widmen.
Gerhard Zwerenz veröffentlichte im August 1973 seinen Roman „Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond“, in dem er seine Eindrücke von der Umstrukturierung des Frankfurter Westends schildert. Er bezog seinen Roman explizit auf die Stadt Frankfurt und die dortige Bodenspekulation. Rainer Werner Fassbinder veröffentlichte im März 1976 sein Drama „Der Müll, die Stadt und der Tod“. Das Urteil der Kritik war darüber gespalten, ob es ein Stück speziell über Frankfurt ist oder sich ortsunabhängig auf die moderne Industriegesellschaft im allgemeinen bezieht (7).
Der Autor selbst sagte über den Stoff, den er zum Stück verarbeitete: „Der Ort, an dem solche Verhältnisse entdeckt werden können, heißt Frankfurt am Main.“ Das Stück gilt also auch den Verhältnissen in dieser Stadt, aber nicht ausschließlich dieser Stadt. Dementsprechend lautet die Ortsangabe der ersten Szenenanweisung auch nicht „Frankfurt“, sondern es findet sich eine Reminiszenz an Zwerenz' Roman: „Auf dem Mond, weil er so unbewohnbar ist wie die Erde, speziell die Städte“.
Zwerenz und Fassbinder unterhielten nicht nur eine Freundschaft und arbeiteten bei verschiedenen Projekten zusammen, sondern Fassbinder schrieb zeitgleich mit der Arbeit an seinem Stück ein Drehbuch zu Zwerenz' Roman. Dieses Drehbuch orientierte sich sehr streng an Romanhandlung und -dialogen. Der Roman war Fassbinder also beim Schreiben seines Dramas wohlbekannt.
An „Der Müll ...“ entzündeten sich einige Skandale; lautstark wurde der Vorwurf erhoben, das Stück sei antisemitisch. Zwerenz wurde in diese Debatten insofern miteinbezogen, als manche Kritiker in seinem Roman die Vorlage für das Stück entdeckten: Inhaltlich würden die Texte sich decken, also sei Zwerenz für das Stück und seinen antisemitischen Gehalt mitverantwortlich.
Auf diesen Antisemitismus-Vorwurf reagierte Zwerenz zunächst mit einer abstrakten Begriffsanalyse: In „Linker Antisemitismus ist unmöglich“ entfaltete er die Begriffe „links“ als emanzipatorisch und „antisemitisch“ als rechts-national und biologistisch. Aber er unterließ konkrete Bezugnahmen auf das Drama – auch den Hinweis, daß zwischen der Meinung des Autors und der seiner Figuren zu unterscheiden sei, trug er prinzipienhaft vor.
Das Fortdauern der Auseinandersetzungen veranlaßte Zwerenz zu einer Änderung seiner Strategie: Er versuchte, vom Ruhm des inzwischen verstorbenen Fassbinder zu profitieren, indem er – erfolglos – eine Miturheberschaft einklagte und sich mit untauglichen Änderungsvorschlägen an dessen Text als Vermittler aufdrängte. Seine Einlassungen wurden nicht beachtet, was Zwerenz zu trotziger Medienschelte veranlaßte:
Am 11.6.1982 – einen Tag nach Fassbinders Tod – sagte Zwerenz in einer Presseerklärung, daß er nicht mehr dafür sei, Fassbinders Stück aufzuführen. Die Erklärung wurde in der Presse verschwiegen.
Am 9.11.1985 fand in der „Romanfabrik“ eine öffentliche Diskussion statt, (...) Zwerenz deutete einen Vorschlag zur Beilegung des Theater-Konflikts an. (...) Diese Veranstaltung (...) wurde in den Medien verschwiegen, obwohl sie sonst jedes Detail des Konflikts breit ausmalten.
(...) Da meine Rolle als Friedensstifter aus dem Hintergrund nicht akzeptiert wird, bin ich als Autor des Stoffes nicht mehr geneigt, weitere Eskalationen hinzunehmen.
Fassbinders Vertrautheit mit „Die Erde ...“, die spätere Verquickung seines Dramas mit Zwerenz' Roman, nicht zuletzt aufgrund dessen Urheberrechtsklage, veranlaßten manche Kritiker und Bodek dazu, die Behauptung aufzustellen, daß
„derart weitgehende Übereinstimmungen in den Charakteren, ihrem Metier, ihren Motiven und Methoden des Handelns, (...) aber auch in der Thematik der beiden Werke, (...) dem Handlungsverlauf (...) herausgearbeitet werden könnten, daß definitiv gesagt werden kann: ,Müll‘ entstand weitestgehend auf der Basis des Romans von Zwerenz“ (17).
Tatsächlich gibt es Überschneidungen im Stoff: Zwerenz' Hauptfigur ist der jüdische Immobilienspekulant Abraham, und unter Fassbinders Hauptrollen findet sich der Reiche Jude, der derselben Branche angehört. Beide Texte beinhalten also eine von der äußerlichen Beschreibung her gleiche Figur: einen Immobilien-Projektentwickler, der der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört.
Doch damit enden die Parallelen: Trotz dieser stofflichen Überschneidung verfügen „Die Erde ...“ und „Der Müll ...“ über einen fundamental verschiedenen Gehalt – den auch Zwerenz trotz seines Anspruches auf Miturheberschaft herausstreicht. Voll Selbstmitleid klagt er:
„Warum wohl macht sich ein Romancier die Mühe, ein Ensemble von Kunstfiguren zu schaffen und (...) ihre Bosheiten und ihre Qualen differenziert zu gestalten? (...) Aber was soll er tun, wenn dann in der Banalisierung durch ein Theaterstück das krasse Gegenteil daraus entsteht.“
Bei vergleichender Lektüre beider Texte zeigt sich tatsächlich ihre Verschiedenheit – allerdings erweist sich das Verhältnis ihrer literarischen Qualität als entgegengesetzt zu oben zitierter Zwerenzscher Wertung.
(…)
Exkurs über den Begriff des Antisemitismus
„Antisemitismus“ bezeichnet Vorurteile gegenüber Juden, und zwar sowohl gegen einzelne Angehörige dieser Religionsgemeinschaft als auch gegen ihre Gesamtheit. Das Vorurteil kann so weit reichen, daß es alle Angehörigen dieser Religionsgemeinschaft weltweit zu einer „Rasse“ zusammenfaßt. Im einzelnen werden Juden folgender Eigenschaften bezichtigt:
Sie hätten eine große, krumme Nase, wulstige Lippen und krauses Haar; aufgrund ihrer Physiognomie sei ihre Zugehörigkeit zu dieser Religionsgemeinschaft ebenso offensichtlich wie etwa ein Neger über dunkle Hautfarbe verfügt. Juden seien gefühl- und heimatlos, fühlten sich nirgends zuhause, sondern stetig umhergetrieben. Statt mitmenschlicher Gefühle zeigten sie eiskalt berechnete Reaktionen. Sie scheffelten Geld, seien raffgierig und geizig. Passend zu ihrer Geilheit verfügten Juden über außerordentliche Potenz. Zur Struktur des Vorurteils gehört es, daß solcherlei Eigenschaften auf jemanden zutreffen sollen, bloß weil das Merkmal „jüdisch“ auf sie oder ihn zutrifft.
In seinen Studien zum autoritären Charakter untersucht Adorno die Struktur des Vorurteils und kommt zum Ergebnis, daß es unabhängig ist von etwaigen konkreten Eigenschaften der Gruppe, über die es gefällt wird:
Das Vorurteil bezieht sich, seinem eigentlichen Inhalt nach, wenn überhaupt, nur oberflächlich auf die spezifische Natur seines Objekts.
Vielmehr gründet es in Eigenschaften desjenigen, der das Vorurteil fällt: Mit ethnozentrischen Ansichten sind zumeist kritiklose Hörigkeit bestehenden Mächten gegenüber, pseudokonservative Moralvorstellungen und eine rigide Sexualmoral verknüpft. Adorno weist die Erwartung nach, „daß diese Hypothese mit klinischen Kategorien wie Stereotypie, Unfähigkeit zur ,Erfahrung‘, Projektion und Machtphantasien zusammenhängt.“
Die Gruppe, über die ein Vorurteil gefällt wird, ist austauschbar: Juden, Neger, Türken oder Asylanten sind für den Vorurteilsvollen völlig unterschiedslose Gruppen. Es mag an örtlichen oder historischen Gegebenheiten liegen, daß sich das Vorurteil gegen eine bestimmte Gruppe richtet – nicht aber an Eigenschaften dieser Gruppe!
In Mitteleuropa ist der Anteil der schwarzen Bevölkerung zu gering, als daß sich Vorurteile ihnen gegenüber ähnlich weit verbreiten könnten wie in den USA. Was dem vorurteilsvollen Franzosen die maghrebiens – insbesondere die Algerier –, waren den vorurteilsvollen Deutschen in den siebziger Jahren die „Itaker“ – Italiener – und sind es heute die „Kanaken“ – Türken – oder die Asylanten. Gerade die letzte Zielgruppe veranschaulicht deutlich die Irrationalität des Vorurteils: Zu Asylanten und Asylbewerbern gehören so disparate Ethnien wie Kurden, Vietnamesen („Boat people“), (Nord-)Koreaner und Eritreer oder Flüchtlinge aus Ruanda. Mithin handelt es sich um eine völlig inhomogene Gruppe.
Die Juden bilden insofern eine besondere Gruppe, als sie im christlichen Kulturkreis schon sehr lange verfolgt werden: Das Mittelalter kannte eine besondere Judengesetzgebung; Juden wurden in Ghettos segregiert. Nach obiger Begriffsklärung hatte diese Sonderbehandlung nichts mit „jüdischen“ Eigenschaften zu tun – die Wurzeln des Vorurteils sind vielmehr in den Denk- und Wertmustern der herrschenden Ideologie zu suchen, also in der christlichen Nächstenliebe (439).
Im Gefolge der Aufklärung wurden Staat und Kirche getrennt (440), der laizistisch gewordene Staat emanzipierte die Juden bis zum Ende des 19. Jahrhundert formalrechtlich. Die Denkmuster der Bevölkerung wandelten sich nicht so schnell: Das kulturell verankerte, fest inkorporierte christliche Menschenbild sorgte für das Fortdauern einer europaweiten Judenverfolgung, die schließlich im einmaligen deutschen Holocaust kulminierte (441).
Daß das antijüdische Vorurteil in einem einzigartigen Verbrechen an Juden mündete, begründete eine spezifisch deutsche Problemsituation: Auf sozialer Ebene ist antisemitisches Ressentiment seit der Befreiung vom 8./9. Mai 1945 tabu. Auf individueller Ebene sind langjährig aufgebaute Denkstrukturen und Verhaltensmuster nicht einfach austauschbar.
Individuen, die antisemitische Denk- und Wertmuster internalisiert hatten, entwickelten manchmal eigenwillige Anpassungsmechanismen an die ihnen abverlangte neue Wertordnung. Ein mögliche Reaktion ist der Philosemitismus: Das vorurteilsvolle Individuum genügt mit solcher „Judenliebe“ dem neuen Antisemitismus-Tabu, dennoch bleiben Juden ihm eine ganz besondere Gruppe.
Normaler Umgang mit Einzelnen bleibt unmöglich, weil dessen Individualität in den Augen des Vorurteilsvollen überschattet wird vom nun eben philosemitischen, aber weiterhin ethnozentrischen Vorurteil, das die Gruppenzugehörigkeit in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt.
Diese Reaktionsvariante hat Fassbinder gesehen, hat sie mit seinem Drama auf- und angegriffen. Mit zunehmendem zeitlichen Abstand zu den alliierten Entnazifizierungs-Ausschüssen entwickelte sich eine andere Reaktionsweise: der Schuldabwehrantisemitismus (444). Nach Bodek ist der Schuldabwehrantisemitismus durch drei Elemente gekennzeichnet. Erstens die „Schuldkontenbegleichung“: „Individuelle Vergehen von Juden, überaus aufmerksam registriert, werden ,den‘ Juden zur Last gelegt und gegen historische Schuld der Deutschen aufgerechnet.“
Zweitens die „Konstruktion des ,schuldigen Opfers‘“:
An Juden wird ein besonders hoher ethisch-moralischer Maßstab angelegt – den kein normaler Mensch erfüllt. Bleibt auch ein Jude hinter diesen überhöhten Anforderungen zurück, gilt er als schuldig statt als vollkommen unschuldig verfolgt.
Drittens die „Projektion der ,jüdischen Rache‘“: Das alte Stereotyp von der jüdischen Rachsucht erhält einen modisch rationalisierenden Anstrich, indem den Juden ein Vergeltungsdrang aufgrund der während des Dritten Reiches erlittenen Verbrechen unterstellt wird. Bodek sieht eine solche Reaktionsweise in Deutschland anwachsen.
Es mag weitere individuelle Anpassungsstrategien an die neue soziale Norm geben. Diese Arbeit unternimmt es nicht, alle möglichen Reaktionsweisen vollständig aufzulisten, sondern untersucht im Folgenden nur die Funktion der beziehungsweise des Juden in „Die Erde ...“ und „Der Müll ...“.
Folgen eines „philosemitischen Tabus“
Zu den Problemen, die Zwerenz mit seinem Roman thematisieren will, gehört – neben der Bodenspekulation – auch der von ihm diagnostizierte Philosemitismus. Er empfindet den deutsch-jüdischen Umgang miteinander als so weit gestört, „daß allein die Nennung eines solchen Wortes wie Jude viele Menschen zusammenzucken läßt; (...) in ihnen schwingt die Negativbedeutung, die der Faschismus diesem Wort beigelegt hat, nach.“ Das enthebe das Verhalten der Juden jeder Kritik – deren Behandlung „wie rohe Eier“ ist ihm ein ebenso unerträglicher Zustand wie deren Diskriminierung: „Die jüngere Generation (...) hat dafür kein Verständnis, die zuckt nicht zusammen, wenn gesagt wird: Jude.“
Seinen Roman betrachtet Zwerenz insofern als überfälligen Beitrag zur Normalisierung der Deutschen, weil deren Berührungsängste so weit reichen, „daß einmal ein Tabubruch vorliegt insoweit, als überhaupt ein Jude zu einer wichtigen Figur in einem Roman gemacht worden ist.“ Nota bene: Kein schlechter Jude, sondern ein Jude überhaupt durchbreche schon das Tabu. Zwerenz geht aber noch weiter: Weil er nicht nur moralisch indifferente Juden sieht, sondern auch solche, die – in seinen Augen – ausgesprochen schlechten Beschäftigungen nachgehen, schreibt er tabuzerschlagend über die Bösewichter:
„Wenn von zehn wichtigen Maklern in Frankfurt acht jüdischer Herkunft sind, kann ich nicht nur über einen Perser schreiben, den es auch noch gibt.“
Seine Kritik an deren Beschäftigung – korrekterweise wäre nicht vom Makeln, sondern vom Immobiliendevelopment zu sprechen – trägt Zwerenz strikt personalisiert vor. Weil es ihm nicht darum geht, das Schlechte an deren Geschäft herauszuarbeiten, sondern den Betreiber über seine persönlichen Züge schlecht zu machen, kommt ihm das Moment des Jüdischen gelegen: Zwerenz weiß nicht nur, daß vielen die faschistische negative Bedeutung in den Ohren klingt – er weiß auch, welche konkreten Inhalte sie hatte. Daher stattet er den „Mann, der durch seine Spekulation mit Grundstücken, mit Bauten, mit Häusern und Hochhäusern für viele andere zu einer schicksalhaften Negativfigur wird“ seiner besseren Kenntlichkeit halber mit fast allen Attributen aus, die das weite Arsenal antisemitischer Stereotypen zu bieten hat (454).
Zwar ist es nicht Zwerenz' Konzept, einen antisemitischen Roman zu schreiben; vielmehr soll die jüdische Negativfigur nur das „philosemitische Tabu“ beseitigen.
Seine Sicht der Juden betrachtet er selbst als differenziert, denn „in meinem Roman von 1973 steht neben dem Immobilienhai Abraham die leuchtende Figur des deutsch-jüdischen Sozialisten Fritz Bauer“. Weil er eine solche Gegenfigur zeichnet, reklamiert Zwerenz für sich kritische Neutralität gegenüber Juden. Aus dieser Einstellung heraus will er das deutsch-jüdische Verhältnis beleuchten:
„Wie halten wir‘s mit den Juden, wie halten es die Juden mit uns. Endlich: Wie kann einer unter uns ein deutscher Jude sein? (...) Darf er, aus Angst vor dem nazistisch-antisemitischen Klischee, etwa kein Baulöwe, Spekulant usw. sein? Also: Dürfen nur nichtjüdische Deutsche Spekulanten sein? Juden aber nicht?“
In der abstrakten Aufgabenstellung gilt das auch dem Vertreter der Jüdischen Gemeinde als legitimes Unterfangen:
„Es gibt Juden, die Verbrecher sind; es gibt gute und schlechte Juden, so wie es gute und böse Christen und Moslems gibt. (...) Es muß Aufgabe der Kunst sein, dieses Phänomen zu be- und verarbeiten.“
Fraglich ist indes, ob Zwerenz' Konzept, Antisemitismus zu vermeiden, tauglich ist. Diese Frage braucht aber nicht abstrakt untersucht zu werden, weil schon Zwerenz' Durchführungsversuch scheitert:
(…)
Wie „Antisemitismus“ funktioniert – ein Lehrstück
In „Der Müll ...“ treten zwar zwei dezidierte Nazis – Müller und Hans von Gluck –, aber nur ein Jude auf. Dieser trägt keinen Namen, sondern ist nach seiner Religionszugehörigkeit benannt. Allein das reichte großen Teilen der Kritik zum Verdikt, „Der Müll ...“ als das „antisemitische Theaterstück par excellence“ (486) zu bezeichnen. Ungeachtet der Normalität in neuerer Literatur, Figuren nicht individuell, sondern nach Gruppenzugehörigkeiten zu benennen – vergleiche Kapitel 5.3.2. Zum Namensuniversum von „Der Müll ...“, Seite 130 ff. – , argwöhnt Bodek:
„Allein die Benennung der Figur mit dem Typus ,Der Reiche Jude‘ versieht diese Figur mit einer antisemitischen Aura. (...) ,Namen‘ wie ,Der Reiche Jude‘ sind antisemitische Chiffren, die kürzestmöglichen Formeln antijüdischer Handlungen.“
Die Struktur des Textes gestaltet sich jedoch etwas komplexer, als Bodek sie sehen will. Als Stück über Antisemitismus zeigt „Der Müll ...“ den Mechanismus auf, nach dem Vorurteile funktionieren. Die Hauptfigur „Reicher Jude“ wird keineswegs schlecht gemacht, vielmehr betont der Autor, dessen Charakter positiv zu gezeichnet zu haben:
„Der Jude ist der einzige in diesem Stück, der in der Lage ist zu lieben, der einzige, der imstande ist, die Sprache, die er spricht, als ein Abkommen zwischen Leuten zu erkennen. Es ist absolut eine Figur mit positiven Einzelheiten (488)“.
Tatsächlich hebt sich der Reiche Jude noch mit weiteren sympathischen Eigenschaften deutlich von den Gestalten ab, die über einen „individuellen“ Namen verfügen.
Das Stück zeichnet gesellschaftliche Wirklichkeit als kalt und unmenschlich (489).
Den meisten Protagonisten geht es schlecht in ihren Verhältnissen. Doch statt das den Verhältnissen anzulasten, suchen sie sich einen Sündenbock: Der Reiche Jude wird angegriffen – nicht ob seines Profitierens von den Verhältnissen, sondern einzig aufgrund einer völlig außerhalb der ökonomischen Verhältnisse liegenden Eigenschaft, nämlich seiner Religionszugehörigkeit.
Es liegt also die Grundstruktur des autoritären Charakters vor, sich die komplexe Welt durch wenige, dafür omnipotente Personen (490) zu „erklären“. Der Reiche Jude gibt die Folie ab, auf der das autoritäre Verhalten seiner Umwelt sichtbar wird. Das Stück greift nicht diese Figur an, sondern thematisiert den Antisemitismus als gesellschaftliches Phänomen, ist also eines über Antisemitismus.
Quellen und Fußnoten:
Im Buch werden sämtliche Zitate durch Fußnoten belegt, ebenso finden sich viele Querverweise. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir hier die meisten Fußnoten weggelassen; die vorhandenen Fußnoten entsprechen der Originalnummerierung aus dem Buch / Anmerkung der Redaktion
(7) Als Frankfurt-spezifisches Stück lesen „Der Müll ...“ z.B. Rudolf Krämer-Badoni, Das Schreckgespenst vom bösen reichen Juden, in: RM, Nr. 42 vom 12. Okt. 1985, oder – mit Einschränkungen – Karl Deiritz, Antisemitismus, in: dvz / die tat vom 8. Nov. 1985. Dagegen schreibt Töteberg: „Nicht der reale Ort Frankfurt ... war gemeint, sondern eine Lebensform, die den Menschen verkrüppelt oder gar zerstört.“ (Michael Töteberg, Im Dickicht der Städte, in: dvz / die tat vom 15. Nov. 1985).
(17) Janusz Bodek, l.c., p. 195. Daß Bodek diese Frage umstandslos bejaht, verwundert nicht angesichts seines sorglosen Umgangs mit den Texten, vergleiche Kap. «5.3.4. Das Urteil der Kritik», p. 139 und Anm. 218, p. 61.
(439) Mit dem Begriff der „Nächstenliebe“ wird gar zu leicht Positives assoziiert. Deutlichkeitshalber muß daher auf den Kernpunkt christlicher Nächstenliebe hingewiesen werden, wie er sich in Inquisition und Hexenverbrennung zeigte: Das Verbrennen einer Hexe gilt den Papisten als fürsorglicher Akt, weil dadurch deren Seele „gereinigt“ werde. Zu den Leistungen der protestantischen Spielart des Christentums vergleiche Johann Most, Die Gottespest.
(440) Zumindest auf dem Papier – die innige Verbundenheit zeigt sich heute noch in den Ankündigungen bayerischer Politiker, entgegen der verfassungsrichterlichen Aufforderung zu weltanschaulicher Neutralität im Unterricht Schüler christlich indoktrinieren zu wollen – vergleiche deren Reaktionen auf das „Kruzifixurteil“ des Bundesverfassungsgerichts.
(441) Ob Kirche und Faschismus über ähnliche, einander bedingende oder fördernde Strukturen verfügen (z.B. Führerprinzip der Papisten: der „Papst“ genannte oberste Guru ist „unfehlbar“), kann hier nicht diskutiert werden. Festzuhalten bleibt deren gute Zusammenarbeit: Das Konkordat zwischen Kirche und Drittem Reich gilt auch in der Bundesrepublik fort und Italien leidet noch heute unter den Folgen des Faschismus, denn nichts deutet auf eine Wiedervereinigung der von Mussolini geteilten Stadt Rom hin.
(444) Vergleiche Janusz Bodek, l.c., p. 75 – 103. Das Wort „Schuldabwehrantisemitismus“ ist neu, doch wesentliche Züge des Konzepts sind deutlich älter: Sie finden sich in Henryk M. Broders Aufsatz „Antisemitismus – ja, bitte! Ein Vorschlag für mehr Ehrlichkeit und weniger Heuchelei“, in: Süddeutsche Zeitung vom 18. Jan. 1986. Wie alle Titel der von Heiner Liechtenstein herausgegebenen Aufsatzsammlung findet sich auch dieser zwar in Bodeks Literaturliste, doch in der Argumentation fehlt jeder Hinweis darauf, daß der „Judenhaß ... ohne Juden“ (l.c.) dort längst analysiert wurde.
(454) Das Nutzen antisemitscher Klischees zur Zeichnung von Abraham ist ebenso offensichtlich wie umfangreich, daß hier statt Zitation einzelner Beispiele nur auf Anhang «2.4.1 Antisemitische Stereotypen», Bd. 2, p.74, verwiesen wird. Dort sind die Textstellen nach verwandtem Klischee systematisiert.
(486) Janusz Bodek, l.c., p. 8. Stellvertretend für viele andere sei hier nur cbg., Frankfurter Fassbinder-Premiere verhindert, in: Neue Zürcher Zeitung vom 4. Nov. 1985, zitiert: „Der ... Autor bediente sich mit der Bezeichnung der Hauptgestalt als 'der Reiche Jude' einer beliebten Etikettierung des Antisemitismus.“
(488) Rainer Werner Fassbinder in Benjamin Henrichs: Philosemiten sind Antisemiten, in: Die Zeit vom 9. April 1976, p. 33 f. Dementsprechend gestaltete Dietrich Hilsdorf seinen Inszenierungsversuch 1985: seine Regie „zeigt ihn als den einzigen menschlich Fühlenden unter seelischen Krüppeln“ (Werner Schulze-Reimpell, Ein unfruchtbarer Streit, in: Vorwärts vom 16. Nov. 1985).
(489) Vergleiche oben Kap. «3.3. Zwei grundverschiedene Blickrichtungen auf das Wirtschaftssystem – ein Résumé», p. 74, und Kap. «4.2.2. Geld oder Liebe II», p. 99.
(490) Vergleiche Hans von Glucks Klage über den übermächtigen Konkurrenten in „Der Müll ...“, 10. Szene, p. 89: „Und einer lacht sich ins Fäustchen und ... hat die Banken auf seiner Seite und die Mächtigen dieser Stadt.“
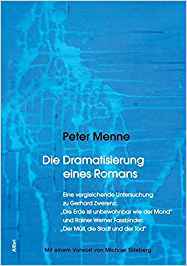

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .



