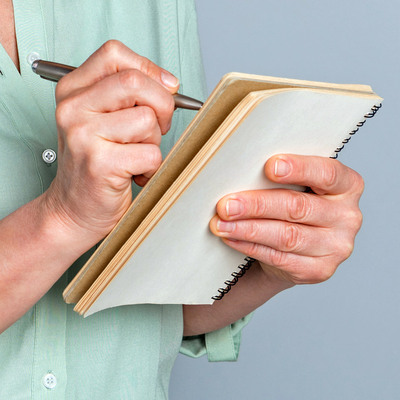Esther van Loo: Raymond, seit wann bist du Landwirt und seit wann betreibst du biologischen Landbau?
Raymond Niesten: Mein Sohn Luc und ich sind die fünfte und sechste Generation des Bauernhofs Niesten. Mein Vater hatte einen gemischten Betrieb mit Kühen, Schweinen, Hühnern und Ackerbau. In den 1970er Jahren hatte mein Vater sämtliche Tiere verkauft, denn es war die Zeit der Vergrößerung und Spezialisierung. Er spezialisierte sich nur noch auf den Ackerbau. 2006 kam ich in unseren Betrieb, mein Vater war zuvor bereits verstorben.
Als ich mich entschloss, den Betrieb weiterzuführen, suchte ich nach Möglichkeiten, den Betrieb wieder rentabel zu machen, denn die Zeiten waren nicht so gut. Wir befinden uns hier in der Nähe der Großstadt Maastricht, also gibt es viele potenzielle Kunden. Der Boden hier ist teuer, die Grundstücke sind klein, ungünstig parzelliert und deshalb nicht leicht zu bearbeiten. Wir wollten also sehen, wie wir uns von anderen abheben können, um zu überleben. Wo lagen die Chancen? Unter anderem in der Direktvermarktung und in einzigartigen Produkten, vor allem in Produkten, die gut schmecken.
Unser Betrieb war klein, etwa 20 Hektar. Wir haben mit weißem Spargel angefangen, der in Limburg eigentlich nur auf den Sandböden in Nord-Limburg angebaut wird und für die Umgebung von Maastricht einen einzigartigen, leckeren Geschmack hat, weil er hier auf Lössboden wächst. Spargel liefert einen relativ hohen Ertrag pro Hektar. Auch habe ich mich auf die Suche nach leckeren Kartoffeln gemacht. Ich dachte: „Die meisten Bauern produzieren Lebensmittel, aber wie diese schmecken, interessiert sie nicht.“ Landwirte wollen so viele Kilo wie möglich erzeugen, denn sie werden pro Kilo Produkt bezahlt, nicht pro Kilo Geschmack. Also begann ich nachzudenken: „Wir produzieren Lebensmittel, aber sind das eigentlich die Lebensmittel, die der Verbraucher verlangt?“ Das waren die geschäftlichen Überlegungen, die mich dazu bewogen haben, auf biologischen Anbau umzusteigen.
Die zweite Veränderung brachte mein Kontakt zum Netzwerk für vitale Landwirtschaft. Dort habe ich 2011 Studien gesehen, die zeigten, dass Äpfel vor 80 Jahren zwei- bis zwanzigmal so viele Nährstoffe enthielten wie die Äpfel von 2011. Die Äpfel von heute sehen oft viel schöner aus, der Ertrag pro Hektar ist großartig, aber es sind leere Kalorien. Das war für mich ein Paradigmenwechsel. Ich dachte, ich würde etwas Gutes tun, aber mir wurde klar, dass ich nur Müll produzierte. Wenn ein Apfelbaum von einem bestimmten Insekt befallen wird, sendet er ein Signal in Form eines Duftes oder einer Substanz aus: „Marienkäfer, kommt und helft mir.”
Was gut für die Abwehrkräfte des Apfelbaums ist, ist auch gut für unser Immunsystem. Deshalb ist es sinnvoll, lokal und saisonal zu essen.
Das war für mich der ethische Grund, biologisch zu wirtschaften: Ich wollte das Richtige tun. 2013 haben wir komplett auf biologischen Anbau umgestellt. Ein paar Jahre später sind wir zu biologisch-dynamischem Anbau übergegangen.
Peter van Stigt: Was ist der Unterschied zwischen biologisch und biologisch-dynamisch?
Raymond Niesten: Biologisch bedeutet — einfach gesagt —, dass man keine Kunstdünger oder Pestizide verwenden darf. Bei biologisch-dynamisch muss man noch näher an der Natur bleiben, man muss die Natur noch mehr wertschätzen. Man darf noch weniger Tiere pro Hektar halten und beispielsweise einer Kuh nicht die Hörner abschneiden, weil man sie als störend oder gefährlich empfindet.
In der Natur hat alles eine Funktion, und es ist nicht Sache des Menschen, zu bestimmen, wie ein Tier auszusehen hat, so lautet die biologisch-dynamische Philosophie.
Die Hörner einer Kuh speichern beispielsweise Reserven, wenn die Kuh kalbt, und sie enthalten Sensoren, mit denen eine Kuh gutes Futter findet. Bei biologisch-dynamischer Landwirtschaft beobachtet man auch die Position der Planeten. Ich versuche, auf meine Stimmung zu achten, denn meine Energie überträgt sich auf meine Pflanzen. Wenn ich selbst im richtigen Gleichgewicht bin, fällt es auch meinen Pflanzen leichter, das richtige Gleichgewicht zu finden.
Auf der Grundlage des Wissens des Anthroposophen Rudolf Steiner, den ich sehr schätze, versuche ich, Homöopathie in der Landwirtschaft anzuwenden. Ich versuche, Präparate für meine Pflanzen herzustellen. All das sind Aspekte, die bei der biologisch-dynamischen Landwirtschaft eine Rolle spielen. Es ist für mich noch ein Lernprozess, der manchmal aus Zeitmangel ins Stocken gerät. Denn die Wirkung eines chemischen Mittels ist sehr schnell sichtbar: Heute sprühe ich gegen Unkraut und morgen ist das Unkraut weg. Die Verwendung von Stickstoff in der konventionellen Landwirtschaft ist ein gutes Beispiel: Stickstoff wird eigentlich als Salz eingesetzt, das die Pflanze dazu zwingt, viel Wasser aufzunehmen. Dadurch wird die Pflanze größer und wir erzielen enorme Erträge. Aber der Nährwert ist gering, denken Sie nur an die Tomate mit dem Spitznamen „Holländische Wasserbombe“. Die Wirkung eines biologischen Präparats ist weniger schnell sichtbar, das kostet also Zeit. Aber die Vitalität einer Pflanze bleibt um ein Vielfaches höher.
In der Pflanzenentwicklung lassen sich zwei grundlegende Lebensprozesse unterscheiden: Wachstum (Massenbildung) und Reifung (Blüten- und Samenbildung; Geschmack und Geruch). Bei vitalen Lebensmitteln herrscht Harmonie oder Gleichgewicht zwischen diesen Lebensprozessen. Diese Harmonie können wir nicht mit bloßem Auge sehen, hören, riechen oder schmecken. Sie zeigt sich nicht oder nur unvollständig in den Inhaltsstoffen, sondern gerade in der Organisation des Produkts selbst.
Ein schönes Beispiel dafür ist ein Experiment, das mit zwei Gurken durchgeführt wurde: Eine biodynamische Gurke und eine „normale“ Gurke wurden in Scheiben geschnitten, in Plastikfolie eingewickelt, in einen „Brutkasten“ bei 18 °C gelegt und nach einigen Tagen wieder herausgenommen. Die „normale” Gurke war vollständig verfault, aber die biodynamische Gurke war wieder zusammengewachsen. Das sagt etwas über die Vitalität der Ernährung aus. Letztendlich erhält man also gesündere Lebensmittel. Wenn man das mit herkömmlichen Lebensmitteln oder, schlimmer noch, gentechnisch veränderten Lebensmitteln vergleicht, bei denen sogenannte „Junk-DNA” herausgeschnitten wird, sind die Unterschiede sehr groß. Der Mensch glaubt, bestimmen zu können, welche DNA funktional ist und welche nicht: „Junk-DNA” soll kein Existenzrecht haben.
In der biologischen Landwirtschaft gehen wir davon aus, dass alles eine Funktion hat. So arbeiten wir mit Fruchtfolge, das heißt, man baut nie zwei Jahre hintereinander die gleiche Kultur auf derselben Parzelle an.
Wenn man das tut, lauert bereits der natürliche Feind dieser Kultur. Wenn man die Kulturen wechselt, sorgt man dafür, dass die natürliche Basis der Kulturpflanze stark ist. Die Bodenqualität ist die Grundlage. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Pflanzen krank werden, müssen Sie eine großzügige Fruchtfolge anwenden, das heißt, dass Sie beispielsweise sechs Jahre warten, bevor Sie dieselbe Kulturpflanze auf derselben Parzelle anbauen. In der Natur gibt es schließlich auch keine Monokulturen, sondern es wachsen immer verschiedene Arten nebeneinander.
Esther van Loo: 1950 entwickelte der niederländische Landwirtschaftsminister Sicco Mansholt, ein überzeugter europäischer Föderalist, einen Plan für eine gemeinsame europäische Agrarpolitik, einen gemeinsamen Markt für landwirtschaftliche Erzeugnisse in Europa, der supranational gesteuert werden sollte. „Nie wieder Hunger und Armut”, versprach Mansholt. Ist etwas von dieser Aussage wahr geworden?
Raymond Niesten: Das ist eine lobenswerte Einstellung, wenn wir davon ausgehen, dass es nur um Ernährungssicherheit ging, aber wir können natürlich die für diese Pläne angeführten Gründe in Frage stellen. Ohne Krieg wären die europäischen Länder durchaus in der Lage gewesen, ihre eigene Lebensmittelversorgung aufrechtzuerhalten. Die Defizite wurden nicht durch mangelnde Produktion verursacht, sondern durch die Instabilität und Zerstörungen, die der Krieg mit sich brachte. Mansholt stellte seine Pläne für eine gemeinsame Politik vor, als er Ende der 1950er Jahre Kommissar für Landwirtschaft in der allerersten Europäischen Kommission wurde. Später diente seine Politik als Inspiration für die Agrarpolitik der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Es wurde versucht, die Politik so zu gestalten, dass nicht die Bedürfnisse der Nationalstaaten, sondern die europäischen Bedürfnisse im Vordergrund standen.
van Loo: Seit Mansholt sind nun etwa 70 Jahre vergangen, und die Landwirtschaft ist zu einem großen Wirtschaftszweig geworden, der von Großkapital gesteuert wird. BASF, Bayer, Cargill, Monsanto — um nur einige zu nennen — bestimmen, was passiert, insbesondere weil sie viel Geld für politische Lobbyarbeit zur Verfügung haben. Was meint ihr, hat diese Politik das Leben der Bauern in den letzten Jahrzehnten verbessert oder verschlechtert?
Raymond Niesten: Ich kann mehr Nachteile als Vorteile aufzählen. Seit der Einführung der europäischen Agrarpolitik mussten einige Länder mehr, andere weniger oder andere Lebensmittel produzieren. Kleine Landwirte sind in dieser Konstellation ineffizient, daher lautet schon seit Jahren das Motto „Vergrößerung der Betriebe”. Kleine Parzellen wurden zu großen Parzellen zusammengelegt, was natürlich negative Auswirkungen auf die Natur hatte, ein mäandernder Bach wurde begradigt, weil ein gerader Bach viel praktischer zu bearbeiten ist. Dadurch wird natürlich die Artenvielfalt beeinträchtigt. Demgegenüber kann man es als Vorteil sehen, dass jetzt weniger Menschen auf dem Land arbeiten müssen, mit großen Maschinen kann man große Flächen mit nur einer Person bearbeiten. Der Arbeitsaufwand ist geringer, die Arbeit ist körperlich leichter geworden, aber die landwirtschaftlichen Betriebe sind kapitalintensiver geworden. So ist es schließlich immer:
Kapital und Arbeit sind kommunizierende Röhren, wenn man mehr von dem einen nutzt, braucht man weniger von dem anderen.
Da das Kapital eine größere Rolle spielt, sind die Landwirte stärker von den Banken abhängig geworden, sie sind weniger frei und gefangen im System. Das Lokale, die menschliche Dimension von früher, ist verschwunden. Die großen Unternehmen, das Kapital bestimmt, was geschieht.
Die Erträge sind zwar gestiegen, aber auch hier erzählen die nackten Zahlen, nicht die ganze Geschichte. Man kann auch mit sehr kleinen Gärten, die man selbst bewirtschaftet, sehr effizient arbeiten.
In den letzten Tagen der Sowjetunion konnten viele Menschen von den Erträgen ihres Gemüsegartens bei ihrer Datscha leben, denn wenn man sich um seine eigenen Lebensmittel kümmert, kann man pro Flächeneinheit hohe Erträge erzielen.
Außerdem werden Erträge rein quantitativ berechnet, es zählen die Kilogramm, nicht die Qualität. Wollen wir eine „Wasserbombe” oder wollen wir eine leckere Bio-Tomate, die Zeit zum Wachsen hatte, ohne übermäßige Düngung und übermäßigen menschlichen Eingriff?
Die Niederlande sind zwar einer der größten Lebensmittelexporteure der Welt, aber diese Zahl basiert ausschließlich auf der Wertschöpfung. Fleisch beispielsweise wird als „niederländisches” Produkt exportiert, aber tatsächlich niederländische Kühe und Schweine mit billigem Getreide aus Brasilien gemästet. Das verkaufte Fleisch wird in die niederländische Exportbilanz aufgenommen. Das brasilianische Futter ist vielleicht 1 Euro wert, während das Endprodukt Fleisch vielleicht das Zehnfache wert ist. Wie immer stellt sich also die Frage: Was sagen diese Zahlen und Statistiken eigentlich aus? Ist das fair? Unfair ist auch, dass Überschüsse mit Subventionen für europäische Landwirte beispielsweise in afrikanischen Ländern gedumpt wurden, wodurch die Landwirte dort keine faire Chance hatten, ihre Produkte zu verkaufen.
Hinzu kommen noch alle Vorschriften, die insbesondere in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen sind und die Arbeit der Landwirte viel komplexer als früher machen. Die Vorschriften werden zum großen Teil von finanzstarken Unternehmen bestimmt, die Einfluss auf die Politik nehmen. Trotz der europäischen Politik gibt es sehr große Unterschiede zwischen den Ländern. Die Niederlande sind beispielsweise sehr streng in Bezug auf Stickstoffemissionen (basierend auf falschen Modellen), aber wenige Kilometer über die Grenze in Belgien oder Deutschland sind die Vorschriften viel lockerer.
Auch für Biobauern sind die Stickstoffmaßnahmen nicht sinnvoll. Viehzuchtbetriebe, die Tierdung produzieren, dürfen kaum noch existieren, aber als Biobauer bin ich auf ihren natürlichen Dünger angewiesen. Konventionelle Landwirte hingegen dürfen Kunstdünger kaufen, obwohl das Stickstoffproblem gerade durch diesen Kunstdünger verursacht wird. Durch die Stickstoffmaßnahmen verschwinden die Kühe hier in Limburg von den Hängen, obwohl gerade auf den Hängen Gras wachsen soll. Diese Hanglagen werden von kapitalkräftigen Ackerbaubetrieben aufgekauft, die dann auf solchen Hängen Kartoffeln anbauen wollen. Sie pflügen diese Wiesen um, und selbstverständlich ist nach ein paar Regenschauern der gesamte Boden erodiert.
Was ist nun die Folge davon? Wir bekommen Maßnahmen gegen das Pflügen, denn das Pflügen wäre „angeblich“ für die Erosion verantwortlich. So häufen sich die falschen Entscheidungen.
Wann ich pflügen darf, das entscheidet Brüssel, und zwar anhand der sogenannten „Kalenderlandwirtschaft”, obwohl man als Landwirt nicht vom Kalender, sondern vom Wetter abhängig ist.
Im Januar muss ich angeben, dass ich im April pflügen möchte. Brüssel will, dass ich im Frühjahr dünge, während die natürliche Düngungsperiode in der Natur eigentlich im Herbst ist, wenn die Blätter von den Bäumen fallen. Die Regierung kann verlangen, dass ich eine App herunterlade, mit der ich mich selbst kontrollieren muss, Fotos mit Geolokalisierung mache, die beispielsweise zeigen, wie tief ich gepflügt habe und so weiter. So wird man in einem totalitären System manipuliert, in dem man außerdem gezwungen ist, sein eigener Kontrolleur zu sein. Ich versuche, die Nutzung dieser App so lange wie möglich zu vermeiden. Wenn man beim unrechtmäßigen Pflügen erwischt wird, kann die Regierung beispielsweise einfach die Subventionen streichen.
Die Vorschriften machen die Betriebsführung sehr komplex, worauf große Unternehmen leichter reagieren können, da sie dazu Buchhalter beschäftigen. Aber für einen kleinen Betrieb wie meinen ist das nicht machbar. Meiner Meinung nach ist ein biologisches System mit etwa zwei oder drei Kühen pro Hektar am besten. Ein natürliches System begrenzt sich selbst, es ist von Natur aus im Gleichgewicht. Dies wurde durch die Globalisierung, die Vergrößerung der Produktionsskala und die Technologie aufgegeben, was dazu geführt hat, dass es heute an einigen Orten der Welt Nährstoffmangel und an anderen Nährstoffüberschuss gibt. Dadurch entstehen Umweltprobleme, die mit Regeln wieder in den Griff gebracht werden müssen. Probleme, die es nicht gegeben hätte, wenn eine andere Politik betrieben worden wäre.
Van Stigt: Was ist der Unterschied in der Existenzsicherheit zwischen einem „normalen” Landwirt und einem Biobauern?
Raymond Niesten: Nun, erstens hätten wir nie einen Gülleüberschuss, wenn alle Landwirte Biobauern wären, denn ein Biobauer darf maximal eine bestimmte Anzahl von Tieren pro Hektar halten, wodurch automatisch ein Gleichgewicht entsteht. In einem biologischen System düngen Schweine und Kühe das Stück Land, auf dem sie leben. Dann wird nichts überlastet, weder die Tiere noch der Boden. Die großen Geldgeber wollen eine unbegrenzte Anzahl von Tieren pro Quadratmeter. Was wir jetzt sehen, ist, dass die intensive Viehzucht in den Niederlanden verboten wird, aber dann verlagert wird, beispielsweise in die Ukraine. Durch diese Konzentration auf große Unternehmen ist es natürlich einfach, die Lebensmittel zu kontrollieren, die in den Läden angeboten werden.
Van Loo: Wenn Ihr nicht biologisch, sondern konventionell wirtschaften würdet, wärt Ihr dann viel reicher?
Raymond Niesten: Ein bisschen reicher denke ich schon. Ein Beispiel: Unkraut ist wirklich ein großes Problem. Eine Vergrößerung ist viel einfacher, wenn man konventionell wirtschaftet. Wenn man ein größeres Grundstück kauft, das man unkrautfrei halten möchte, muss man nur eine größere Spritze anschaffen und kann mit relativ geringen Kosten und fast ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand einen viel höheren Ertrag erzielen. Wenn hingegen ein Biobauer wachsen möchte, bedeutet dies einen zusätzlichen Zeit- und Arbeitsaufwand, was viel mehr Geld kostet. Hinzu kommt, dass in den letzten 80 Jahren viel Wissen verloren gegangen ist, weil in den letzten Jahrzehnten alles Wissen in die Chemie und nicht in natürliche Verfahren geflossen ist. Ich habe daher viel Lehrgeld bezahlt, um mir all das Wissen anzueignen, das früher normal war. Allerdings nähern wir uns einem Wendepunkt, da die Gesellschaft bewusster wird. Ein Beispiel dafür ist die derzeitige Diskussion, rund um die Städte in Limburg nur noch biologische Landwirtschaft zuzulassen. Das wäre für mich von Vorteil, wenn ich Land pachten möchte.
Van Stigt: Wo kauft Ihr Saatgut?
Luc Niesten: Bei Bio-Betrieben. Aber es wird immer schwieriger, gutes Saatgut zu bekommen.
Die Saatgutveredelungsunternehmen setzen zunehmend auf Hybridsaatgut, also Saatgut, das unfruchtbar ist, sodass man als Landwirt sein Saatgut nicht selbst vermehren kann und immer wieder neues Saatgut kaufen muss.
Dazu kommt, dass es immer weniger, immer größere Unternehmen gibt, die Saatgut produzieren, diese Machtkonzentration ist natürlich ungünstig. Das ist übrigens ein weiterer Unterschied zwischen biologisch und biologisch-dynamisch: biologische Landwirte dürfen mit Hybridsaatgut arbeiten, biodynamische Landwirte jedoch nicht. Diese müssen mit sortenfestem Saatgut arbeiten. Sind Gemüse, die aus Hybridsaatgut wachsen, für Mensch und Tier gesund? In der Natur kann sich eine Pflanze immer auf normale Weise vermehren, wenn nicht, stirbt sie aus. Derzeit können wir die Folgen all dieser Manipulationen, die euphemistisch als „Veredelung” bezeichnet werden, noch gar nicht abschätzen.
Van Loo: Erhaltet Ihr Unterstützung von der Regierung? Kann ein Landwirt überhaupt ohne Subventionen überleben?
Raymond Niesten: Viel weniger als gerechtfertigt wäre. Das ist eigentlich lächerlich, denn wir belasten die Umwelt weniger und sollten dafür eine Entschädigung erhalten. Früher erhielten Landwirte einen festen Preis pro Produktion. Aber als wir im 20. Jahrhundert so viel Überproduktion hatten, wurden die Subventionen zu hoch und dieses System war nicht mehr tragbar. Tatsächlich erhalten wir für unsere Produkte zu wenig Geld. Unser Betrieb könnte ohne Subventionen kaum überleben. Was wir bekommen, ist ein Festbetrag pro Hektar. Aber um diese Subventionen zu erhalten, müssen wir eine Menge Hürden nehmen. Es sind immer mehr Bedingungen und Anforderungen seitens Europas damit verbunden.
Außerdem gerät man dadurch in eine Abhängigkeit, das ist frustrierend. Wer biologisch wirtschaftet, hat einen Vorteil, weil Organischer Landbau die Anforderungen teilweise bereits automatisch erfüllt. Ich bekomme also nicht so viel, aber andererseits muss ich nicht so viele formelle Anforderungen erfüllen wie reguläre Landwirte. Immerhin bedeuten die Ausarbeitung all dieser Regeln und ihre Durchsetzung eine Menge Arbeit und einen Anstieg der Bürokratie.
Van Stigt: Stimmt die Aussage, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb derzeit eigentlich keine Möglichkeit hat, autonom zu funktionieren, unabhängig von Zulieferern, der Regierung und so weiter? Ist die einzige Möglichkeit für diejenigen, die Lebensmittelautonomie wollen, der Eigenanbau?
Raymond Niesten: Das kann man so sagen, ja. Wenn ich zum Beispiel meine Kartoffeln verkaufen möchte, bringt es mir nichts, bei einem örtlichen Supermarkt anzuklopfen, denn der kauft zentral bei einem Handelshaus irgendwo weit weg ein. Die Einkaufsleiter all dieser Supermärkte treffen sich natürlich manchmal, um Preisabsprachen zu treffen. Das ist gesetzlich verboten, aber ich schließe nicht aus, dass es trotzdem geschieht. Darüber hinaus sind wir natürlich auch in Bezug auf Technik, Traktoren, Maschinen, Kraftstoff, Energieversorgung, GPS-Software, Infrastruktur und Ausgangsmaterialien wie Saatgut oft von anderen Unternehmen und Behörden abhängig.
Van Stigt: Wie sieht die Zukunft aus?
Raymond Niesten: Wir hoffen natürlich, dass je mehr Menschen sich der Nachteile konventionell produzierter Lebensmittel bewusst werden, desto mehr wird der ökologische Landbau wachsen. Ich denke, dass darin die Zukunft liegt. Eine Kuh frisst normalerweise Gras und nicht Mais oder Soja, denn diese beiden Futtermittel fördern Entzündungen, die sich wiederum im Fleisch niederschlagen. Eine Kuh, die grast, liefert gesünderes Fleisch, mit einem besseren Omega-3/6-Verhältnis zum Beispiel. Immer mehr Menschen erkennen, dass diese ungesunde Ernährung zu Krankheiten wie Fettleibigkeit führt. Man muss immer mehr essen, um seinen Nährstoffbedarf zu decken. So gesehen ist das Argument, dass die biologische Landwirtschaft teuer sei, Unsinn, denn man könnte Milliarden an Gesundheitsausgaben einsparen, wenn die Menschen sich gesund ernähren würden.
Gleichzeitig sehe ich aber große Gefahren. Alles gerät in die Hände des Großkapitals, egal ob es um Urlaub, Computer oder sonst etwas geht. Die Lebensmittelproduktion liegt noch relativ stark in den Händen kleiner landwirtschaftlicher Betriebe. Ich sehe einen Trend, dass immer mehr große Unternehmen darauf aus sind, Lebensmittel in Fabriken zu produzieren. Das ist eine Goldgrube, man ist nicht vom Wetter abhängig, man kann seine Pflanzen mit LED-Beleuchtung wachsen lassen, man kann alles robotisieren. So behalten sie die Kontrolle über die Ernährung und die Bevölkerung.
Außerdem besteht die Gefahr der Großflächigkeit darin, dass beispielsweise große Saatgutlieferanten nur wenige Sorten anbieten. Dadurch verschwindet die Artenvielfalt, was uns verwundbar macht.
Im Extremfall könnte dies bedeuten, dass wir kein Mehl mehr haben würden, wenn nur die eine übrig gebliebene Getreidesorte krank werden würde. Je vielfältiger das System ist, desto robuster ist es, wenn Probleme auftreten. Zudem gefährdet uns die Abhängigkeit von großen Unternehmen, weil sie aufgrund ihrer Monopolstellung viel zu hohe Preise verlangen können. Wenn wir selbst Ausgangsmaterial vermehren können, haben wir mehr Freiheit und sind weniger abhängig.
Van Loo: Wäre eine Zukunft denkbar, in der die Bürger ihre eigene Einkaufsorganisation aufbauen, ohne dass Supermärkte dazwischenstehen?
Luc Niesten: Das muss gut durchdacht werden. Wenn ich als Landwirt Kartoffeln direkt an den Verbraucher liefere, kommt es zu enormen Schwankungen, denn als Kleinbauer kann ich nicht das ganze Jahr über gute Kartoffeln anbieten. Aus Sicht der Verbraucher ist das derzeitige System einfach, denn sie können das ganze Jahr über einkaufen, was sie wollen. Die Supermärkte mit ihren großen Unternehmen streichen die großen Gewinne ein und der Landwirt geht leer aus. Was wir brauchen, sind bewusste Verbraucher, die verstehen, dass sie nicht zu jeder beliebigen Zeit des Jahres alles kaufen müssen.
Ich stelle auch einen großen Unterschied zwischen ernährungsbewussten Bürgern und den „normalen“ Konsumenten fest. Viele Bürger beschäftigen sich mit Klima und Umwelt, aber oft bleibt es bei Lippenbekenntnissen. Wenn es ums Bezahlen geht, verwandelt sich der Bürger sofort in einen Konsumenten. Der Konsument sollte sich der Macht bewusst sein, die er hat: Wenn wir ab jetzt, beispielsweise nicht mehr zu McDonalds oder Kentucky Fried Chicken gehen würden, wären sie innerhalb einer Woche bankrott.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .