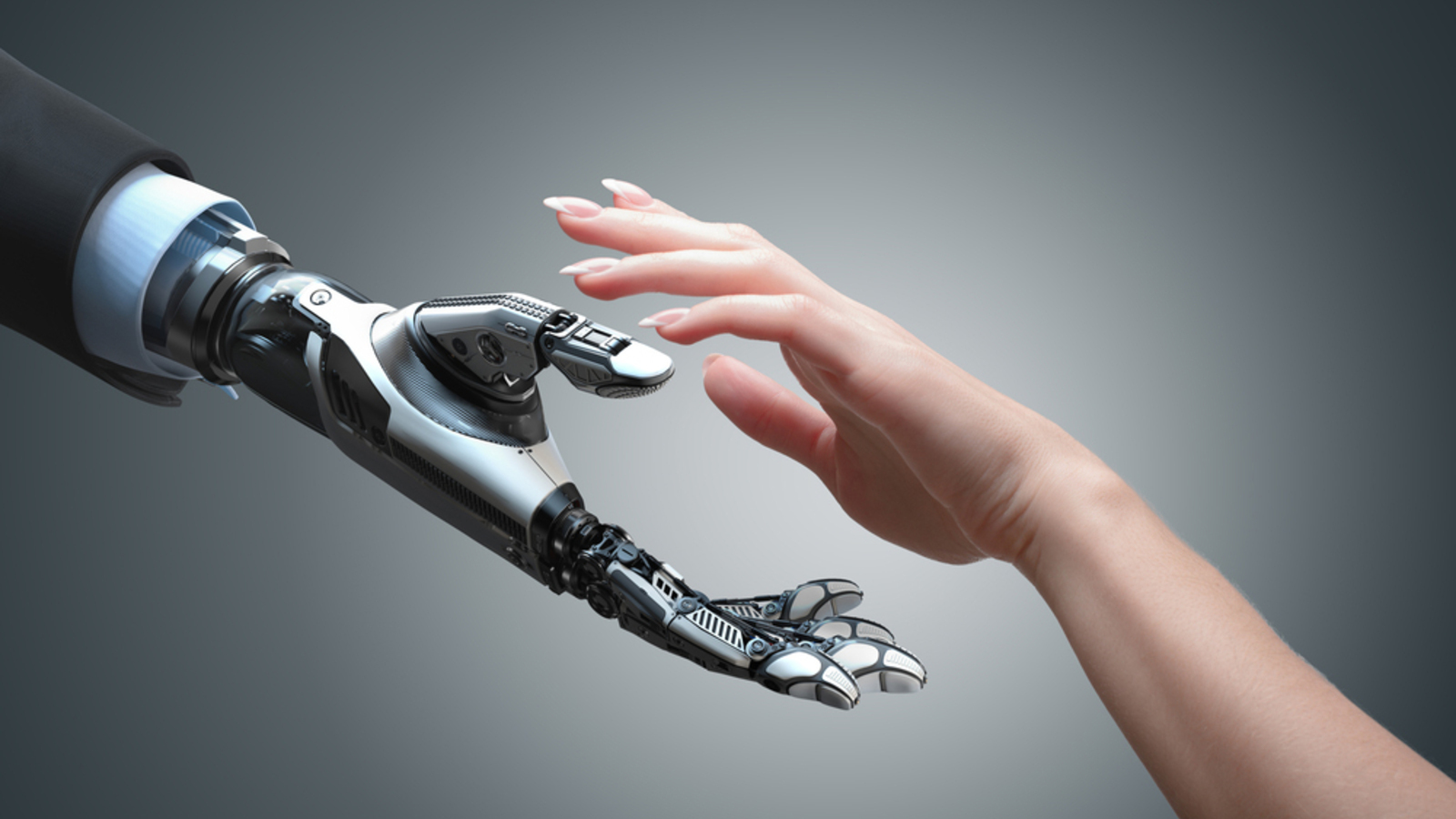Das Phänomen des Lebens
Die Existenz eines Bewusstseins in einem künstlichen Gebilde lässt sich nicht ohne Weiteres widerlegen, so wie sich generell keine Nicht-Existenz empirisch beweisen lässt. Doch wir erkennen so viele fundamentale Unterschiede zwischen belebten Wesen und unbelebten Maschinen, dass ein bewusstes Erfahren bei Letzteren zumindest als so gut wie ausgeschlossen erscheint. Dafür deuten wir uns selbst nicht mehr nach Analogie der von uns geschaffenen Maschinen, sondern betrachten, was wir wirklich sind und tun:
Wir sind zunächst einmal Lebewesen,
die um ihrer selbst willen existieren und die auf ihre Selbsterhaltung ausgerichtet sind;(1)
die als Leib existieren, durch den sich die Umwelt physisch in eine Innen- und eine Außensphäre gliedert, der, solange er sich nicht durch die Erfahrung des Schmerzes in den Vordergrund drängt, als Hintergrund aller unserer Welterfahrung dient, die als Organismen also ganz wesentlich durch die Haut (Membran, Panzer, etc.), durch eine Grenze — eine Abgrenzung von einem Außen – existieren(2);
die primär auf die Aufrechterhaltung des leiblichen Gleichgewichts, unter Umständen sein Wachstum und seine Fortpflanzung, ausgerichtet sind — was auch der Zweck des zentralen Nervensystems ist (3);
die sich als organisierte, integrierte, zwecksetzende, spontane Einheit auf ihre Umwelt beziehen (dies der Ursprung der Subjektivität als Bezugspunkt der unteilbaren Einheit — der „Monade“);
die sich auf menschlicher Ebene nicht nur auf eine dingliche Umwelt beziehen, sondern eine soziale Mitwelt gleichartiger Individuen erschaffen und somit eine gemeinsame Welt (im Sinne Hannah Arendts als Gemeinschaft von in Freiheit handelnden Wesen) hervorbringen (4);
die sich wiederum als Menschen selbst eine Geschichte, eine Biografie geben, wesentlich als neuer Anfang, Ursprung, Impuls in diese Welt gekommen sind (Hannah Arendt prägte hierfür den Begriff der „Nataliät“ als Pendant zur Mortalität oder Heideggers „Sein zum Tode“);
die sich als Menschen ihrer Endlichkeit bewusst sind;
und die schließlich (wiederum bloß als Lebewesen) nicht einfach kaputt gehen, sondern irreversibel sterben (5).
Dies ist der sprichwörtliche „Elefant im Raum“, die vernachlässigte Größe und der Grundirrtum, an dem alle neueren materialistischen und mechanistischen Bewusstseinstheorien scheitern: Sie versuchen, das Bewusstsein als Informationsverarbeitungsprozess zu erklären, übersehen dabei jedoch, dass es ein Subphänomen des Lebens sein könnte, das sie mit ihren Mitteln nicht verstehen können.
Dieser Mangel betrifft nicht allein die mechanistische Philosophie, Psychologie und Neurologie, er kennzeichnet die gesamte moderne Biologie und Medizin, die auf der „molekularen Anschauung des Lebens“ beruhen — der reduktionistischen Überzeugung, dass sich das Leben durch physikalische und chemische Prozesse lückenlos beschreiben und beherrschen lasse (6).
Scheitern muss die mechanistische Weltanschauung hier deswegen, weil sie physikalische Zusammenhänge kausal beschreibt, während das Leben ein teleologischer Vorgang ist — gekennzeichnet durch Beziehungen der Zweckmäßigkeit: Alles in einem Organismus hat den Charakter eines „Um-zu“. Dies analysierte Kant bereits in seiner Kritik der Urteilskraft, die sich um diesen Begriff der Zweckmäßigkeit dreht und wo er seine berühmte Feststellung trifft, dass es keinen „Newton des Grashalms“ geben wird (7).
Trotz aller erstaunlichen Leistungen ist die Wissenschaft hier in bald zweieinhalb Jahrhunderten keinen Schritt vorangekommen — weil sie an eine prinzipielle Grenze stößt — auch wenn wir beispielsweise dank der Genetik heute manches beschreiben können, was zu Zeiten Kants noch als völlig rätselhaft erschien.
Wundert sich denn eigentlich niemand, dass die moderne Technik — mit all ihren fantastischen Errungenschaften — das Leben fast beliebig manipulieren kann, aber bis heute noch kein einziges Lebewesen aus toter Materie hervorgebracht hat?!
Bewusstsein als biologische Tatsache
In Die Stufen des Organischen und der Mensch, — dem Projekt einer „philosophischen Biologie“ als einer Beschreibung der Wesensmerkmale oder „Planformen“ des Lebendigen — leitet der Philosoph Helmuth Plessner das Bewusstsein aus der eigentümlichen Stellung des Lebewesens in seiner Umwelt ab:
Das Lebewesen hat einen Leib, mit dem es seine Umgebung wahrnimmt und sich in ihr bewegt. Soweit es eine zentralisierte Organisation hat — wie die meisten Tiere — agiert es aus einem Zentrum heraus, und „Bewusstsein ist nur diese Grundform und Grundbedingung des Verhaltens eines Lebewesens in Selbststellung zur Umgebung“ (8).
Obwohl Plessner hierbei — anders als Husserl oder Merlau-Ponty — nicht phänomenologisch vom subjektiven Erleben ausgeht, sondern materielle Naturwesen objektiv beschreibt, operiert er hier philosophisch-verstehend mit Zweckbeziehungen. Denn das Lebewesen, das sich als Einheit von seiner Umwelt abgrenzt und mit ihr in Beziehung tritt, zielt darauf ab, sich zu erhalten und sich fortzupflanzen. So befreit er sich aus den engen Grenzen (also der Unmöglichkeit das Leben zu verstehen), die eine rein mechanistisch-physikalische Betrachtungsweise auferlegt.
„Jedes Tier ist der Möglichkeit nach ein Zentrum, für welches (...) eigener Leib und fremde Inhalte gegeben sind. Es lebt körperlich in einem von ihm abgehobenen Umfeld oder in der Relation des Gegenübers. Insofern ist es bewusst, es merkt ihm Entgegenstehendes und reagiert aus dem Zentrum heraus, das heißt spontan, es handelt. (9)“
Die Elemente der Zentralität, der Integration verschiedener Wahrnehmungen und Reaktionsmöglichkeiten sowie der Selbststeuerung und Selbsterhaltung begegnen uns in den gegenwärtigen theoretischen Ansätzen, die zu definieren versuchen, unter welchen Bedingungen eine sogenannte KI, ein nicht-biologisches neuronales Netzwerk, so etwas wie Bewusstsein erlangen könnte. So erwartet die „Global Workspace Theory“, dass ein System dann bewusst wäre, wenn es „aus mehreren spezialisierten und parallel arbeitenden Modulen besteht, die Information an einen ‚globalen Arbeitsspeicher‘ weitergeben“, während nach der „Attention Schema Theory“ eine KI dann bewusst wäre, „wenn sie ein Modell enthält, das den Zustand ihrer eigenen Aufmerksamkeit repräsentiert und steuert“; die „Predictive Processing Theory“ hingegen fordert „Rechenvorgänge (...), die zur Sicherung der fortwährenden Existenz der KI beitragen“ und die „Integrated Information Theory“ erwartet Bewusstsein in einem System, „wenn es mehr Information integriert als jedes seiner Teilsysteme“ (10).
All diese Theorien erfassen meines Erachtens korrekt bestimmte Aspekte bewusster Lebensvollzüge, gehen aber dennoch völlig am Wesentlichen vorbei und müssen notwendig scheitern, da sie — für Informatiker sicher naheliegend — Bewusstsein auf Datenverarbeitungsprozesse reduzieren, statt es als Seinsweise leiblich in ihrer Umwelt agierender Lebewesen zu begreifen.
Wirklich anschaulich „vorstellen“ oder genau nachempfinden können wir so ein bloßes Bewusstsein nicht, da für uns Bewusstsein immer mehr oder weniger Selbstbewusstsein oder Ich-Bewusstsein ist. Wie es sich wirklich „anfühlt“ eine Katze, ein Fisch, eine Spinne — oder auch ein Fötus — zu sein, können wir nicht genau sagen; aber beschreiben bzw. wissenschaftlich ergründen lässt sich so etwas dennoch, so wie wir uns das Tesserakt — also den vierdimensionalen Würfel — nicht vorstellen können, da unsere Anschauung auf drei Dimensionen begrenzt ist. Es lässt sich aber dennoch sehr genau beschreiben und bemessen, wir kennen nämlich all seine mathematischen Eigenschaften.
Bewusstsein ist also nur ein Aspekt oder eine Beschreibungsart einer „Positionalität der geschlossenen Form“ (11), die merkend und agierend einem „Umfeld fremder Gegebenheit“(12) gegenübergestellt ist. Plessner spricht hier von der „Frontalität“ des Tieres, einem „Fürsichsein (als Hier-Jetzt ein Fürmichsein), das binnenhaft mit seinem Leib-Körper vor fremden Dingen steht“ (13). Der Übergang vom Merken ins Wirken, der nicht mehr automatisiert und reflexartig, sondern spontan, fehleranfällig und verzögert stattfindet, ist „die Sphäre des Bewusstseins“ (14).
Diese philosophische Analyse passt sehr gut zu unserer Alltagserfahrung, in der angeborene Reflexe und erlernte automatisierte Handlungen zwar bei Bewusstsein, aber mit dem geringsten Grad an Bewusstheit ablaufen, während neuartige Situationen einen viel größeren Grad von „Wachheit“ erfordern, sodass die spontane Zwischensphäre zwischen Merken und Wirken hier besonders erfahrbar wird.
Vielleicht wäre es noch für einen Einzeller wahrscheinlicher, Bewusstsein zu entwickeln als für eine „Künstliche Intelligenz“ oder ein „Elektronengehirn“, das wesentlich weder das eine noch das andere, also weder Intelligenz noch Gehirn ist, da es nicht denken und nicht spontan handeln kann und vor allem, da es nicht lebendig ist (15).
Der Mensch als Naturwesen und Teil des Tierreichs
Es gibt naturwissenschaftliche Ansätze, die neurologische Vorgänge objektivierend, also „von außen“ betrachten, sie aber zu unserem subjektiven Erleben so in Beziehung setzen, so dass sich zumindest gewisse Vermutungen über Lebewesen, die wir nicht nach ihrem subjektiven Erleben fragen können, anstellen lassen. Ganz im Sinne von Plessners „Frontalität“ des sich in einer Umwelt verhaltenden Tieres ist Bewusstsein hier eine Funktion des Wahrnehmens und aktiven Reagierens, was wir in der Narkose, im traumlosen Tiefschlaf und im Koma nicht vermögen. Im Wachbewusstsein dagegen können wir Wahrnehmungen lange genug in Erinnerung behalten, um sie miteinander zu vergleichen und daraus im Abgleich mit angeborenen Verhaltensmustern und gemachten Erfahrungen angemessene Reaktionen abzuleiten.
Als physische Seite solcher Vorgänge ließen sich bestimmte Aktivitätsmuster beschreiben, die nur möglich seien, wenn der Thalamus als „Schaltzentrale“ mit der Großhirnrinde verbunden sei. Von daher nehmen Forscher an, dass bewusste Vorgänge schon im Ungeborenen ab der 24. Schwangerschaftswoche möglich seien, davor aber kaum, da die dafür nötigen Strukturen fehlen würden (16). Das ist nun sehr aufschlussreich und mag, was uns Menschen angeht, tatsächlich zutreffen.
Auf das Reich des Lebendigen als Ganzes bezogen, erscheint mir dieser Ansatz jedoch als zu eng. Ich würde demgegenüber vielmehr betrachten, was die Seinsweise eines Lebewesens bezogen auf sich selbst und seine Umwelt ist, so wie Plessner es in seiner „philosophischen Biologie“ getan hat. Dabei halte ich es für wichtig, das zu berücksichtigen, was Biologen als „konvergente Evolution“ bezeichnen.
Das bedeutet, dass unabhängig von der genetischen Grundlage und dem Grad der Verwandtschaft ähnliche Umweltbedingungen und Anforderungen zu ähnlichen „Lösungen“ im Sinne von Anpassungen, Strukturen, Bauplänen, Verhaltensweisen, Strategien, Leistungen, Seinsweisen führen können. So wurde beispielsweise das Fliegen viermal ganz unabhängig voneinander „erfunden“, nämlich bei Insekten, Flugsauriern, Vögeln und bei Fledermäusen. Die genetischen Grundlagen unterscheiden sich fundamental, wenn Flügel bei den einen aus Auswüchsen des Chitinpanzers, bei den anderen aus knöchernen Gliedmaßen entstehen, die resultierenden Formen, Funktionen, physikalischen Vorgänge und Lebensvollzüge können einander dennoch gleichen, eben „konvergieren“ (17).
Die große Mehrzahl aller Tiere wie auch der Mensch stammen ab von den ersten frei schwimmenden Meerestieren, die sich eine Richtung gaben mit einem Vorne, das mit einem Mund und meist noch mit Augen ausgestattet ist, und einem Hinten, an dem sich das Ende des Verdauungstraktes befindet und oftmals auch eine Art Schwanz zur Stabilisierung der Fortbewegung. Dieser Unterschied zwischen Vorne und Hinten ermöglichte dann eine Spiegelsymmetrie mit einer Rechts-Links-Unterscheidung, weshalb man all diese Lebewesen als „Bilaterien“ (Zwei-Seiten-Tiere) bezeichnet. Egal ob Biene, Regenwurm, Hai oder Mensch — wir zählen alle dazu — selbst der Seestern, bei dem die Symmetrie nicht mehr so deutlich erkennbar ist (18).
Entscheidend ist hier, wie beim obigen Beispiel vom Fliegen, nicht der Verwandtschaftsgrad, sondern die Funktionen mit den daraus resultierenden Strukturen. Die meisten dieser Tiere bewegen sich wahrnehmend durch ihre Umwelt auf der Suche nach Nahrung, Schutz und Regeneration oder nach Geschlechtspartnern. Je genauer man hinsieht, desto mehr Ähnlichkeiten erkennt man, von der Selbstsorge (vor allem Körperpflege, egal ob Fliege, Katze oder Mensch ein wesentlicher Teil des Tagesablaufs) bis zum Umgang mit Gefahren durch Angriff, Flucht oder Starre (19).
Können wir Tiere verstehen?
Zoologen wie Philosophen dürften an dieser Stelle zu Recht vor naiven Anthropomorphismen warnen. Tatsächlich können wir daraus, dass ein Verhalten ähnlich aussieht, nicht schlussfolgern, dass es auch dasselbe bedeutet und sich womöglich sogar gleich anfühlt. Das menschliche Erleben ist so stark von begrifflichem Denken und Selbstbewusstsein geprägt, dass eine Abstraktion davon und ein unverfälschtes Nacherleben nicht-menschlicher Vollzüge normalerweise nicht möglich ist. Hinzu kommt, dass viele Tiere aufgrund ihrer kurzen Lebenszeit viel stärker auf angeborene Verhaltensweisen als auf Lernen und Erfahrung angewiesen sind und daher viele Vollzüge eher „automatisch“ mit einem vergleichsweise geringen Grad an Bewusstheit ablaufen.
Und dennoch gibt es viele Gemeinsamkeiten, da sich unsere Verhaltensweisen aus solchen unserer tierischen Vorfahren entwickelt haben (biologisch „homolog“ sind), sowie Konvergenzen, da sich die Anforderungen der Umwelt gleichen. So scheint es trotz ihres kurzen Lebens für Springspinnen evolutionär sinnvoll zu sein, zur Optimierung ihres Jagderfolges aus Erfahrungen zu lernen, indem sie diese — so wie wir Säugetiere — im Schlaf noch einmal durchleben (20). Sich im Spiegel erkennen zu können, hielt man lange Zeit für ein Alleinstellungsmerkmal des menschlichen Ich-Bewusstseins, bis man es auch bei wenigen Säugetierarten und Vögeln nachweisen konnte; inzwischen beobachtete man diese Fähigkeit überraschenderweise sogar bei Ameisen (21)!
Während wir gleichsam in der Draufsicht Gemeinsamkeiten erkennen, bleibt uns ein direkter Zugang zum tierischen Erleben durch die Überformung mit dem begrifflich-sprachlichen Denken verwehrt. Menschen animistischer Kulturen mögen diesen Zugang noch haben; ebenso von Autismus betroffene Menschen, die aufgrund ihres anderen Verhältnisses zur Dingwelt und zur Sprache in vielen Fällen die Welt mit den Augen eines Tieres betrachten – so wie es die Verhaltensforscherin Temple Grandin vermag (22). Die Schweizer Therapeutin und Dozentin Pascale Karlin berichtet, dass ihr erst im Erwachsenenalter klar zu werden begann, dass die „neurotypischen“ Mehrheitsmenschen, die sie immer für behindert gehalten hat, da ihnen zum Beispiel eine so elementare Fähigkeit wie die Kommunikation mit Tieren völlig abzugehen scheint, umgekehrt sie (also Pascale Karlin) für „behindert“, sich selbst aber für „normal“ halten(23). Den Unterschied (beziehungsweise ihre Nähe zu den Tieren) erklärt sie so:
„Vögel denken wie Menschen mit Autismus in Bildern. Will ich einen Vogel, der sich in ein Haus verirrt hat, befreien, muss ich ihm nur das entsprechende Bild ‚vermitteln‘ und er lässt sich problemlos anfassen und aus dem Haus tragen. Wenn ich mich aber als Ich wahrnehme, funktioniert das nicht, weil dann eine Begrifflichkeit zwischen Ich und Du steht (Buber), und der Vogel zu einem Es wird, also etwas von mir Getrennten. Die Unmittelbarkeit geht verloren und der Vogel bekommt Angst, weil er in einer unmittelbaren Welt lebt. (24)“
Das eröffnet eine ganz neue Perspektive: Im ersten Teil sahen wir, dass die seelische Verbundenheit mit anderen Subjekten eine ursprüngliche Erfahrung ist, unsere Isolation als einzelnes Ich in einer „Außenwelt“ dagegen ein sekundäres philosophisches Konstrukt.
Wenn nun bestimmte Menschen sich ganz natürlich und selbstverständlich mit Tieren verständigen können, so wie diese ja auch untereinander über Artgrenzen hinweg kommunizieren (der Warnruf der Amsel beispielsweise wird von vielen Vogelarten verstanden), so legt mir dies den Schluss nahe, dass auch die seelische Verbundenheit mit anderen Lebewesen das primäre Phänomen ist und keineswegs bloß ein naiver Animismus, zum Beispiel von Hunde- und Katzenfreunden.
Eine subjektblinde Wissenschaft, die nur das seelenlose materielle Universum kennt, führt uns immer wieder in dieselben Aporien (das heißt: in ausweglose Widersprüche): Das ursprünglich Erfahrbare wird zunächst reduktionistisch wegdefiniert, dann scheitert man unausweichlich daran, es nachträglich als Folgeerscheinung der toten Materie zu erklären.
Beseelte Maschinen und entseelte Menschen?
Aus der „harmlosen“ Frage nach dem Hintergrund und dem Realitätsgehalt einiger literarischer (cineastischer) Fiktionen ist nicht nur eine Auseinandersetzung mit bestimmten Annahmen entstanden, die diesen zugrunde liegen;
sondern mehr noch eine Kritik an einem durch philosophische Scheinprobleme, Zirkel- oder Fehlschlüsse, „Abstraktionen“ im Sinne von reduktionistischen Verkürzungen, Verdinglichungen und Subjektvergessenheit geprägten modernen Weltbild;.
Ein Weltbild,
das den Menschen komplett verloren hat —
seinen Bezug auf sich selbst, das Subjekt, welches der Erkenntnisgrund der Welt ist, und den Geist, der ihr einen Sinn verleiht;
seine ursprüngliche Verbundenheit mit allen Menschen und mit allen Lebewesen —
ein Weltbild,
das ihn gleichsam körperlos von den Füßen auf den Kopf gestellt hat, reduziert auf die abstrakteste, dünnste und lebloseste seiner Begabungen —
die einzige, die er seinen Maschinen bislang hat beibringen können: das rechnende Verarbeiten von Daten.
Dieses Weltbild mündet in den Transhumanismus, der zum neuen Kult seelisch verarmter, entleibter, von allen sinngebenden Kreisläufen der Natur wie auch von aller Transzendenz und Spiritualität abgeschnittener Menschen geworden ist. Seelisch bereits tot, scheinen diese panische Angst vor dem ihnen noch verbleibenden physischen Tod, unserer so tröstlichen Endlichkeit zu haben.
Deshalb wollen sie ihm entkommen, indem sie sich einfrieren lassen oder sich als zeitloser Datensatz unsterblich machen — so als wollten sie den Tod, den sie fürchten, durch den Tod, dem sie huldigen, besiegen.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
(1) So beschreibt Ernst Jandl eine tote Fliege in dem Gedicht „morgenfeier 8. September 1977“ sehr treffend als „schwarzen Dings (...) der sich nichts mehr um sich selbst bemüht“, in: Ernst Jandl: Die Bearbeitung der Mütze, Darmstadt und Neuwied 1978, Seite 135.
(2) Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch. Berlin 1975, Seite 100.
(3) Der Neurobiologe Gerald Hüther brachte dies in einer Podiumsdiskussion einmal auf den Punkt mit der Feststellung „Gehirne sind nicht zum Denken da – sie sind da, damit es dem Körper gut geht“.
(4) Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 1960
(5) Menschen sterben, Maschinen gehen kaputt, so der Titel eines Positionspapiers aus den 1990er Jahren zum Wesen maschineller Vorgänge von den Philosophen Stephan Siemens und Klaus Peters vom Kölner „Verein für dialektische Philosophie“.
(6) „Die Idee, dass sich das Leben nur in der Größenordnung 10-6 oder sogar 10‑9 aufklären lässt – die molekulare Anschauung des Lebens –, die Idee, dass die banalsten Mechanismen der Chemie und Physik ausreichen, um die Biologie erschöpfend zu behandeln, dass man an dieser Grenze das Leben ohne das Leben erhellen könnte, dass es keine Grenzen der Manipulation und des Engineerings gibt, die Idee, dass sich der Arzt nicht etwa sinnlich auf den Patienten bezieht, wobei die Wahrheit des letzteren auf dem Spiel steht und es die Sache des Therapeuten ist, ihn zu begleiten, sondern dass er jenem, der sich ihm als versagende Maschine darstellt, die der Reparatur bedarf, bloß Untersuchungen und Moleküle zu verordnen braucht, oder die Idee, dass jede Krankheit ihre Pille erfordert – all das hat sich nicht auf natürliche Weise durchgesetzt.“
Konspirationistisches Manifest, Berlin 2022, Seite 157f.
Durchgesetzt wurden diese Ideologien vielmehr durch die vielen Milliarden Dollars, welche die Rockefeller Stiftung seit 1913 in Forschungsgelder, Geräte, Lehrstühle und Kampagnen gesteckt hat und mit denen sie Realität durch ihre teuren Instrumente definiert hat, die hier nicht als „verdinglichte Theoreme“ (Gaston Bachelard) zu verstehen sind, sondern die umgekehrt die Theorie als „in Logik übersetzte Instrumente“ bestimmen. Ebenda, 162.
(7) Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft (1790), § 75. Im Original heißt es dort: „Es ist nämlich ganz gewiss, dass wir die organisierten Wesen und deren innere Möglichkeit nach bloß mechanischen Prinzipien der Natur nicht einmal zureichend kennen lernen, viel weniger uns erklären können; und zwar so gewiss, dass man dreist sagen kann, es ist für Menschen ungereimt, auch nur einen solchen Anschlag zu fassen, oder zu hoffen, dass noch etwa dereinst ein Newton aufstehen könne, der auch nur die Erzeugung eines Grashalms nach Naturgesetzen, die keine Absicht geordnet hat, begreiflich machen werde: sondern man muss diese Einsicht den Menschen schlechterdings absprechen.“ Das wird nun selten zitiert und noch seltener verstanden. Der Biologe Ernst Haeckel erklärte Darwin zum „Newton des Grashalms“, andere sehen diese Leistung erst mit der neueren Genetik erbracht. Dabei wird übersehen, dass es in Kants Aussage nicht um einen Mangel an empirischem Wissen, sondern um den prinzipiellen Unterschied zwischen kausal-mechanischem und teleologischem Denken geht, weshalb er die Existenz eines „Newtons des Grashalms“ als „ungereimt“ bezeichnet.
(8) Plessner, am angegebenen Ort (a.a.O.), Seite 67.
(9) Ebenda, 240. Plessner gebraucht „Handeln“ hier allgemeiner als Hannah Arendt, vergleiche Anmerkung 4.
(10) Johannes Kleiner und Robin Lorenz: KI mit Bewusstsein? In: Spektrum Spezial Physik, Mathematik, Technik, 2.25, Seite 32. Das Wort „Information“ dürfte eine grammatisch falsche Übersetzung des englischen „information“ sein, einem Kollektivum (Singulariatantum), dem im Deutschen hier der Plural entspräche.
(11) Plessner, a.a.O., Seite 241.
(12) Ebenda, 244.
(13) Ebenda, 245
(14) Ebenda. Hier trifft sich Plessners Analyse mit der von Bjung-Chul Han, die im Zögern ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des Menschen in Abgrenzung von digitalen Systemen sieht; vgl. dazu den ersten Teil des Essays bzw. die Analyse von Nicolas Riedl, Die natürlichen Grenzen künstlicher Intelligenz
(15) So entdeckt der Autor Andreas Weber eine basale Form von Bewusstsein schon in der Chemotaxis des Geisseltierchens. Vergleiche Andreas Weber: Alles fühlt. Mensch, Natur und die Revolution der Lebenswissenschaften. Berlin 2007, zitiert nach Matthias Wenke: Im Gehirn gibt es keine Gedanken. Würzburg 2011, Seite 82f.
(16) Padilla, N., Lagercrantz, H.: Making of the mind. Acta paediatrica 109, 2020, zitiert nach: Christian Wolf: Geburt des Bewusstseins, in: Spektrum der Wissenschaft. Gehirn&Geist, Nr. 6/2025, Seite 19.
(17) Ein weiteres Beispiel, um den Begriff der Konvergenz in Abgrenzung zur Verwandtschaft in gemeinsamen Ordnungen, Klassen oder Stämmen zu illustrieren: Eine Spinne hat Augen, Beine sowie Taster (Pedipalpen) und Kieferklauen (Cheliceren), die sie in ähnlicher Weise gebraucht wie andere Tiere ihre Hände. Sie ist daher in ihren Lebensvollzügen den Wirbeltieren viel näher als zum Beispiel den Spulwürmern, die im Nahrungsbrei lebend weder Augen noch Beine oder andere Extremitäten benötigen, die den Gliederfüßern aber als so genannte Häutungstiere (Ecdysozoa) stammesgeschichtlich viel näherstehen. Vergleiche Manfred Grasshoff: Die Evolution der Tiere, 5. Aufl., Stuttgart 2018, Seite 28.
Höhere kognitive Leistungen kommen in ganz unterschiedlichen Stämmen und Klassen des Tierreichs vor, haben sich also immer wieder unabhängig voneinander entwickelt und sind weitgehend unabhängig von der Größe des Gehirns. Einschlägig erforscht sind außer Primaten auch Delfine, Rabenvögel und Oktopusse. Es gibt aber auch die erstaunlichsten Beispiele bei Spinnen und Ameisen (siehe Anmerkungen 20 und 21).
(18) Ebenda, 38 – 40.
(19) Die Körperpflege, hier einer Hauswinkelspinne Eratigena atrica, ist schön zu sehen in diesem beeindruckenden Video der großartigen Tierfilmerin Julia Rieger auf ihrem Kanal insektenmakrofilme.
Die Spinnen sind immer wieder für Überraschungen gut. So erweitern sie diese universalen Reaktionsweisen auf Gefahr, die ja auch auf den Menschen zutreffen, um eine vierte Kategorie: Das Unsichtbarwerden nicht durch Erstarrung, sondern im Gegenteil durch schnelle Bewegung, siehe das namengebende Verhalten der bekannten Zitterspinne (Pholcus phalangioides) so als seien sie den Menschen näher, die ja gelernt haben, die drei basalen, instinkthaften Reaktionsweisen durch raffiniertere, kulturelle wie etwa Täuschung und Ablenkung zu ergänzen. Und auch beim Fliegen gehen sie einen Sonderweg, indem sie sich nicht mittels Flügeln in die Lüfte erheben, sondern durch elektrostatisch geladene Seidenfäden.
(20) Daniela C. Rößler et al.: Regularly occuring bouts in retinal movements suggest an REM-like state in jumping spiders, in PNAS, 08.08.2022:
Im Übrigen berichten erfahrene Spinnenhalter übereinstimmend, dass selbst Individuen derselben Art ganz verschiedene Konstitutionen und Tendenzen aufweisen können – etwas, das wir nach Analogie zu uns Menschen als „Persönlichkeit“ bezeichnen: von ängstlich bis neugierig, von träge bis nervös.
(21) Forscher der Freien Universität Brüssel versahen Ameisen der Art Myrmica mit einem Farbpunkt auf dem Kopf und setzten sie sowohl vor Spiegel als auch vor durchsichtige Glasflächen. Nur vor dem Spiegel betrachteten sie ihr Spiegelbild interessiert und begannen sich zu putzen, unternahmen aber keine Versuche, ihr Spiegelbild zu berühren (was solche Tiere tun, die im Spiegelbild fälschlich Artgenossen vermuten). Kontrollgruppen ohne Punkt putzten sich nicht, da sie nichts Ungewöhnliches im Spiegel sahen. Vergleiche Marianne Taylor: Wie Tiere denken, Hildesheim 2024, Seite 132.
(22) Vergleiche Temple Grandin: Animals in Translation. Using the Mysteries of Autism to Decode Animal Behavior, New York 2009.
(23) Pascale Karlin: Das fragile Gleichgewicht zwischen Sein und Nichtsein. Eine Innensicht des Autismus, Frankfurt am Main 2020, Seite 52, genauso lesenswert von derselben Autorin: Die unmittelbare Begegnung mit der Welt. Autismus neu verstehen, Frankfurt am Main 2021.
(24) Karlin, Das fragile Gleichgewicht, a.a.O., 53.