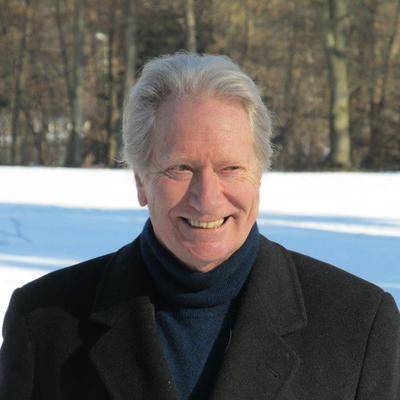Man konnte ihm vieles nachsagen, aber nicht, dass er unpünktlich war. Er fand sich bereits um halb acht an der Stätte seiner Weihe ein, denn als solche hatte er die gestrige Zeremonie empfunden. Moorea hatte den schwarzen Wolkenhut aufgesetzt und blickte durch einen Regenschleier auf den von der Sonne gesprenkelten Ozean. In der Bucht zogen Dutzende von Kanus ihre Bahn.
Die Tahitianer trainierten für das Heiva-Fest, wo sie gegen die Konkurrenz von den anderen Südseeinseln antreten mussten. Anlässlich dieses Festes kamen sie von überall her, aus West-Samoa, den Fidschis oder von den Marquesas. Cording bewunderte die eleganten, kräftigen Armzüge, mit denen die Frauen und Männer ihre Boote bei gleich bleibend hoher Geschwindigkeit durchs Wasser zogen. Irgendwo da unten lag sein Stein. Inzwischen wusste er, welchen Wunsch er ihm hätte mit auf den Weg geben sollen. Er wünschte sich, dass die Tahitianer Omais ökologische Radikalkur als Genesungsschmerzen begriffen, und nicht in den Sumpf des egoistischen Konsumrausches zurückfielen.
„Iaorana.“
Cording hatte Maeva nicht kommen hören. Er blickte auf die Uhr: viertel vor acht. Wie er inzwischen wusste, war es auf Tahiti ein Gebot der Höflichkeit, zu einer Verabredung früher zu erscheinen als vereinbart. Damit signalisierten man, wie sehr man sich auf das Treffen freute. Diesmal hatte er allerbeste Karten.
„Was haben Sie heute mit mir vor?“, fragte er.
„Wir werden gemeinsam um die Insel reisen. Komm.“
Wie zuvor Uupa duzte auch Maeva ihn ganz selbstverständlich. Cording selbst zog es vor, beim Sie zu bleiben, auf diese Weise schaffte er ein wenig Distanz, was ihm angesichts seiner Gefühlslage dringend geraten schien. Er folgte Maeva die steile Straße hinunter nach Mahina. Der Marktplatz war zur vorläufigen Endstation des Reva-Tae umgebaut worden, ohne dass auch nur einem der alten Bäume Schaden zugefügt worden wäre, zwischen denen die gläsernen Kabinen aufgereiht waren. In unregelmäßigen Abständen setzten sie sich auf der in die Fahrbahn eingelassenen Magnetspur in Bewegung.
„Der Reva-Tae funktioniert auf Anforderung“, erklärte Maeva, als sie in einer der geräumigen Kabinen Platz genommen hatten.
Neben der Tür war ein Display eingelassen, auf dem die 62 Stationen verzeichnet waren, die man auf dem hundertzwanzig Kilometer langen Rundkurs ansteuern konnte. Maeva gab die Endstation Faaa ein sowie die Anzahl der zugestiegenen Personen: zwei.
„Jeder Passagier ist gehalten, diese Information zu löschen, wenn er aussteigt“, sagte sie. „Auf diese Weise erkennt das System, über welche Kapazitäten die einzelnen Schiffchen verfügen.“
Schiffchen. Was für ein schönes Wort für etwas, das man in Deutschland wohl als Einhit oder ‚Unit’ bezeichnet hätte. Raumschiffchen wäre noch treffender gewesen. Denn wie im Raumschiff fühlte es sich an, als sie an der Küstenlinie sanft dahin glitten. Maeva hatte das Glasverdeck geöffnet. Zu ihrer Linken lag das schäumende Meer, das sich an den Korallenriffen brach, zur Rechten breitete sich der schwarzgrüne Dschungel bis an die Füße der mächtigen Berge aus. Auf dem schmalen, mit einem leuchtend grünen Rasen bewachsenen Uferstreifen, reihten sich in lockerer Folge die Häuser der Tahitianer. Cording hatte die spärlich besiedelte Nordküste schon damals der weitaus belebteren Südküste vorgezogen. Obwohl dies die Sonnenseite der Insel war, hatte der Tourismus auf den fünfzig Kilometern zwischen Mahina und Taravao keine Chance gehabt. Die Berge sparten nur wenige schmale Täler aus, es gab keinen Platz für luxuriöse Gettos, in denen die albernen Bedürfnisse einer ignoranten, abgewirtschafteten Klientel aus dem fernen Europa befriedigt werden konnten.
Cording überlegte, was das Gesicht der Insel so drastisch verändert hatte, abgesehen von den gläsernen Eiern des Reva-Tae und dem extrem ausgedünnten Autoverkehr. Die Veränderung, die er zu spüren glaubte, reichten tiefer und ließen sich nur bedingt an Äußerlichkeiten festmachen. An den Häusern vielleicht, die von ihren Wellblechdächern befreit worden waren, welche im Sommer wie durchlässige Hitzeschilder auf die Stimmung gedrückt hatten, während die Menschen heute unter Pandanus-Geflecht und Kokoswedeln wieder frei aufatmen konnten. Die Strommasten mit ihren tief hängenden Leitungen waren ebenfalls verschwunden. In dem Dörfchen Tiarei und später in Mahaena sah er, dass die traditionellen Versammlungshäuser wieder im Mittelpunkt der Gemeinden standen. Unter den von Säulen gestützten, tief hängenden Dächern trafen sich die Menschen zum Reden, zum Feiern oder um Streitigkeiten zu schlichten, wie er von Maeva erfuhr.
Die Geschwindigkeit, mit der sie sich auf der vorgezeichneten Spur um die Insel bewegten, war moderat, sie betrug zwischen vierzig und fünfzig Stundenkilometer. Ab und zu lagen Hunde auf der Strecke, die nur müde blinzelten, wenn sich der Reva-Tae näherte und sich erst im allerletzten Moment trollten. Cordings Blick fiel auf die Namensschilder der Flüsschen, die sie überquerten: Orofara, Maemaearohi, Vaiorama. Sie klangen wie Botschaften aus einer anderen Welt. In den flachen Gewässern ihrer Mündungen waren Boote aufgebockt, als könnte man ihnen die Schaukelei im Wasser nicht endlos zumuten.
Kurz vor Hitiaa gab es eine elektronische Anfrage. Maeva drückte auf das Display, um die Expressfahrt zu unterbrechen. Wenig später scherte ihr Schiffchen aus und dockte an einer Haltestelle an. Zwei etwa siebenjährige Knaben stiegen zu und gaben routiniert ihr Fahrtziel ein. Auf den nächsten Kilometern drückten sie sich an der Scheibe die Nasen platt. Sobald der Reva-Tae einen der Wasserfälle passierte, die sich über ausgewaschene Granitfelsen aus großer Höhe in die Tiefe stürzten, hüpften sie auf der Stelle und stießen spitze Schreie aus. An der nächsten Station sprangen sie hinaus. Faaone. Dies war der Ort, an dem Gauguin seine junge Geliebte gefunden hatte.
In Taravao auf der zwei Kilometer langen Landbrücke, die Tahiti-Nui mit dem kleineren Tahiti-Iti verband, war kräftig aufgeräumt worden. Wo sich einst die Baracken der französischen Garnison befunden hatten, stand jetzt nur noch die alte Festung, ein Überbleibsel aus dem Krieg, den die Franzosen 1844 gegen die einheimische Bevölkerung vom Zaun gebrochen hatten. Nicht weit entfernt befand sich eine von Palmen umsäumte Biogasanlage. Auf der anderen Straßenseite verbiss sich ein Bagger in die Restbestände eines Champion-Supermarktes. Die weiße Holzkirche, eine rührende Nachbildung von Notre Dame, wurde damit ihren lästigen Nachbarn los und fand zu alter Würde zurück. Die Shell-Tankstelle und der angrenzende Schrottplatz waren ebenso verschwunden wie die Bankfiliale, vor der sich jeden Morgen lange Schlangen gebildet hatten. Der Blick auf die sanft ansteigenden Hügel der „kleinen Normandie“, wie die Franzosen die landwirtschaftliche Nutzfläche auf Tahiti-Iti genannt hatten, wurde nicht länger von Imbissbuden und Werbetafeln verstellt. Auch die malerische Phaeton-Bucht kam wieder zu ihrem Recht, sie leckte zufrieden am Ufer wie ein Hund, dem man die lästigen Läuse aus dem Pelz geklaubt hatte. Anstelle protziger Motoryachten dümpelten nun zierliche Pirogen auf dem stillen Wasser.
Cording war von dem Rückbau beeindruckt. Die Zeugnisse einer manipulierten Lebensführung waren radikal getilgt worden, und niemand schien ihnen nachzuweinen.
„Bei uns hätte man euch dafür die Köpfe abgerissen“, bemerkte er auf deutsch und mit Blick auf die imposanten Bambushaine rund um das Gauguin-Museum und den Botanischen Garten. Maeva sah ihn forschend an. Als er nicht antwortete, schwang sich ihre linke Augenbraue fragend auf.
„War nicht weiter wichtig“, sagte er, immer noch auf deutsch. Sie schien aber weniger am Inhalt seiner Worte interessiert zu sein, als vielmehr an dem Klang der fremden Sprache. „Heil der kindlichen Unwissenheit“, deklamierte Cording in gespielter Theatralik, „welche uns die entsetzliche Gefahr nicht gewahr werden lässt ... Novalis.“
„Ah N o — v a — l i s ...“ sagte sie mit ihrer unnachahmlich sanften, dunklen Stimme, dabei zog sie das Pseudonym des Freiherrn in die Länge wie eine Zauberformel. „Wie nennt ihr die Leute, welche die Einheit zwischen Natur und Geist einfordern? Romantiker?“
Omai musste ihr von Cordings Lieblingsdichter erzählt haben, vielleicht hatte sie auch schon etwas von ihm gelesen.
Sie passierten einen Hain aus Kokospalmen, zwischen dessen Stämmen das Meer aufblitzte. Mittendrin grasten kleinwüchsige schwarze Pferde und eine Herde beigefarbener Kühe. Frieden auf Erden, dachte Cording, ein stimmigeres Bild hätte man dafür nicht finden können. Auf den Dächern der mit Solarzellen bestückten Häuser drehten sich kleine Windwandler* im Passat. Die Anlagen passten sich dem himmlischen Atem automatisch an und machten kaum Geräusche. Sie lieferten auch dann Strom, wenn die Sunmachines*, deren glitzernde Parabolspiegel Cording in vielen Gärten ausmachte, passen mussten. Bei beiden Energieträgern handelte es sich um deutsche Patente, er hatte sie Jahre zuvor im Rahmen eines Berichtes über neue Umwelttechnologien vorgestellt. Die Parabolspiegel bestanden aus hochtransparentem, eisenfreien Solarglas, und richteten sich nach der Sonne aus. Die gebündelte Energie brachte den angeschlossenen Stirlingmotor auf Leistung.
Cording war alles andere als ein Technikfreak, aber einfache Lösungen für komplizierte Probleme faszinierten ihn. In Deutschland hatten sich die Dinger nie richtig durchsetzen können, der Anteil regenerativer Energien stagnierte seit Jahren bei fünfzehn Prozent. Die Energiemultis hatten ihre Regierungen im Griff, blockierten erfolgreich jede Subvention, die ihren Interessen zuwiderlief und hielten damit die Verbraucher in Abhängigkeit. Bevor nicht der letzte Tropfen Öl aus der Erde gepumpt war, bevor nicht die Kohle- und Erdgasvorräte vollständig geplündert waren, würden sich die Industrienationen gewiss keines Besseren besinnen.
Die Windwandler und Sunmachines entlang der Strecke funkelten wie ausgestreute Diamanten in der Sonne. Sie waren ein Zeichen dafür, dass die Menschen hier wieder mit den Elementen korrespondierten. Natürlich war Tahiti nur ein kleines Eiland im weiten Meer des kapitalen Irrsinns, aber zum ersten Mal seit seiner Ankunft war Cording wirklich neugierig geworden auf den Bewusstseinswandel, der sich hier so offensichtlich vollzog. Es wäre nur fair, wenn er Mike so schnell wie möglich darüber informierte, dass es mit dem verlangten Verriss seiner ‚Südseesekte’ wohl nichts werden würde.
Er wandte sich Maeva zu:
„Ich finde es erstaunlich, dass die Polynesier Omais eingeschlagenen Weg so klaglos unterstützen“, sagte er.
Sie fuhren an den Pavillons der Hiti Moana Villa bei Papara vorbei, ein kleines Ressort am Meer, in dem er vor neun Jahren gewohnt hatte.
„Ganz so klaglos, wie du denkst, hat sich der Wandel nicht vollzogen“, antwortete sie. „Im ersten Jahr nach Omais Amtsantritt hat es einen regelrechten Exodus gegeben. Über fünfundzwanzigtausend Menschen haben Tahiti damals verlassen, das war mehr als ein Zehntel der Bevölkerung. Es stand ja jedem frei, zu gehen.“
„Was waren die Beweggründe dafür?“
„In erster Linie die Land- und Bodenreform.* Und natürlich das Verkehrskonzept.* Was würdet ihr wohl sagen, wenn man ankündigte, euch die Privatfahrzeuge wegzunehmen?“
Gar nicht auszudenken sowas.
„Es fahren aber doch noch genügend Autos“, gab Cording zu bedenken.
„Diese Autos gehören allen und niemandem. Sie sind wie Taxis, nur dass man sie selber fährt. Aber darauf kommen wir noch.“
„Und wohin sind die Leute damals ausgewandert?“
„Die meisten nach Neuseeland, Frankreich, Neukaledonien oder die Cook Islands. Sie wurden ja reich entschädigt für das, was sie dem Gemeinwesen hinterlassen haben.“ Maeva lächelte. „Der anfängliche Aderlass hatte aber letztendlich gar keine so tragischen Konsequenzen wie befürchtet“, sagte sie, „inzwischen ist mehr als die Hälfte der Auswanderer nach Tahiti zurückgekehrt.“
Sie schloss das Dach, denn die schwarzen Wolken, unter denen sich das Wasser der Lagune kräuselte, würden sie gleich unter Beschuss nehmen. Kurz darauf prallten die ersten schweren Tropfen mit solcher Wucht auf das Kabinendach, dass sie ihr eigenes Wort nicht mehr verstanden. Das Wasser, das in Sturzbächen an den Fenstern herunterlief, verformte die Bäume, den Strand und die Berge wie in einem Spiegelkabinett.
An der Station Punaauia stieg Maeva aus.
„Hol mich morgen zu Hause ab“, rief sie und wandte sich zum Gehen..
Sie schritt ohne Hast durch den Tropenregen, fand sogar noch Zeit, sich mit dem Fischverkäufer zu unterhalten, dessen schimmernde Produkte an einer Holzstange baumelten. Die Tahitianer flüchteten nicht vor dem Regen, sie schienen sich gerne in ihm zu baden.
Cording fuhr alleine weiter. Als er am Flughafen Faaa ankam, brach die Sonne hervor. Drei Stunden hatte die Rundfahrt im Reva-Tae gedauert.
Eine Woche war er mit Maeva täglich in den Schiffchen unterwegs, er ließ sich diesen Crash-Kurs gerne gefallen. Auch Maeva genoss es, in ihm einen so interessierten Schüler gefunden zu haben. Es war nicht ersichtlich, nach welchem Plan sie vorging, aber vielleicht hatte sie gar keinen Plan und vielleicht war das auch gar nicht nötig. Auf Tahiti schien alles miteinander verknüpft, ein Detail bedingte das andere, da war es egal, wo man ansetzte. Die Kabine des Reva-Tae, was soviel wie „Abfahren-Ankommen“ hieß, war zum gläsernen Hörsaal geworden, in dem Cording seine Privatvorlesungen empfing. Ein spannendes Studium, zumal Maeva den Unterricht immer mit Einblicken in die tägliche Praxis und mit Ausflügen in die tahitianische Geschichte würzte. Jede Bucht, jeder Ort besaß seine eigene Historie.
Als sie tags zuvor in Hitiaa ausgestiegen waren, um eine Biogas- und Bioethanolanlage* zu besichtigen, die vor kurzem in Betrieb gegangen war, erfuhr Cording, dass dort im Jahre 1768 Louis-Antoine De Bougainville anzulanden versucht hatte, was aber wegen der heftigen Brandung und der Korallenriffe gescheitert war. Bougainville, dessen Trinkwasser und Verpflegung an Bord knapp zu werden drohten, fand schließlich in die Matavai-Bucht, wie ein Jahr vor ihm schon Wallis. Aufgrund der enthusiastischen Schilderungen, die er nach seiner Rückkehr in den Pariser Salons zum Besten gab, glaubten die Franzosen, endlich jene Paradiesinseln gefunden zu haben, von denen ihr großer Dichter Rousseau geträumt hatte, als er die Parole „Zurück zur Natur!“, ausgab.
Bougainville war der eigentliche Begründer des Südseemythos, der sich über zwei Jahrhunderte unverändert erhalten hatte. Die Berichte von den glücklichen Insulanern, die keinen anderen Gott als die Liebe kannten und deren Frauen an Grazie nicht zu überbieten waren, entfachten im defizitären Europa ungeahnte Sehnsüchte. Dass es auch auf Tahiti eine starre Klassenpyramide von Fürsten, Priestern, Freien und Hörigen gab, dass es eine Religion gab, deren unnachgiebige Götter durch Menschenopfer besänftigt werden mussten, und dass es auch hier Kriege gab, das wollte niemand wahrhaben. Damals, am Vorabend der französischen Revolution, träumte Europa unbeirrt seinen tahitianischen Traum. Er breitete sich aus wie eine Epidemie und machte süchtig wie eine Droge. Kein Wunder, dass derlei unreflektierte Schwärmerei von schönen Wilden und freier Liebe die Kirche auf den Plan rief. Schon wenige Jahrzehnte nach Bougainville fielen britische und französische Missionare über das „gottlose“ Inselvölkchen her.
Cording mochte nicht daran erinnert werden, was sie den Menschen hier angetan hatten. Ihm wurde übel, wenn er nur daran dachte. Jedenfalls hatten die Franzosen ihrem Kommandanten Bougainville in Papeete ein Denkmal gesetzt. Es stand noch immer da, als Teil der Geschichte Tahitis
Omais Revolution kam ohne Bildersturm aus, nicht aber ohne Biogasanlagen, wie er den Ausführungen Mavas entnahm. Jede Gemeinde verfügte über mindestens einen Fermenter, in dem die auf der Insel rund ums Jahr anfallenden Bioabfälle unter Licht- und Luftabschluss genügend Methangas erzeugten, um damit Strom zu generieren. Das von Bakterien zerfressene Material wurde zur Schlempe, später abgepumpt und als Dünger in der Landwirtschaft verwendet. Mineralstoffreich und geruchlos. In Deutschland verhinderte die mächtige Lobby der Chemieindustrie die Umsetzung solcher Konzepte. Auch die Idee eines Grundeinkommens*, wie es auf Tahiti jedem Bürger gewährt wurde, schien dort nicht umsetzbar zu sein. Warum? Die Empfänger des Geldes waren weder arbeitsscheu noch kriminell, auf der Basis einer gesicherten Existenz gewann jeder Tahitianer genügend Freiraum, um seine speziellen Fähigkeiten in die Gemeinschaft einzubringen.
Innerhalb der letzten Woche war Cording klar geworden, dass seine Reportage nur eine Mischung aus höchstem Lobgesang und übelster Beschimpfung sein konnte. In welche Richtung die Beschimpfung ging, stand außer Frage: Richtung Heimat! Damit war die Reportage gestorben. Seltsamerweise interessierte es ihn von Tag zu Tag immer weniger, in welcher Verpflichtung er seinem Verlag gegenüber stand. Ein fahrlässiges Verhalten, zugegeben — es verlieh ihm jedoch ein ungewohntes Gefühl der Freiheit.
Was hatte er bisher über das tahitianische Gesellschaftsmodell gelernt? Es gab zum Beispiel ein neues Steuersystem*. Niemand musste seine Steuer ‚erklären’. Es wurde nicht mehr die Arbeit besteuert, sondern der Verbrauch von Wasser, Boden und Rohstoffen. Er hatte gelernt, dass Geld* auch ganz anders funktionieren kann, als er es gewohnt war. Ausgerechnet auf Tahiti, in dessen Geschichte die ‚Tapus’, von denen sich das Wort Tabu ableitet, eine so bedeutende Rolle gespielt hatten, wurde mit dem größten aller noch existierenden Tabus gebrochen: dem weltweit anerkannten Geldsystem. Maeva hatte ihn auf die besonderen Nummerierungen auf den Geldscheinen aufmerksam gemacht, die es dem Staat ermöglichten, bestimmte Serien in festgelegten Zeiträumen für ungültig zu erklären und zum Umtausch zurückzurufen. Damit sollte verhindert werden, dass Bargeld dem Kreislauf durch Horten entzogen und das Zahlungsmittel durch diese Verknappung gegenüber Waren und Dienstleistungen unverhältnismäßig aufgewertet wurde. Komplizierte Sache, aber seine Begleiterin versicherte ihm, dass die junge Generation Tahitis die Rolle des neuen Geldes sehr wohl verstand und bereits Mühe hatte, die klassische Zinswirtschaft zu begreifen, bei der die Wohlhabenden sich auf Kosten der Ärmeren immer weiter bereichern konnten.
„Das neue Geld war eigentlich eure Idee“, belehrte ihn Maeva lächelnd. „In Wörchel hat das schon vor neunzig Jahren funktioniert.“
„In wo?“
„Wörchel.“ Sie schrieb das Wort auf die Innenfläche seiner linken Hand und betrachtete dabei interessiert Cordings Lebens- und Liebeslinie.
„W Ö R G L“. Die Tahitianer hatten kein G in ihrem Alphabet, also wurde Wörchel daraus.
Wirtschaftswunder Wörgl* — Cording hatte davon gehört, es war ein Begriff in der Finanzwelt, obwohl die Ökonomen ihn scheuten wie der Teufel das Weihwasser. Es ging zurück auf eine kleine österreichische Stadt, der 1930 das Geld ausgegangen war. Die Arbeitslosigkeit in der kleinen Gemeinde hielt wacker Schritt mit der allgemeinen Entwicklung in Europa, und die Gemeindeverwaltung hatte begriffen, dass die Realisierung sämtlicher sozialer Projekte für Jahre auf Eis liegen würde. In dieser Situation dachte Wörgls Bürgermeister Unterguggenberger über die Bedeutung des Gelds nach. Er kam zu der Einsicht, dass die Wirtschaftskrise dem langsamen Geldumlauf zu verdanken war, dass jede Geldstauung Warenstauung und Arbeitslosigkeit bewirkte. Er fand, dass das langsam fließende Geld der Nationalbank durch ein Umlaufmittel ersetzt werden musste, welches seiner Bestimmung als Tauschmittel besser nachkommen würde als die übliche Währung.
Wörgl hatte in nur zwölf Monaten einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, der noch heute seinesgleichen sucht. Während die Arbeitslosigkeit in Deutschland und Österreich um zehn Prozent stieg, ging sie in der österreichischen Gemeinde um 25 Prozent zurück. Die von der Verwaltung eingenommene Gebühr von zwölf Prozent wurde für öffentliche Zwecke verwendet. Das Experiment von Wörgl war so erfolgreich, dass es rasch Nachahmer fand. Im Juni 1933 sprach Unterguggenberger vor Vertretern aus 170 Städten und Gemeinden. Diese Entwicklung machte die österreichische Zentralbank nervös, sie sah plötzlich ihr Monopol gefährdet. Es kam zu einer juristischen Auseinandersetzung, die bis vor den Verwaltungsgerichtshof getragen wurde, der die Ausgabe von Freigeld in Österreich verbot. Wörgl wurde dazu verdonnert, zum alten Währungssystem zurückzukehren. Jetzt hatte sich Tahiti der ‚Wörchel’-Idee angenommen und fuhr offensichtlich gut damit.
Aber Geld war nicht das einzige Thema, das er in dieser so anregenden Woche mit Maeva besprochen hatte. Sie hatte ihm auch vom neuen Bodenrecht*, der Parlamentsreform*, dem Bildungs*- und dem Gesundheitswesen* berichtet — und während sie redete saugte Cording den Klang ihrer Stimme in sich auf und versank in ihren Augen. Das leise Lachen, zu dem sie stets aufgelegt war, ihr schneller Redefluss und das Rollen ihres kehligen R, das er so sehr mochte, machten es ihm mitunter schwer, sich auf die Inhalte zu konzentrieren.
Er freute sich auf morgen, da wollte Maeva ihm einen Ort zeigen, der den Tahitianern als magisch galt: Point Venus. Um Steve, den er seit der ersten Reva-Tae-Fahrt nicht mehr gesehen hatte, brauchte er sich keine Sorgen zu machen. Der Junge hatte ihm durch Anapa mitteilen lassen, dass er für eine Weile bei Freunden in Teahupoo untergekommen war.
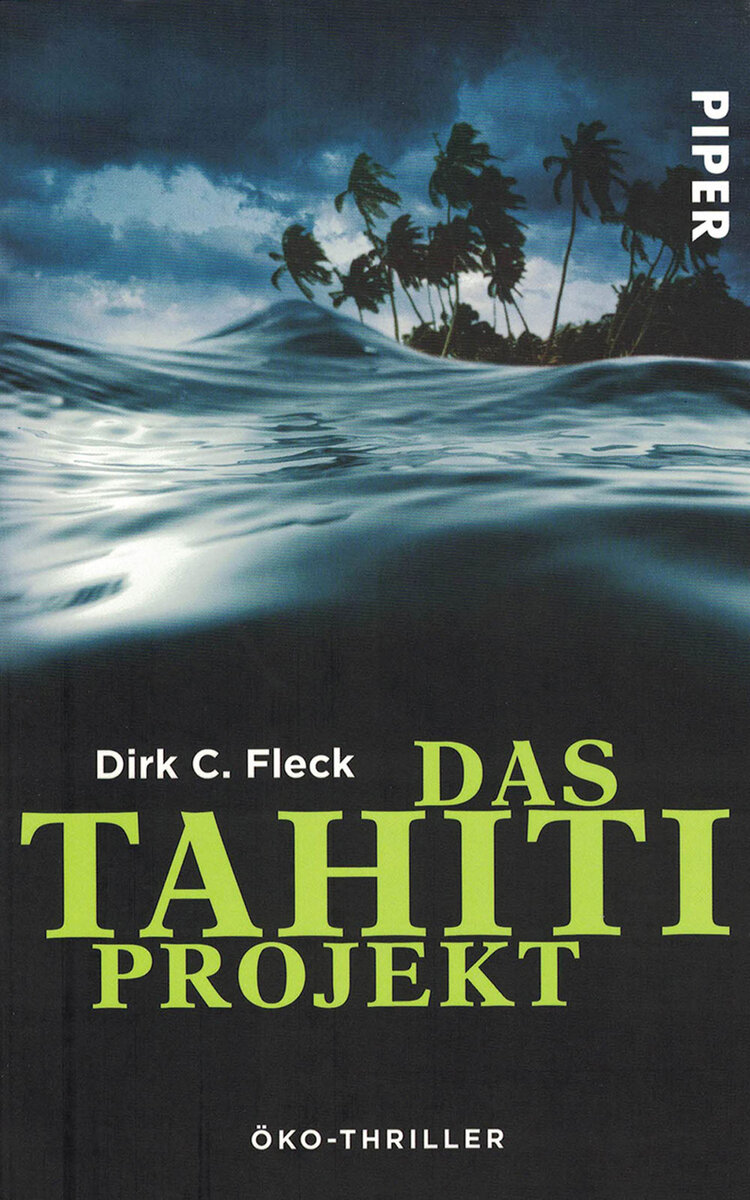
Hier können Sie das Buch bestellen: equilibrismus.org

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
*Die Erklärungen der im Roman verwendeten Fachbegriffe sowie Hinweise für interessierte Leser auf weiterführende Literatur oder Webseiten befinden sich im Buch. Obwohl das „Tahiti-Projekt“ ein Zukunftsroman ist, sind die in ihm dargestellten technischen Lösungen und sozioökologischen Modelle keine Fiktion: sie existieren bereits heute! Das einzig Fiktive ist die Annahme, dass irgendwo auf diesem Planeten tatsächlich mit konkreten Veränderungen in Richtung auf eine zukunftsfähige Lebensweise begonnen wurde.