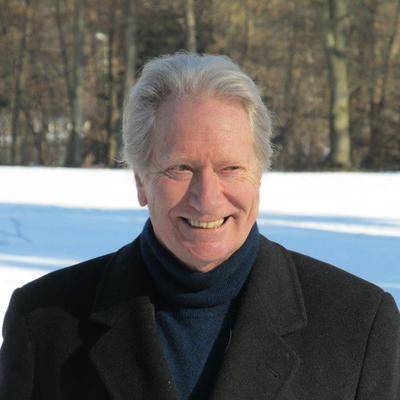Thorwald Rasmussen war bewusst, dass seine Anwesenheit zur Zeit für andere Menschen nicht einfach zu ertragen war. Umso dankbarer registrierte er die Zurückhaltung, mit der ihm die Mitarbeiter des ‚Institute Ecologique’ in den ersten Tagen seines Tahiti-Aufenthaltes begegneten. Keine neugierigen Fragen, auch sonst keinerlei Anbiederei oder Aufdringlichkeiten. Der einzige, der seine Geschichte vollständig kannte, war Professor Engelhardt. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, den Rasmussen aufgenommen hatte. Wenn es ein Thermometer gäbe, dass den Grad von Nervosität anzeigte, die ihn plagte, stünde es beständig auf 40 Grad. Er befand sich praktisch am Rande eines permanenten Fieberwahns.
Das Büro des Präsidenten hatte mitteilen lassen, dass sich Omais Schwester persönlich herbemühen werde, um ihn abzuholen. In zehn Minuten würde sie ins Institut kommen und ihn anschließend zu dem Emergency-Reporter führen. Rasmussen gedachte der turbulenten Wochen, die dem Bornholmer Massaker gefolgt waren, seiner Flucht nach Schottland, der komfortablen Zeit im Schloss des Earl und der Countess of Mansfield, seiner gespenstischen Begegnung mit dem Chefredakteur von Emergency in London und dem erneuten Aufenthalt in Scone Palace bis hin zur Herstellung seiner neuen Identität, die ihn schließlich sicher nach Tahiti gebracht hatte. Wenn dieser Cording auch nur einigermaßen aufgeweckt war, würde er die Brisanz der Angelegenheit auf Anhieb erkennen. Mit der Veröffentlichung der Geschichte hätte er sein Ziel erreicht. Ob ihm seine Häscher danach eine Kugel durch den Kopf jagten, das war nebensächlich. Er ging davon aus.
Ein Klopfen an der Tür ließ Rasmussen zusammenzucken. Er drückte sich mit dem Rücken an das vergitterte Fenster. „Wer ist da?“, fragte er mit dünner Stimme.
„Maeva.“
„Einen Moment bitte“, sagte der Professor.
Er warf einen kurzen Blick in den Rasierspiegel, griff nach seinem Trenchcoat und öffnete. Der jungen Frau, die ihn so freundlich anlächelte, schenkte er kaum Beachtung. Seine Blicke schweiften nervös an ihr vorbei, rechts und links den Flur hinunter.
„Gehen wir“, flüsterte er, als er sich davon überzeugt hatte, dass die Luft rein war. Für einen flüchtigen Moment schaute er Maeva in die Augen.
Seit einer Stunde wartete Cording auf den ominösen Professor. Sie waren an der Roulotte verabredet, die dem Institut am nächsten lag. Cording liebte diese kleinen, fahrbaren Garküchen entlang der Straße, die man rund um die Insel fand. Diese hier war besonders schön postiert. Der Imbisswagen stand zwar auf dem Parkplatz der Feuerwehr von Vairao, aber die beiden Holztische waren direkt ans Meer gerückt.
Rasmussen hatte darauf bestanden, dass sie sich nach Sonnenuntergang trafen. Dadurch, dass Cording die schöne Schwester des Präsidenten ins Institut geschickt hatte, um seinen Informanten abzuholen, bestand zumindest die Chance, dass der Däne nicht allzu paranoid agieren würde.
Die Mondsichel stand nur noch eine Handbreit über dem Ozean, der sich bewegungslos an den schwarzen Strand schmiegte. Cording war hungrig. Wenn die beiden nicht in den nächsten fünf Minuten auftauchten, würde er seine Bestellung aufgeben.
„Mahi-Mahi“, sagte er zu dem Hund, der sich ihm in der Hoffnung zugesellt hatte, dass bei entsprechendem Augenaufschlag auch etwas für ihn abfallen würde.
„Fisch“, antwortete Cording den fragenden Augen der schlanken Hundedame. „Ich hoffe, du magst Fisch.“
In dem Moment kam Maeva in Begleitung eines Mannes über den Parkplatz gelaufen. Ihr Begleiter war etwa so groß wie sie, eher noch ein wenig kleiner, wenn er den Hut abnähme. Er trug eine Sonnenbrille und war trotz der lauen Sommernacht in einen Trenchcoat gehüllt.
„Professor Thorwald Rasmussen“, stellte Maeva vor.
Cording reichte dem Mann die Hand, doch Rasmussen ignorierte die Geste. Er setzte sich und starrte zur Roulotte hinüber, wo sich vier Männer angeregt auf Deutsch unterhielten.
„Wer sind die?“, fragte er.
„Mitarbeiter von Eco-Energy aus Kassel“, antwortete Cording.
„Was willst du essen?“, fragte Maeva, an Cording gewandt.
„Mahi-Mahi“, antwortete er. „Und Sie, Herr Professor?“
„Nichts, danke“, antwortete er und schob Cording seine Aktentasche über den Tisch.
„Da drin finden Sie alles, was Sie wissen müssen“, flüsterte er.
Cording trommelte mit den Fingern auf das abgewetzte Leder.
„Okay“, sagte er, „womit haben wir es hier zu tun? Ein knapper Überblick würde mir fürs Erste schon genügen.“
Rasmussen räusperte sich.
„Gut“, begann er und blickte sich zum wiederholten Male nach den vier Deutschen um, „ich will versuchen, es Ihnen in wenigen Worten zu erklären. Die Vereinigten Staaten und China sind dabei, in den Hoheitsgewässern Polynesiens nach Manganknollen zu schürfen. Es ist eine geheime, militärisch abgesicherte Aktion, mit der sie sich ihren Rohstoffbedarf für die Zukunft sichern wollen. Und zwar gegen die Bestimmungen der IMB. Die Internationale Meeresbodenbehörde, Sie wissen schon. Ich war Mitglied der zur Geheimhaltung verpflichteten Wissenschaftscrew, die im Auftrage von Global Oil nicht nur die Ergiebigkeit der Knollen geprüft, sondern darüber hinaus die technischen Möglichkeiten zu ihrer Gewinnung entwickelt hat. Wissen Sie beispielsweise, dass in den Knollen neben dem äußerst wertvollen Kobalt, Nickel und Kupfer auch Molybdän und Tellur enthalten sind? Molybdän steckt unter anderem in den Hitzeschildern von Raketen, Tellur wird in Fotozellen eingesetzt. Das ganze Satellitensystem wäre ohne Molybdän und Tellur nicht möglich. Und darum geht es den USA und China in der Hauptsache. Sie streben die Alleinherrschaft im All an, ihr Ziel ist es, die Überwachung des Planeten vollständig an sich zu reißen.“
„Und warum haben sie sich dafür ausgerechnet die polynesischen Gewässer ausgesucht?“, fragte Cording.
Während des Gesprächs hatte sich Rasmussen immer weiter über den Tisch gebeugt, mittlerweile lag er fast auf ihm.
„Warum gucken diese Männer zu uns herüber?“, fragte er leise. „Das sind keine Mitarbeiter von Eco-Energy. Hab die noch nie gesehen im Institut ... Das ist eine Falle ...“
Cording wusste von Rasmussens tragischer Geschichte. Er empfand Respekt vor diesem Mann, den der Meuchelmord an seiner Familie ersichtlich in die Nähe des Wahnsinns getrieben hatte und der dennoch die Kraft und Konzentration fand, sein Wissen zu veräußern. Allerdings wusste er nicht genau, wie er die Geschichte des Professors deuten sollte. War da was dran, oder hatte er es hier mit einem Irren zu tun? Es gelang ihm, den Professor kurzfristig wieder zu beruhigen. Und plötzlich erinnerte er sich an die Mail, auf die er und Steve vor einigen Wochen zufällig gestoßen waren. Wie hatte es da geheißen? Er versuchte, sich den genauen Wortlaut ins Gedächtnis zu rufen. Von der IMB war die Rede gewesen, von China, und von einer Aktion zur Rettung der amerikanischen Volkswirtschaft. Sollte es sich bei dem Absender ‚Bob’ um Robert McEwen, den Präsidenten von Global Oil handeln? Es schien alles zusammenzupassen. Die Vorstellung war ungeheuerlich.
Der Professor griff sich die Aktentasche und zog eine Karte hervor, die er nun sorgfältig auf dem Tisch ausbreitete. Er fuhr mit dem Finger die Strecke zwischen den Gesellschaftsinseln und der zu Frankreich zählenden Insel Clipperton nahe der mexikanischen Küste ab.
„Dies hier nennen wir die Clipperton Fracture Zone“, sagte er, „dort lagern die größten Manganvorkommen der Welt. Aber nirgendwo ist der Gehalt an Molybdän und Tellur so extrem hoch wie vor den polynesischen Inseln Makatea, Nauru und Banaba. Alle drei Inseln sind im Laufe der Geschichte als Block aus dem Meer gehoben worden, was verstärkt zur Bildung dieser seltenen geologischen Substanzen beigetragen hat. Hinzu kommt, dass die Vorkommen direkt vor den Küsten liegen, während man anderswo bis zu sechstausend Meter tief schürfen müsste.“
Cording zermarterte sich das Hirn. War in der Mail nicht auch die Rede von irgendwelchen Rohstoffen gewesen? Er konnte sich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern.
„Die Manganknollen sind etwas sehr Kostbares“, hörte er Rasmussen sagen, „es dauert eine Ewigkeit, bis sich so eine faustgroße Knolle gebildet hat. Manganknollen bestehen aus Staub, der auf den Ozean rieselt, in die Tiefe sinkt und sich dort allmählich verdichtet. Ganze fünf Millimeter legen die Knollen in einer Million Jahre zu. Ihr industrieller Abbau birgt eine große Gefahr für die Region. Die Amerikaner und Chinesen gehen den Inseln ja direkt an die Sockel. Und wer ihren Hunger kennt, kann sich ausrechnen, dass auf diese Weise über Kurz oder Lang eine Südseeperle nach der anderen im Meer zu versinken droht. Natürlich werden sie nicht vor unseren Augen absaufen“, sagte Rasmussen und schielte auf den dampfenden Fisch, den Maeva vor Cording hinstellte. Auch der Hund wechselte an dessen Seite.
„Was die Menschen hier jedoch sehr schnell zu spüren bekommen werden“, fuhr der Däne fort, „sind die enormen Umweltbelastungen, die eine so gigantische Schürfaktion mit sich bringt. Der gewaltsame Eingriff zerstört die Bodenoberfläche und wirbelt Wolken auf, die sich als schmutzige Schleier an die Strände legen werden. Fauna und Flora im Südpazifik werden sich langfristig ändern. Das aufgewirbelte Bodenmaterial hat Einfluss auf die Lichtverhältnisse im Ozean und bringt mit dem nach oben gepumpten Tiefseewasser das gesamte Nahrungsangebot eines gewachsenen Ökosystems durcheinander. Hinzu kommt noch, dass die Metalle vor Ort aus den Knollen gelöst werden sollen, die Schürftanker sind entsprechend ausgerüstet. Dieser Prozess gelingt aber nur unter Einsatz hochgiftiger Chemikalien und produziert eine Menge unbrauchbarer Rückstände. Wie man diese zu entsorgen gedenkt, brauche ich Ihnen ja wohl nicht zu sagen.“
Rasmussen schlug den Kragen seines Mantels hoch und sprang auf. Die Anwesenheit der Männer an der Roulotte, die inzwischen aufgegessen hatten und trotzdem keine Anstalten machten, zu gehen, schien ihn nun endgültig aus der Fassung zu bringen.
„Wo sind die Amerikaner und Chinesen denn jetzt zugange?“, fragte Cording schnell, bevor er den Teller mit den Fisch- und Reisresten auf den Boden stellte.
„Wie bitte? Ach so, ja. An der Nordküste Makateas“, antwortete der Professor zerstreut.
Jetzt erhoben sich auch die vier Mitarbeiter von Eco-Energy. Bei Rasmussen erwachte der Fluchtinstinkt.
„Bringen Sie mich hier fort“, raunte er Maeva zu und schlich hastig in ihrem Rücken davon.
Cording schüttelte den Kopf und forderte die Hundedame auf, sich endlich zu bedienen, bevor er es sich anders überlegte. Schließlich war das Essen noch warm.
Er hatte erwartet, dass sich Omai entsetzt zeigen würde über die Unterlagen, die Rasmussen ihnen überlassen hatte und die er nach der gestrigen Begegnung mit dem Professor sofort im Büro des Präsidenten abgeliefert hatte. Aber Omai machte nicht den Anschein, sonderlich beunruhigt zu sein. Stattdessen zeigte er Cording voller Stolz einen Artikel nach dem anderen, die inzwischen über das „Tahiti-Projekt“ erschienen waren. Die Kollegen hatten gute Arbeit geleistet, das Projekt kam in der Weltpresse blendend weg.
National Geographic schmückte sich gar mit einer Titelgeschichte. Insgesamt hatten einundzwanzig bedeutende Zeitungen und Zeitschriften berichtet, von San Francisco bis Paris, von Reykjavik bis Kapstadt. Sogar die englische Ausgabe des Peking-Star war dabei, allerdings versteckten sie das „Tahiti-Projekt“ auf der Wirtschaftsseite. Weitere Reportagen würden folgen. Der Tenor war immer der gleiche: „Das verlorene Paradies erwacht!“.
„Was hältst du denn nun von den Rasmussen-Papieren?“, fragte Cording ungeduldig, als Omai begann, die internationalen Jubelarien an den Wänden seines Büros aufzuhängen.
„Sie schürfen bereits vor Makatea, sagst du?“
„Das hat der Däne behauptet, ja.“
„Der Coup muss gut vorbereitet gewesen sein. Makatea ist seit über zehn Jahren unbewohnt. Außerdem liegt die Insel abseits jeder Flugroute. Auch die internationalen Wasserstraßen führen weit an Makatea vorbei. Mag sein, dass sich einige Fischer in die dortigen Gewässer verirren, aber auch das ist eher unwahrscheinlich. Dort könnte man in der Tat völlig unbemerkt agieren.“
„Und?“, fragte Cording. „Was gedenkst du zu tun? Der Fall gehört eigentlich vor die UNO!“
„Lass uns zunächst einmal nachsehen, bevor wir einen so wichtigen Schritt unternehmen“, entgegnete Omai beschwichtigend, „so ganz trau ich dem Braten noch nicht.“
„Wieso nicht? Die Angelegenheit erscheint mir ziemlich logisch. Die Manganvorkommen an Land sind so gut wie erschöpft. Schon 1970 fanden sich China, Frankreich, Indien, Japan, die Sowjetunion sowie mehrere internationale Konsortien bereit, die Meeresgründe zu beackern. Der Vorstoß in die Tiefsee war nur deshalb verschoben worden, weil plötzlich neue Lagerstätten an Land entdeckt wurden und die Metallpreise auf ein erschwingliches Niveau zurückfielen. Damals kostete eine Tonne Mangan noch 145 Dollar, heute sind es über 7.000 Euro! Der Preis für das in den Knollen enthaltene Nickel beläuft sich inzwischen sogar auf 25 000 Euro pro Tonne, Kobalt ist noch teurer, 30 000 Euro und mehr. IMB und ISA schätzen, dass 50 Millionen Tonnen dieser im Mangan enthaltenen Wertmetalle im Südpazifik zu gewinnen sind. Ein Milliardengeschäft. Das scheint mir ein verdammt triftiger Grund zu sein, um die tiefschürfenden Pläne zu verwirklichen und die internationalen Bestimmungen auszuhebeln.“
„IMB, ISA — was sind das für Organisationen?“
„Die IMB ist die Meeresschutzbehörde der UNO, die offensichtlich eine Tochter bekommen hat, die Internationale Meeresbodenbehörde ISA mit Sitz in Jamaika. Die ISA ist geschaffen worden, um über die Einhaltung des Internationalen Seerechtsübereinkommens zu wachen, das 1994 nach einem UN-Beschluss in Kraft getreten ist. Das Abkommen erklärt die Gebiete außerhalb der territorialen Grenzen und alle darin enthaltenen Ressourcen zum gemeinsamen Erbe der Menschheit.“
„Aber uns wäre es erlaubt, vor Makatea zu schürfen?“, fragte Omai.
„Vor Makatea, vor Bora-Bora, wenn du wolltest, könntet ihr auch vor Raiatea und Tahiti schürfen. Vorausgesetzt natürlich, ihr verfügt über die hochkomplizierte Technik, die man dafür benötigt. Und natürlich über ein gewaltiges Maß an ökologischer Verblendung ...“
Cording wurde langsam nervös. „Also was machen wir jetzt?“, drängte er den Präsidenten.
„Wir fliegen hin“, antwortete der. „Nur du und ich.“
„Und Maeva.“
„Und Maeva“, willigte Omai ein.
Der Flug über Makatea war für morgen geplant. Für heute hatte ihn Maeva in einem handgeschriebenen Brief nach Point Venus bestellt, den er neben einer Tiaré auf seinem Kopfkissen gefunden hatte. Die Zeilen waren in maorischer Sprache verfasst, er vermochte lediglich den Hinweis auf die Verabredung zu deuten. Irgendwann würde er sich die Worte übersetzen lassen, die sie wohl bewusst im Dunkeln gelassen hatte. Bevor er ging, sog er noch einmal den herrlichen Duft ein, der von dem Brief ausging.
Maeva erwartete Cording am Leuchtturm. Sie hatte den Pareu geschickt drapiert und sah bezaubernd aus in ihrem mit blauen Blumen verziertem Tuch. Er hatte sie noch nie so schön gesehen. Sprechen wollte Madame Maximühljan jedoch nicht. Sie wollte auch nicht, dass er etwas sagte und versiegelte ihm mit ihrem warmen Zeigefinger die Lippen.
Schweigend folgte er ihr an den Strand, wo sie nach seiner Hand griff und ihn ins Meer führte. Maeva verstand es, das Tempo so zu gestalten, dass der Widerstand des Wassers, das ihnen um die Beine spülte, kaum spürbar war. Er war überrascht, wie weit sie sich bereits vom Ufer entfernt hatten, aber die Bucht war an dieser Stelle sehr flach.
Bisher schwappten ihnen die seichten Wellen lediglich um die Hüften.
Plötzlich blieb sie stehen und blickte ihm in die Augen. Es hatte lange gebraucht, bis er in der Lage war, den blitzenden Gewittern in diesen schwarzen Diamantpupillen länger als drei Sekunden standzuhalten.
„Maeva“, hauchte sie, schlang ihre Arme um seinen Nacken und umgarnte ihn mit der Leichtigkeit einer Wasserpflanze.
Cording verharrte benommen im Duftbad ihrer Haare, die den köstlichen Geruch von Monai verströmten, einer Essenz aus Kokosnussöl und Tiaré-Blüten. Die Außenwelt füllte sich mit einer feinstofflichen Substanz, die ihn, die Bäume, die Berge, das Riff so selbstverständlich durchdrang, als sei Materie im Reich der Wirklichkeit nur eine lächerliche Illusion. Die Ewigkeit gab ein Gastspiel im Theater der Vergänglichkeit und er saß im Parkett, erste Reihe Mitte. Auf der Bühne das Mädchen mit der Tiaré im Haar. Sie küssten sich so leidenschaftlich, dass sie aus der Balance gerieten, aber selbst unter Wasser konnten ihre Münder nicht voneinander lassen. Als sie kaum noch Luft bekamen, schnellten sie hoch und lachten wie Königskinder, die sich einander versprochen hatten.
„Here here vau ia oe!“, rief Maeva, „Ich liebe dich!“, und schwamm ihm durch die Beine davon.
Cording folgte ihr in das flachere Wasser in Ufernähe, wo sie für den Rest des Nachmittags liegen blieben. Maeva schmiegte sich an ihn und passte den Rhythmus ihres Atems dem seinen an. Durch Maeva erst verstand er, was wahre Verschmelzung bedeutete. Ihm wurde schwindelig bei dem Gedanken.
Omai war mächtig stolz auf sein Staatstaxi, wie er die zweimotorige Propellermaschine* nannte, die den polynesischen Regierungsmitgliedern für ihre Reisen durch die Südsee zur Verfügung standen. Die Motoren befanden sich vor und hinter der fünfsitzigen Fahrgastzelle. Die Seitenleitwerke griffen von hinten in die Flügel und waren durch das Höhenleitwerk miteinander verbunden, das die Form eines überdimensionalen Gemüseschabers hatte. Das Flugzeug wurde mit kalt gepresstem Pflanzenöl betrieben und hatte eine Reichweite von 3000 Kilometern. Die Spitzengeschwindigkeit betrug 460 km/h.
Cording musste sich noch eine ganze Reihe anderer technischer Details anhören, bevor er endlich einsteigen durfte. Beeindruckt war er vor allem von der geriffelten Außenhaut des Fliegers, über die er, Omais Aufforderung folgend, seine Finger streichen ließ. Das Material war der Haifischhaut* nachempfunden, die auf ihren Schuppen mikroskopisch feine, in Strömungsrichtung verlaufende Rillen tragen. Lange hatte man geglaubt, dass eine Reibung umso geringer sei, je glatter die Oberfläche ist. Erst die Turbulenzforscher im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt hatten heraus gefunden, dass die feinen Rillen bremsende Querströmungen verhinderten und den Treibstoffverbrauch drastisch senkten. Die Tatsache, dass sich diese Entdeckung in der Verkehrsluftfahrt bisher nicht hatte durchsetzen können, sondern nur im Kleinen Anwendung fand, bestätigte Cording erneut, dass die Vernunft im Suprakapitalismus unserer Tage nicht die geringste Chance besaß.
Der Start und die folgende Rechtskurve verursachten Cording ein wohliges Kribbeln im Bauch. Die Schaumkronen auf dem Meer schienen schräg vom Himmel zu regnen, um gleich darauf, dem kippenden Horizont folgend, waagerecht auf sie zuzurollen. Cording bedauerte, dass Maeva nicht dabei sein konnte, sie nahm ihre Verpflichtungen an der Uni sehr ernst. Dass Omai ihn begleitete, wertete er als Zeichen der Freundschaft, er hätte ebenso gut den Umweltminister schicken können oder einen anderen beliebigen Kundschafter, denn wirklich überzeugt war er von der amerikanisch-chinesischen Attacke auf Tahitis Hoheitsgewässer noch nicht.
Es dauerte eine Dreiviertelstunde, bis sie die zweihundert Kilometer bis Makatea zurückgelegt hatten. Die nur 24 Quadratkilometer große Insel war kein Südseeatoll, sondern ein aus dem Ozean gepresster Phosphatblock, dessen hundert Meter aufragende Steilküste sie von weitem wie eine Torte aussehen ließ, die auf dem Meer dümpelte.
„Was das Wort Umweltverschmutzung bedeutet, haben wir erstmals durch die Ereignisse auf Makatea verstanden“, sagte Omai. „Der Phosphatabbau hinterließ Spuren der Zerstörung, wie es sie bis dahin in Polynesien noch nicht gegeben hatte. Fünfundfünfzig Jahre lang, von 1911 bis 1966, waren dort unten mehr als dreitausend Arbeiter beschäftigt. Das französische Konsortium, das uns diese eigentümliche Mondlandschaft hinterlassen hat, war seinerzeit der größte Arbeitgeber zwischen Neuseeland und Südamerika. Am Schluss machten die Lohnzahlungen dieser Company fast dreißig Prozent von dem aus, was im gesamten polynesischen Raum für Arbeit vergütet wurde.“
Sie flogen in einer Höhe von etwa dreihundert Metern. Der Pilot legte die Maschine sanft zur Seite, so dass sie die Insel in einem großen Bogen umkreisten. Die Neigung des Flugzeuges erlaubte ihnen einen hervorragenden Blick auf den Küstenstrich und die Weiten des Pazifiks. Da war nichts! Auch nach der dritten Schleife wollte sich kein stählernes, 300.000 Tonnen schweres Ungetüm zeigen. Cording mochte es nicht glauben. Die fantastisch anmutenden Kalksteinzacken auf dem Rücken des Plateaus, die kreisende Schar von Seevögeln in den Klippen, der azurblaue Himmel, der rhythmisch atmende Ozean — das alles gab ein so friedliches Bild ab, dass er den Horror zu vergessen begann, der seine Gedanken unmittelbar nach der Lektüre der Rasmussen-Dokumente in eine Art Starrkrampf versetzt hatte. Langsam zweifelte auch er an Rasmussens Glaubwürdigkeit.
Omai beugte sich zu dem Piloten, flüsterte ihm etwas ins Ohr und lehnte sich mit geschlossenen Augen in seinem Sitz zurück. Cording spürte, dass es jetzt wenig Sinn machte, die Schürfaktion, die ihm Rasmussen als so überaus gefährlich verkauft hatte, noch einmal zur Sprache zu bringen. Aber eines stand für ihn fest: Sobald sie gelandet waren, würde er sich ins Institut begeben!
Der Rückflug zog sich extrem in die Länge. Cording versuchte sich zu entspannen und schloss nun ebenfalls die Augen. Er öffnete sie erst wieder, als er in einer unerwarteten Linkskurve gegen Omais Schulter rutschte.
„Bora Bora“, sagte Omai und deutete lächelnd auf die Insel unter ihnen.
Cording blickte aus dem Fenster. Die majestätischen Berge in ihrer vom Schaum umsäumten smaragdgrünen Lagune waren das Schönste, was er je zu Gesicht bekommen hatte. Bora Bora war der Inbegriff dessen, was man sich unter einer Insel vorstellte. Ein Souverän auf Erden, wie der Kailash in Tibet oder der Half Dome im kalifornischen Yosemite.
„Dass sich Bora Bora noch in unserer Schatztruhe befindet, haben wir dir zu verdanken“, bemerkte Omai. „Erinnerst du dich? Vor neun Jahren wollte die damalige Regierung Raiatea und Bora Bora verscherbeln. Es war hauptsächlich deiner Berichterstattung zu verdanken, dass es dazu nicht gekommen ist. Ich wollte dir diese Perle wenigstens gezeigt haben, bevor du uns verlässt. Dort hinten kannst du noch die Landebahn erkennen, die die Amerikaner im zweiten Weltkrieg angelegt hatten. Es war übrigens der erste Flugplatz in Französisch-Polynesien. Die USA benutzten Bora Bora als Nachschubbasis für den Südpazifik. Kannst du dir vorstellen, was die tausend Einwohner gedacht haben müssen, als sie plötzlich von fünftausend GI’s umgeben waren?“,
Die versteckte Bemerkung über seine Abreise traf Cording wie ein Keulenschlag. Sollte sich Rasmussens Warnung tatsächlich als Verschwörungstheorie eines paranoiden Wissenschaftlers herausstellen, blieb ihm tatsächlich keine andere Wahl, als Tahiti in den nächsten Tagen zu verlassen. Und wieder einmal ertappte er sich dabei, dass ihm so ziemlich alles egal war, außer seinen persönlichen Interessen. Er wünschte sich in diesem Moment nämlich nichts sehnlicher, als dass sich Rasmussens Geschichte bewahrheitete!
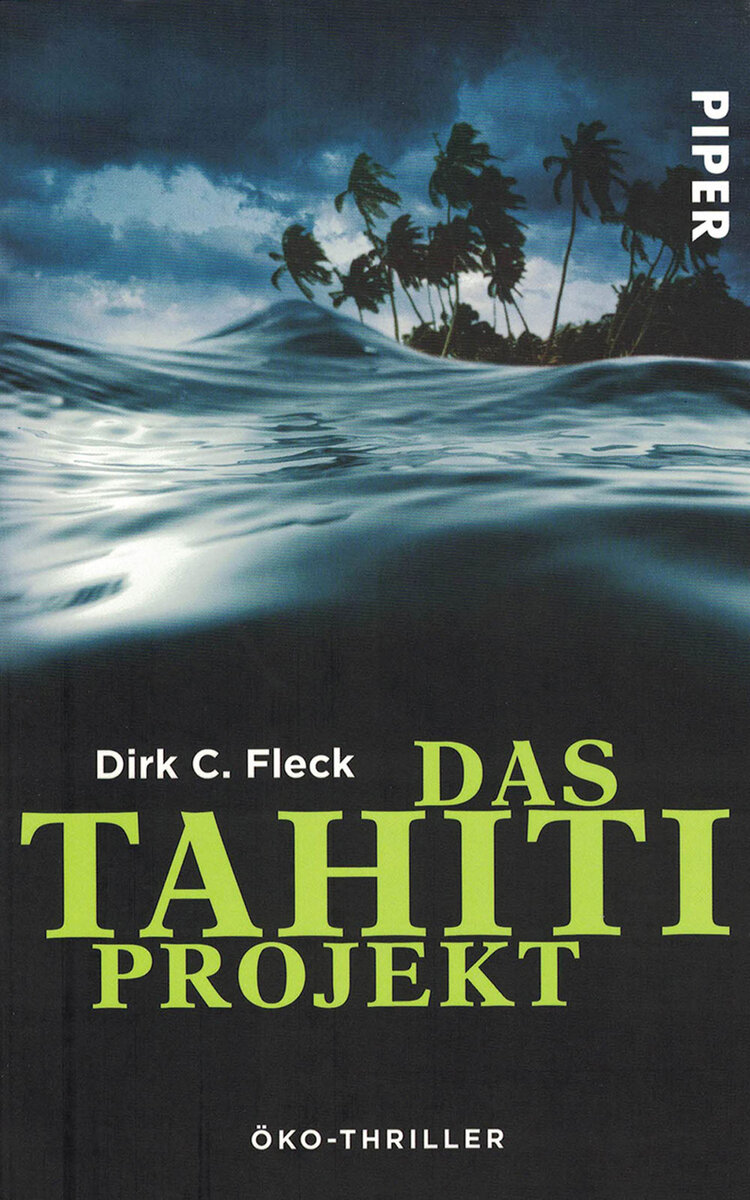
Hier können Sie das Buch bestellen: equilibrismus.org

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
*Die Erklärungen der im Roman verwendeten Fachbegriffe sowie Hinweise für interessierte Leser auf weiterführende Literatur oder Webseiten befinden sich im Buch. Obwohl das „Tahiti-Projekt“ ein Zukunftsroman ist, sind die in ihm dargestellten technischen Lösungen und sozioökologischen Modelle keine Fiktion: sie existieren bereits heute! Das einzig Fiktive ist die Annahme, dass irgendwo auf diesem Planeten tatsächlich mit konkreten Veränderungen in Richtung auf eine zukunftsfähige Lebensweise begonnen wurde.