Die UNO hatte der polynesischen Delegation eine ganze Etage im Palast-Hotel von Genf reservieren lassen. Rudolfs Leute leisteten auf dem Flur Schwerstarbeit, um die Pressemeute im Zaum zu halten, die sich ihnen von der Treppe her entgegenstemmte.
Omai stand unterdessen am Fenster der Präsidentensuite und blickte durch einen Gardinenspalt auf den Quai du Mont-Blanc, wo sich tausende von Menschen hinter den Sperrgittern drängelten. Er wunderte sich über die zahlreichen Transparente und Spruchbänder, auf denen er gefeiert wurde. Viele der Demonstranten trugen T-Shirts mit seinem Konterfei. Er hätte sich gerne gezeigt unter diese Menschen, aber das hätte Rudolf nie gestattet. Er organisierte gerade die Autos, damit sie dem Grab von Sir Peter Ustinov einen Besuch abstatten konnten.
„Kleine Änderung“, hörte er seinen Leibwächter sagen, der unbemerkt ins Zimmer getreten war. „Wir nehmen nicht die Autobahn, wir nehmen die Landstraße. Außerdem fahren wir in anderer Wagenfolge. Du nimmst also nicht wie vorgesehen im zweiten, sondern im letzten Wagen Platz.“
„Mir gefällt das nicht“, antwortete Omai ohne sich umzusehen. „Ich trete auf wie ein Potentat. Das ist das Letzte was die Menschen von mir erwarten.“
„Lässt du mich jetzt meinen Job machen oder nicht?“, fragte Rudolf nicht ohne Schärfe in der Stimme.
Omai schwieg und seufzte.
„Sie sind ein Popstar, Monsieur le President! Ein Heiliger für manche Leute. Um deine Person ist Hysterie entstanden, ist dir das entgangen? Hysterie ist immer gefährlich. Darf ich jetzt meinen Job machen?“
Omai nickte.
„Na dann los“, mahnte Rudolf und sorgte dafür, dass der Fahrstuhl zur Tiefgarage für Omai bereitstand.
Die drei verdunkelten Limousinen waren bereits vorgefahren. In der ersten saßen vier Männer aus Omais Leibgarde, in der zweiten, die mit dem Stander der Ökologischen Konföderation Polynesiens versehen und somit als Präsidentenkarosse ausgewiesen war, hatten zwei hochrangige UN-Vertreter sowie eine Dolmetscherin Platz genommen. Omai bestieg die Rückbank des letzten Wagens. Rudolf setzte sich ans Steuer. Als sich der Mercedesstern beim Verlassen der Tiefgarage wieder auf Straßenniveau begab, scherten Motorradstreifen aus und setzten sich vor und hinter die Kolonne. Omai winkte den begeisterten Menschen entlang der Strecke zu und musste sich von Rudolf darüber belehren lassen, dass ihn draußen niemand zur Kenntnis nehmen konnte.
Sie fuhren auf der Uferstraße an der Westflanke des Genfer Sees Richtung Nyon, wo Peter Ustinov bis zu seinem Lebensende gewohnt hatte. Seitdem er dessen Begleitwort zu dem Buch „Equilibrismus“ gelesen hatte, das ihm die Autoren in Papeete überreicht hatten, und das so entscheidenden Einfluss auf das Tahiti-Projekt nehmen sollte, hatte Omai alles über den großen Weltbürger Sir Peter Ustinov in Erfahrung zu bringen versucht. Der Mann war bereits vor einundsiebzig Jahren den Weltföderalisten beigetreten und amtierte von 1991 bis zu seinem Tod 2004 als Präsident ihrer internationalen Organisation, dem World Federalist Movement.
Omai schaute hinaus auf den Genfer See, dessen Horizont sich im Herbstnebel verlor. Vor sechs Jahren hatte die UNO ihr Hauptquartier in die Schweiz verlegt. Das Gebäude am New Yorker East River war zu marode geworden, um eine solche Mammutorganisation weiterhin zu beherbergen. Aber der eigentliche Grund des Umzugs bestand darin, dass die meisten Mitgliedstaaten es als Hohn empfanden, mit den Vereinten Nationen ausgerechnet in jenem Land zu residieren, das mit seiner Vetopolitik nicht nur die UN-Reform sondern alle notwendigen Richtungswechsel blockierte, die die Mehrheit des Hauses insbesondere in Fragen der Energie- und Klimapolitik für notwendig hielt,
Auch Omai empfand es als Erleichterung, seine Rede nicht in New York halten zu müssen. Das aggressive Tempo der Stadt hätte ihm nicht behagt. Außerdem wäre das Risiko eines Attentates nicht zu bemessen gewesen. Sie durchquerten Founex. Die Straße war menschenleer. Sir Peters Grab befand sich in Bursins, einem beschaulichen Schweizer Städtchen. Omai musste schmunzeln. Ihm war eine Bemerkung eingefallen, die Peter Ustinov kurz vor seinem Tod in einer Talkshow hatte fallen lassen: „Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: ‚Das ist technisch unmöglich!‘“
„Hinlegen!“, schrie Rudolf.
Omai riss die Arme vors Gesicht und prallte gegen den Vordersitz. Ein kreischendes Bremsgeräusch zerrte an seinen Nerven, bevor der Wagen eine radikale Kehrtwendung vollführte und mit Vollgas davon stob. Als er sich aufrichtete und zurückblickte, sah er die Limousine mit dem Polynesien-Stander explodieren, als wollte sie sich von der Last des Lieferwagens, der quer auf ihr lag, gewaltsam befreien.
„Was ist passiert?“, fragte er entsetzt.
„Ein Scheißattentat ist passiert!“, rief Rudolf und attackierte ein entgegenkommendes Fahrzeug mit der Lichthupe.
Omai nahm die panische Flucht zurück nach Genf relativ gelassen zur Kenntnis. Nach einigen Kilometern griff er ein:
„Geh auf die Autobahn. Wir fahren zum Grab.“
„Was?!“, schrie Rudolf.
„Es wird sich nicht wiederholen“, entgegnete Omai ruhig, „wir fahren zum Grab.“
Während die Polizei die Unfallstelle sicherte, gedachte Polynesiens Präsident in aller Stille zwanzig Kilometer entfernt auf dem Friedhof von Bursins eines Mannes, dessen Botschaft vom gegenseitigen Respekt ebenso eindringlich wie erfolglos war. Omai bat den Geist Sir Peters um Unterstützung für die vor ihm liegenden Aufgaben. Und gemeinsam mit Rudolf betete er an dessen Grab für die Opfer, die seinetwegen auf der Straße nach Nyon in dem brennendem Auto auf grausamste Weise gefangen waren.
Das Attentat auf Omai stellte am nächsten Morgen alle anderen Nachrichten in den Schatten. Der Schweizer Generalstaatsanwalt präsentierte der Öffentlichkeit das Überwachungsvideo aus dem Helikopter, der den Konvoi in der Luft begleitet hatte. Daraus ging hervor, dass der Lieferwagen auf einem rechtwinklig zulaufenden Feldweg geparkt hatte, bevor er sich beim Herannahen der Kolonne gezielt in Bewegung setzte, um die mittlere der schwarzen Limousinen bei voller Fahrt zu rammen.
Die Bilanz des Anschlags: drei tote UN-Mitarbeiter, ein schwer verletzter Fahrer. Es stand außer Frage, so der Staatsanwalt, dass die Attacke dem polynesischen Präsidenten gegolten habe, der kurz vor Abfahrt in den hinteren Wagen umgestiegen war, was ihm letztlich das Leben gerettet hatte.
Auf die Frage nach den Tätern mussten die Ermittler passen. Außer den drei bereits erwähnten Todesopfern waren keine weiteren Leichen vor Ort gefunden worden. Es war also davon auszugehen, dass es sich bei dem Lieferwagen um ein ferngesteuertes Fahrzeug handelte. In den Trümmern habe man Spuren von Nitroglyzerin gefunden, was auf einen von langer Hand vorbereiteten Terroranschlag schließen ließ. Der Generalstaatsanwalt bat um Verständnis, dass weitere Ermittlungsergebnisse zur Zeit nicht bekannt gemacht werden konnten, was bedeutete, dass sie nicht die geringste Ahnung hatten.
Omai hatte sich nach dem Attentat in seine Suite zurückgezogen und Anweisung gegeben, ihn nicht zu stören. Er weigerte sich sogar, den UN-Generalsekretär Bagdar Singh zu empfangen, der sich extra seinetwegen ins Palast-Hotel bemüht hatte. Der gestrige Mordanschlag lastete schwer auf seine Seele.
In den langen leeren Stunden des folgenden Tages, in denen sich auf der Straße wieder Tausende von Menschen hinter den aufgestellten Sperrgittern versammelten, um seinen Namen zu skandieren, fühlte er sich ohnmächtiger denn je. Ein Gemisch aus Traurigkeit und Verbitterung hatte von ihm Besitz ergriffen, das neu für ihn war. Er empfand gar eine Feindschaft der Götter gegenüber seiner Sehnsucht nach einer besseren Welt. Wer war er denn, die göttlichen Pläne zu durchkreuzen, die der Menschheit offensichtlich anderes zugedacht hatten, als in Frieden und Harmonie zu leben?
Omai betrachtete das Kruzifix an der Wand und ihm hallte der Aufschrei Christi auf Golgatha in den Ohren: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Er fühlte sich nicht wohl in seinem Selbstmitleid, die kleinmütigen Gedanken bereiteten ihm fast physische Übelkeit, also zwang er sich zur Arbeit. Seine Rede vor der Vollversammlung bedurfte noch der Vollendung. Peinlich genau achtete er darauf, dass sich nicht der kleinste Schatten der Verbitterung auf seine Worte legte.
Maeva zitterte am ganzen Körper, als sie die Nachricht aus Genf erhielt. Sie versuchte mehrmals vergeblich, ihren Bruder im Palast-Hotel zu erreichen, aber Omai hatte angeordnet, keinerlei Gespräche durchzustellen. Er wolle sich in aller Ruhe auf seinen morgigen Auftritt vor der Vollversammlung vorbereiten, hieß es.
Maeva beruhigte sich erst, als Rudolf anrief und ihr versicherte, dass Omai unversehrt sei. Er habe das Attentat auf seine Person erstaunlich gefasst zur Kenntnis genommen, leide aber sehr unter der Tatsache, dass drei Menschen seinetwegen ihr Leben lassen mussten. Dennoch feile er mit großem Eifer an seiner Rede. Ganz lieben Gruß und kein Grund zur Sorge. Gruß auch an Cording.
„Was ist? Lässt er sich nun tätowieren?“, fragte Rudolf zum Abschied.
„Ja“, sagte Maeva mit Blick auf Cording, „ich denke, er wird es machen.“
„Na dann: Viel Glück beim Händchenhalten!“, antwortete Rudolf lachend.
„Wer wird was machen?“, fragte Cording.
„Maximühljan ...“ sagte Maeva
„Auf traditionelle Art, richtig?“
„Ganz genau.“
„Die traditionelle Methode tut aber höllisch weh, hab ich gehört.“
„Der Schmerz ist der Schlüssel zu unserer Gemeinschaft“, entgegnete Maeva ernst, als erwarte sie von ihm nichts anderes, als dass er die Mutprobe akzeptierte. „Erst das Aushalten und Überwinden des Schmerzes gibt dir das Recht, Tatau und Malu zu tragen“, fügte sie leise hinzu.
Die Kunst des Tätowierens, belehrte Maeva ihn, hatte sich in Polynesien über eintausendfünfhundert Jahre hinweg entwickelt. Tatau und Malu wurden traditionell als „beste Bekleidung“ angesehen. Männer erhielten das erste Tatau Anfang zwanzig, während Frauen ihre Malu vor der Hochzeit empfingen. Durch das Tatau gewann ein Mann das Recht, seiner Gemeinschaft in allen Belangen, einschließlich des Krieges, zu dienen. Er war nun bereit, die Künste seiner Gesellschaft zu erlernen, wobei die am höchsten geschätzte Kunst die Redekunst war.
„Das müsste dir doch sehr entgegenkommen“, bemerkte Maeva lächelnd und ließ ihre Lippen über seine Stirn hüpfen. „Ich habe den großen Rauura gebeten, dein Tatau zu machen, er ist der Beste. Morgen, während Omai seine Rede vor der UNO hält, wirst du einer von uns ...“
Sie biss ihm kräftig in den Hals. Zu kräftig, wie Cording fand. Er war der Meinung, dass die Zeremonie beim großen Rauura nun entbehrlich war, er hatte gerade genügend süßen Schmerz empfangen. Das reichte normalerweise für drei frisch gebackene Polynesier ...
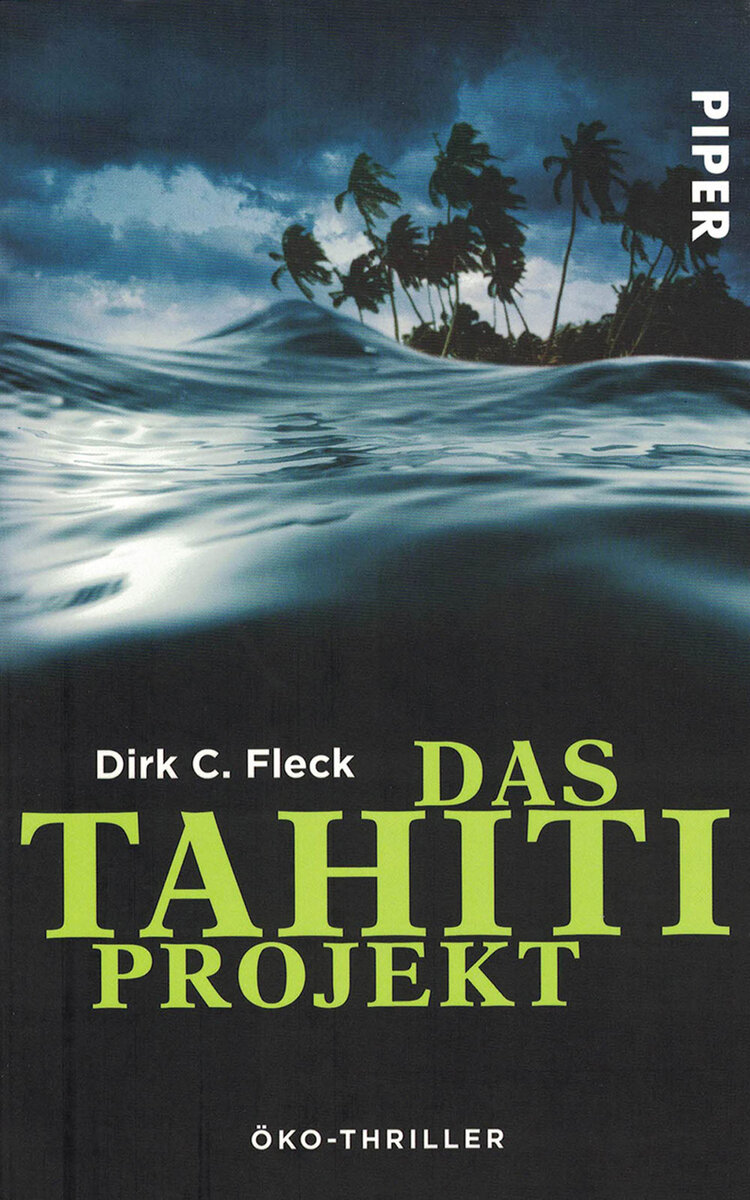
Hier können Sie das Buch bestellen: equilibrismus.org

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
*Die Erklärungen der im Roman verwendeten Fachbegriffe sowie Hinweise für interessierte Leser auf weiterführende Literatur oder Webseiten befinden sich im Buch. Obwohl das „Tahiti-Projekt“ ein Zukunftsroman ist, sind die in ihm dargestellten technischen Lösungen und sozioökologischen Modelle keine Fiktion: sie existieren bereits heute! Das einzig Fiktive ist die Annahme, dass irgendwo auf diesem Planeten tatsächlich mit konkreten Veränderungen in Richtung auf eine zukunftsfähige Lebensweise begonnen wurde.





