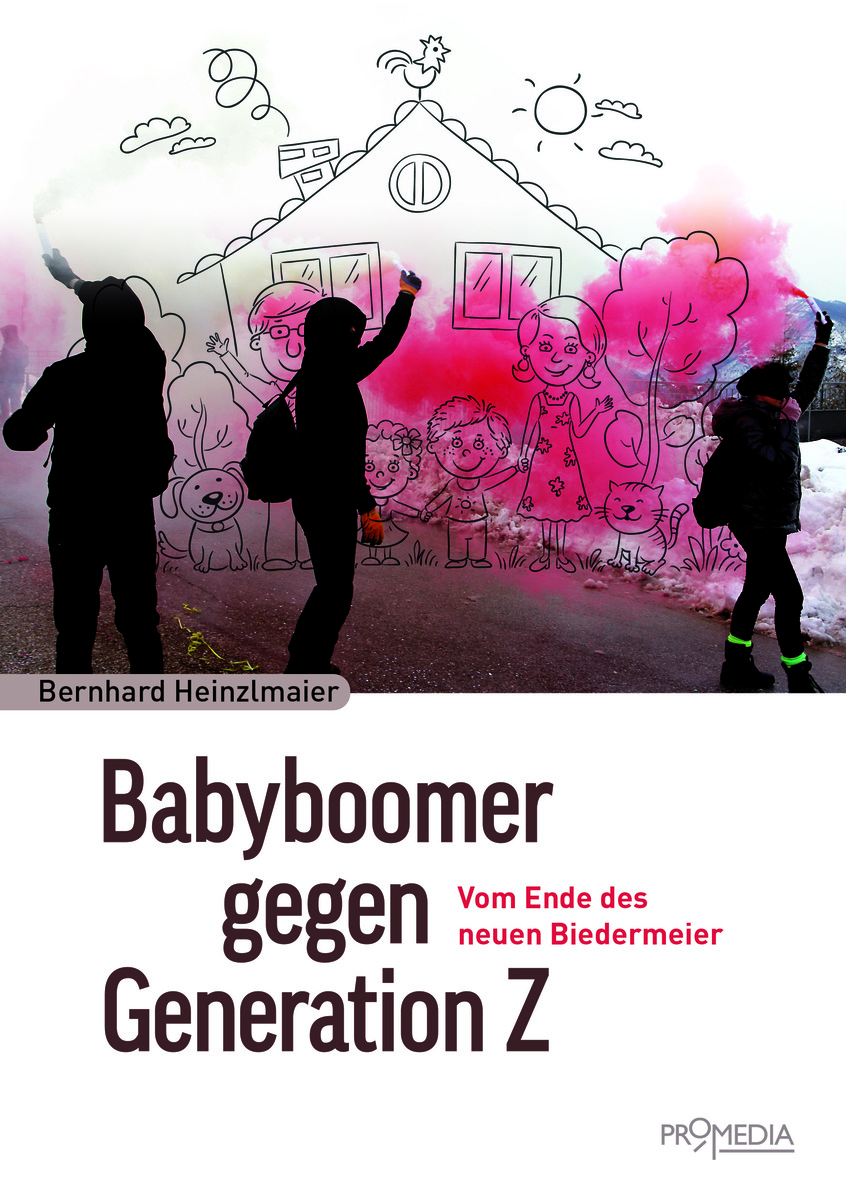Wenn man in einer autoritären pädagogischen Kultur aufwächst, lernt man eines perfekt : die Selbstunterdrückung. Doch diese war nicht immer zu ertragen, weshalb wir die anhaltenden inneren Spannungszustände und die aufgestaute Triebenergie bei Rock-Konzerten, bei Raufereien im Pausenhof und beim Fußball abbauten, indem wir uns gegenseitig in die Schienbeine traten. In den Zeiten zwischen diesen Mini-Exzessen waren wir verkrampft und verklemmt. Von dieser Verkrampfung und Verklemmung haftet den Babyboomern bis heute etwas an, obwohl sich das gesellschaftliche Klima mit der Zeit änderte, die institutionellen Zwänge sich etwas auflockerten und auch die inneren Spannungszustände etwas lösten. Aber nur etwas.
Am Ende wurde die 1968er-Revolte niedergeschlagen und die nachfolgenden Reformen waren doch eher ein taktisches Entgegenkommen der Herrschenden, als dass man stolz darauf hätte sein können, sie selbst erkämpft zu haben. Wie so oft waren am Ende nur Diskurs und Kommunikation befreit ; in den Medien wurde nun offen über Sexualität gesprochen, in der Praxis herrschten aber weiterhin Zwang, Selbstunterdrückung und misslungene Verdrängung.
Die Babyboomer sind genauso ambivalent geblieben, wie die Zeit ihrer Sozialisation es war. Sie sprechen viel und gerne über Freiheit und Unabhängigkeit, können sie aber nicht leben.
Die Generation ist heillos gespalten zwischen ihren Ansprüchen und den mangelnden Fähigkeiten, diese zu realisieren. Ihre Vertreter äußern liberale Ideen, handeln aber oft autoritär. Sie streben nach Freiheit, können sich aber nicht davon befreien, sich zur Macht hingezogen zu fühlen und von ihr Sicherheit zu erwarten. Sie praktizieren die Kunst der schönen Gedanken und verbinden diese mit Selbstunterdrückung und autoritärem Verhalten anderen gegenüber. Die hohle Phrase ist ein ständiger Begleiter der Babyboomer genauso wie der Widerspruch zwischen Sprechen und Handeln.
Schauen wir uns das einmal im Detail an. Aus soziologischen Studien geht eindeutig hervor, dass die Babyboomer mit ihren Lebensleistungen und ihrem Leben generell zufrieden sind. Schürft man etwas tiefer, wird schnell deutlich, dass diese Selbstzufriedenheit nur inszeniert ist. Sie spielen die Glücklichen, Zufriedenen und Erfolgreichen, weil sie sich dafür Anerkennung erwarten oder weil sie glauben, dass es sich so gehört.
Babyboomer zeigen sich glücklich, weil sie sich dazu verpflichtet fühlen. Bei genauerem Hinsehen erkennt man sofort, dass die Rolle des zufriedenen Menschen schlecht gespielt ist.
Die Babyboomer haben sich selbst in ein Kostüm gesteckt, das ihnen nicht passt. Selbst die Rolle des Glücklichen engt sie ein, ist ihnen aufgezwungen oder sie haben sie sich selbst auferlegt, in der Hoffnung, dadurch Anerkennung und Respekt zu erlangen.
Die Babyboomer : Materialisten, die sich nicht mehr verändern werden
Die Babyboomer sind weder kreative Fantasten noch neigen sie zum Fanatismus. Letzteres wahrscheinlich deshalb, weil sie in eine Zeit hineingeboren wurden, in der die geistigen Ausläufer des Fanatismus der Nazizeit noch spürbar waren. Ihre Eltern gehörten der „Silent Generation“ an. So nennt man in der Forschung die zwischen 1928 und 1945 Geborenen. Teile dieser Generation erlebten ihre Kindheit und die Anfänge ihrer Jugend in der Nazizeit und waren auch danach der Nazi-Ideologie ausgesetzt.
Mein 1934 geborener Vater, der auf dem Land lebte, wurde von Faschisten oder Austrofaschisten unterrichtet. Einige von ihnen wurden auf das Land strafversetzt, weil sie Parteigänger der NSDAP waren. Gemein war ihnen ein autoritärer pädagogischer Stil. In den Schulen wurde gebrüllt, erniedrigt, Nazi-Weltanschauung deklamiert und geprügelt. Der Pfarrer und zugleich Religionslehrer verteilte wütend wuchtige Ohrfeigen an Kinder, die die Kindermesse nicht besuchten. Nach 1945 gab es „offiziell“ keine Nationalsozialisten mehr, aber die Ideologie und die Lebensphilosophie der Nazis waren allgegenwärtig.
Die zwischen Nationalsozialismus und autoritärer Nachkriegszeit aufgewachsenen Eltern der Babyboomer wurden, wie oben erwähnt, in der Jugendforschung als „skeptische Generation“ etikettiert. Helmut Schelskys Buch mit demselben Titel erschien im Jahr 1957 und wurde zu einem Bestseller unter Intellektuellen.
Kennzeichen der „Silent Generation“ war, dass sie sich um ihre Jugend betrogen fühlten und dass sie niemandem vertrauten, vor allem nicht der Politik.
Es ist ein weitverbreiteter Mythos, dass die 1950er-Jahre vom Geist der Lagerstraße geprägt waren und in der Zeit das Gemeinsame über das Trennende gestellt wurde. Tatsächlich standen sich die politischen Lager mehr als skeptisch gegenüber. Auf dem flachen Land regierten Kirche und Bauernschaft, und wer sich als Sozialdemokrat outete, wurde dem „Dorfgesindel“ zugezählt und im Pfarrhof abschätzig als „Sozi-Bua“ abqualifiziert. Die alten Nazis führten bald wieder das große Wort, fanden sich in allen Parteien, und das über alle Lager verbindende Element war der Judenhass. Die Babyboomer wuchsen zwischen zwei Welten auf: der noch immer präsenten Welt des Nationalsozialismus und einem neuen demokratischen System, an dem sich viele lediglich rituell beteiligten. Wie sie am Sonntag zur Kirche gingen, ohne innere Überzeugung, gingen sie auch zu den Wahlen.
Die Leitkultur der „Silent Generation“ war der amerikanische Rock ’n’ Roll, die der Babyboomer der englische Beat- und der Prog-Rock der 1970er-Jahre.
Manche der Babyboomer mussten sich nichts erkämpfen, den kulturellen Wandel hin zum Progressiven erledigten die paar 1968er für sie. Sie kamen also ohne Revolution zu neuen Freiheiten.
Dieser Umstand prägte ihr Verhalten. Sie waren in ihrer Jugend, und sie sind es bis heute, Salonkommunisten und Verbalradikale, stehen also in einer guten österreichischen Tradition. Österreicher diskutieren gerne über die Revolution, setzen sie aber garantiert nicht in die Tat um. Die jungen Arbeiter führten in den Wirtshäusern das große Wort, streikten jedoch nie, und die Studenten saßen lieber in Teach-Ins und diskutierten über die Weltrevolution. Im Vergleich zu Ländern wie Frankreich oder Italien tat sich in Österreich auf der Straße wenig, abgesehen von ein paar Friedensdemonstrationen und einigen Sozialdemos, die von der Gewerkschaft dominiert wurden und mehr den Charakter von Bitt- und Bußmärschen hatten.
Heute sind die Babyboomer größtenteils in Rente oder stehen kurz davor. Sie sind überwiegend zufrieden mit dem, was sie erreicht haben, fürchten sich aber, ihr Erreichtes verlieren zu können.
Hier können Sie das Buch bestellen: „Babyboomer gegen Generation Z: Vom Ende des neuen Biedermeier“

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .