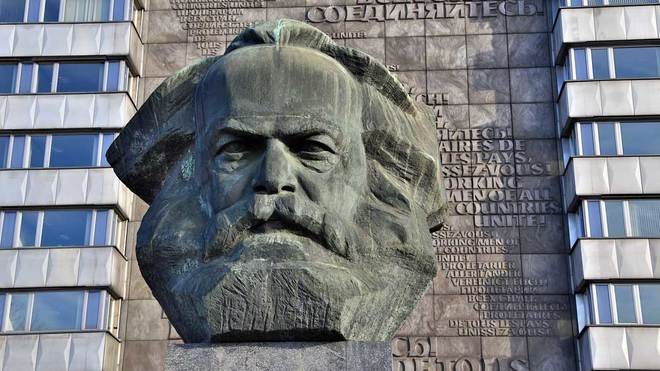Hermann Hesse schrieb Ende Juli 1938 eine Postkarte an den Lyriker und Erzähler Carl Gemperle.
Dieser hatte sich nach Ernst Wiechert erkundigt, den einstigen Berliner Studienrat, der später zu den erfolgreichsten Schriftstellern der „inneren Emigration“ (2) gehörte. Wiechert war im Mai von der Gestapo in Haft genommen worden und, nachdem er seine „staatsfeindlichen Erklärungen“ nicht widerrufen hatte, in das Konzentrationslager Buchenwald abtransportiert worden. Nach einer lebensbedrohlichen Unterredung mit Joseph Goebbels wieder entlassen, durfte er zwar weiter publizieren, doch durften seine Schriften nicht mehr beantwortet werden.
In Bezug auf die Haft seines Freundes — einem „von den wenigen Deutschen mit etwas Courage“ (3) — beschrieb Hesse das Leben in seiner Zeit als ein Schwimmen durch Leid, das eigene wie das fremde, das einen umgebe und heimlich beherrsche. „Unterwegs zu Zuständen, in denen das Leid nicht mehr weh tut, und das Glück nicht mehr begehrenswert scheint“ (4), strebte er in seinem Schweizer Bergdorf Montagnola nach einem Ort der Ruhe und Inspiration. Früh fragte er sich: Woran gehe ich eher zugrunde? An der Schuld, meine Mitmenschen „im Stich“ gelassen zu haben? Oder an dem Mangel an Mitmenschlichkeit, der mich gerade durch sie umgibt?
In Hesses Fall war die Entscheidung relativ eindeutig: „Lieber Zehn Mal am Leibe verderben, als Schaden nehmen an seiner Seele.“ Vom streng pietistischen Elternhaus her körperlich nie einem Mangel ausgesetzt gewesen, kannte er das Gefühl, geistig-seelisch auf Grundeis zu laufen.
Eine Umgebung, in der er Ruhe und Inspiration für sein literarisches Schaffen fand, war dem Pazifisten wichtiger als die Treue zu einem Land, das sich tagtäglich selbst verriet.
Doch die ersehnte Ruhe blieb dem Steppenwolf nicht gewährt. Seinerseits zu sehr Christ, als dass er im Notfall sogar das Getötetwerden dem Töten vorzog (5), nahm Hesses Seele dennoch an beiden Weltkriegen teil: Aus seiner äußerlich heilen Welt im Tessin beantwortete er rund 17.000 Briefe, bot vielen Verfolgten auf ihrer Durchreise Obdach oder verhalf zu diversen Schweizer Aufenthaltsgenehmigungen. Von Herzen – aber um den Preis seiner Ruhe. Äußerlich wie innerlich verfolgten ihn die Missstände. In einem solchen Ausmaß, dass er schrieb:
„Ich bin mit Flüchtlings- und Emigrantensorgen, neben den eigenen, so überladen, dass es kein Leben mehr ist. Und dazwischen kommt dann alle paar Tage noch ein 17- oder 18-jähriger Jüngling mit Versen, voll Sorgen um die Entwicklung seiner Persönlichkeit, und begreift gar nicht, dass die Welt voll ganz andrer Sorgen steckt.“ (6)
Während er diese nicht nur als krank an Ungerechtigkeit, sondern noch kränker „aus Mangel an Liebe, an Menschentum, an Brudergefühl“ betrachtete, schrieb er 1936 an Kuno Fiedler:
*„Die Menschen von unserer Art leben heut alle in der Emigration. Wir sind ohne Heimat inmitten dieser Welt der bewaffneten Macht und der Sprechchöre. Wenn wir den Tod in Freiheit sterben dürfen statt hinter Gittern, ist es schon viel.“ *(7)
Was Hesse dazu führte, seinen Glauben — und mit ihm seine Hoffnung auf eine bessere Welt — auf andere Ebenen zu verlagern.
Je weniger er an seine Zeit glauben konnte, desto mehr an die Magie der Liebe (8). Früh erkannte er, dass das, was seine Zeit brauchte und verlangte, nicht geschicktes Beamtentum und Betriebsamkeit waren, sondern Persönlichkeit, Gewissen, Verantwortlichkeit (9).
Vielleicht war dies auch ein Grund, weshalb er Ernst Wiechert so schätzte. Nachdem dieser Hesse sein Werk Wälder und Menschen zugesandt hatte, schrieb er zurück: „Lieb war mir auch der Umgang mit den paar Menschen dort, von denen es fraglich ist, ob sie nicht mehr in die Welt passen, oder ob gerade ihrer die Welt zu ihrer Erholung und Verjüngung bedarf.“ (10)
Denn obwohl Hesse wenige Wochen nach diesen Klagen selbst schrieb, dass er in jüngeren Jahren wohl auch verzweifelt wäre (11), war sein späterer Glaube an „eine gewisse Stabilität des Menschen“ größer. Für ihn waren das Geld, das Geschäft, die Maschine und der Staat „die Erscheinungsformen des Teufels in unsrer Zeit“ (12). Zugleich aber vertraute er darauf, dass „von jeder Teufelei am Ende mit schlechtem Gewissen erwacht und dass jeder Korruption ein neues Verlangen nach Sinn und Ordnung folgt“ (13) — auch wenn er selbst nicht mehr glaubte, das Wiederansteigen der Kurve zu erleben. Er selbst sei „müde und alt geworden“.
Die Desillusionierung saß ihm in den Knochen. Er schrieb:
„Zweimal im Leben so ‹große Zeiten› zu ertragen, ist wohl zu schwer, aber das, was wir meinen und wofür wir leben, wird bestehen, auch wenn das Theater von heut verklungen und das Blut verraucht ist.“
Verzweiflungsanfälle „an sich selber und über die Unwirksamkeit des Geistes auf die Welt“ müsse man ernst nehmen — sie enthielten Weisheit (14). Nur Wenigen sei das Erlebnis des Tragischen möglich, noch seltener den „Auserwählten“, „denen es gelingt, durch die Hölle hindurch zu gehen und jenseits den Himmel zu finden“ (15).
Nicht nur glaubte Hesse zu wissen, „dass jeder Wille zur Änderung der Welt zu Krieg und Gewalt führt“ (16) — er hielt auch die Bosheit auf Erden für unheilbar. Das Einzige, was wir ändern könnten, seien wir selbst: „Unsere Ungeduld, unser Egoismus (auch der geistige), unser Beleidigtsein, unser Mangel an Liebe und Nachsicht“ (17).
Den „intellektuellen Kampf gegen Unfreiheit und Gewalt“ hielt er nicht für eine Tätigkeit, die einen Leidenden aufrichten könne. Für Hesse war es „ganz einerlei, ob Hitler oder Trotzki die Kanonen befehligt — wohl ihm, wenn er an den Wert seines Tuns glaubt; die Welt ändern wird er nicht, da er nicht am Angelpunkt steht“. Dieser liege „innen in jeder Seele“, weshalb man zwar für seinen Glauben sterben, aber nicht für ihn töten dürfe (19).
Seinen eigenen Glauben beschrieb Hesse als „einen ganz bestimmten“, einen persönlichen, einmaligen, der sich nicht lehren ließe (20). Er glaubte an den Menschen — genauer: an das Individuum, den gereiften Einzelnen.
„Dieser Glaube an die Menschen“, führte er aus, „das heißt daran, dass der Sinn für Wahrheit, das Bedürfnis nach Ordnung dem Menschen innewohnt und nicht umzubringen ist, hält mich über Wasser. Ich sehe im übrigen die heutige Welt wie ein Irrenhaus und ein schlechtes Sensationsstück an, oft bis zum tiefsten Ekel degoutiert, aber doch so, wie man Irre und Besoffene ansieht, mit dem Gefühl: Wie werden die sich schämen, wenn sie eines Tages wieder zu sich kommen sollten!“ (21)
Dieses „Zu-sich-Kommen“ — an seinem Mangel schien der Zeitgeist schon damals zu kranken. Doch auch heute wirkt es, als habe die Welt abermals den Verstand verloren. Oder sollte ich besser sagen: die Menschheit ihr Herz? An ihm und dem Glauben an das, was möglich ist, fehlt es. An seiner Lücke leidet der Einzelne, weil er seine Zeit als einzige Wirklichkeit erleben muss, die jemals lebbar sein wird.
Fragt sich nur: Wie viel Leid will er noch in seiner Zeit entstehen lassen, ehe er anfängt, ihr neuen Geist einzuhauchen?
Hier können Sie das Buch bestellen: „Sein statt Haben“

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
(1) Hesse, Hermann (2018): “In den Niederungen des Aktuellen“: Die Briefe. 1933-1939. Suhrkamp Verlag. Seite 555.
(2) Ebenda, Seite 710.
(3) Ebenda, Seite 532.
(4) Ebenda, Seite 543
(5) Ebenda, Seite 52.
(6) Ebenda, Seite 552.
(7) Ebenda, Seite 448.
(8) Ebenda, Seite 29.
(9) Ebenda, Seite 41.
(10) Ebenda, Seite 532.
(11) Ebenda, Seite 573.
(12) Ebenda, Seite 631.
(13) Ebenda, Seite 641.
(14) Ebenda, Seite 61.
(15) Ebenda, Seite 73.
(16) Ebenda, Seite 109.
(17) Ebenda.
(18) Ebenda.
(19) Ebenda, Seite 165.
(20) Ebenda, Seite 474.
(21) Ebenda, Seite 449f.