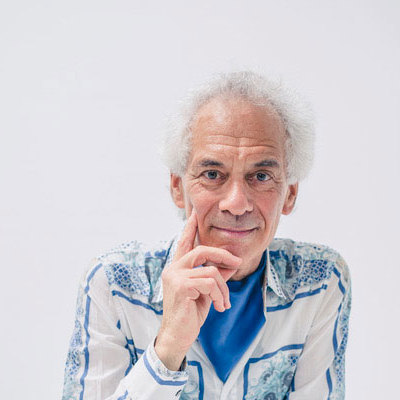5 ) Auch beim Begriff „Entwicklung“ ist die Frage des eigenen Verständnisses wesentlich. Ich benutze dieses Wort deshalb nicht, weil es einer vorgegebenen Norm entspringt und entspricht. Diese Norm geht von der Vorstellung eines „normalen Weges“ nach oben, zum Erfolg hin aus. Auf diesem festgelegten Weg sollen Menschen durch bestimmte Maßnahmen dazu gebracht werden, sich so zu verhalten wie es normativ vorgegeben ist, um über festgelegte Entwicklungsstufen zum festgelegten Ziel zu gelangen. Und wer sich nicht so entwickelt wie vorgegeben und erwartet — das heißt: wer nicht die normierten Entwicklungsstufen hinaufläuft und vom normativ festgelegten Weg abweicht —, hat wohl ein Problem („Entwicklungsschwierigkeiten“) und bedarf als Patient der Hilfe, die ihm von Experten gegeben wird. Wird er durch „Entwicklungshilfe“ eine Rettung erfahren? (1)
Ich umgehe diesen aus meiner Sicht problematischen Begriff „Entwicklung“, indem ich vom „Sich-Entfalten“ spreche — wohlgemerkt in der Rückbezüglichkeit. Denn das, was sich entfaltet, ist dem Wesen innewohnend, ist schlicht da und ruft danach, sich zu materialisieren. Im Übrigen kombiniere ich das Sich-Entfalten am liebsten mit dem Adjektiv „gedeihlich“: Alles Leben strebt stets danach, gedeihlich sich zu entfalten.
6) Nur zur Erinnerung: Wie oft hört man den Satz, Eltern schicken ihre Kinder in die Schule? Wie ich zu sagen pflege: der Gebrauch dieses Wortes schicken ist nicht nur ungeschickt oder gar unschicklich, sondern zugleich sehr verräterisch. Wird nicht ein Brief, ein Paket geschickt? So entlarvt die Forderung, unsere Kinder in die Schule zu schicken, die zugrundeliegende Logik, wonach unsere Töchter und Söhne zu Sachen, zu Objekten gemacht werden. Hier bedarf es keines Gegenbegriffs, denn die an sich so perverse Angelegenheit wird durch den Einsatz eines anderen Begriffs nicht besser.
7) Den nächsten Begriff, der zumeist fehlgenutzt wird, möchte ich im Sinne einer Ehrenrettung aufgreifen. Dort, wo zumeist von „Disziplin“ gesprochen wird, geht es in Wirklichkeit um Gehorsam und Unterwerfung. Für mein Verständnis ist Disziplin eine durchaus positive Kategorie, welche die den Gegenständen innewohnenden Strukturen artikuliert. Ist in der Gestaltung der Kommunikation Disziplin nicht die Voraussetzung dafür, dass sich mindestens zwei Menschen klar verstehen und verständigen können?
In meiner Hygiene ist Disziplin die Bedingung zur Erhaltung meiner Gesundheit. Will heißen: die Disziplin ist nichts, das das Subjekt unterdrückt, entfremdet oder enteignet, sondern im Gegenteil eine durchaus nachvollziehbare Organisation, die mich im Entdecken geradezu unterstützt. Anders ist es jedoch mit dem Gehorsam, der selbstverständlich nach außen, nach oben ausgerichtet ist — im Gegensatz zum nach innen gerichteten Horchen.
(Deshalb pflege ich zu sagen: „Horchen statt Gehorchen!“)
Der ehemalige Leiter eines berühmten Internats, Bernhard Bueb, hat das Buch „Lob der Disziplin“ (2) publiziert, das allerdings eher „Lob des Gehorsams“ hätte heißen sollen, denn nur darum ging es. Vom Gehorsam geht es dann schnell zu einer der „Haupttugenden“ der deutschen Erziehung: zur Anpassung.
Eine (bösartige?) Nebenbemerkung: Disziplin gibt es selbstverständlich auch im Schreiben, doch setzt diese voraus, dass Menschen einen Bezug zu ihrer schriftlichen Sprache haben. Nachdem ihnen diese Disziplin durch die Beschulung weitgehend genommen worden ist, kam der Gedanke auf, ihnen dank einer „neuen deutschen Schlechtschreibung“ entgegenzukommen. Können Menschen nun richtiger schreiben? Die Praxis hierzulande weist leider in entgegengesetzte Richtung: dorthin nämlich, dass bei so vielen Menschen das Sprachgefühl in alarmierender Weise gestört wurde. Dies zeigt sich etwa beim Schreiben von „das“ und „daß“ bzw. neudeutsch „dass“. Im Gegensatz hierzu erweisen sich nicht verschulte Menschen, die aus sich heraus die Orthographie erforschen, als ganz disziplinierte Schreiber!
Wer nun die Argumente von (Schul-)Behörden, Jugendämtern und Justiz studiert, entdeckt, dass diese im Allgemeinen von der Befürchtung ausgehen, Menschen würden ohne Schule nach dem bloßen „Lustprinzip“ leben und keine Strukturen erfahren; doch im Leben gibt es nun einmal solche Ordnungssysteme.
Die Praxis von ohne Schule aufwachsenden, frei sich bildenden Menschen zeigt vielmehr, wie strukturiert diese sind — sozusagen im Gegensatz zur mangelnden Eigenstrukturierung von zu bloßem Gehorsam erzogenen Schülerinnen und Schülern. Es ist daher wichtig, bei Konflikten neben der sogenannten „intrinsischen Motivation“ auch die Strukturierung im Leben hervorzuheben und darzustellen.
8) Hieraus folgt fast selbstverständlich ein weiterer Begriff: „Gewalt“. In manchen Zusammenhängen ist das Wort „Gewalt“ kein wirkliches Problem — etwa, wenn die „drei Gewalten“ (Legislative, Exekutive, Judikative) des demokratischen Staates beschrieben werden sollen. Hierbei steht Gewalt für Verwaltung. Über die Art und Weise, wie diese Verwaltung strukturiert wird, sodass sie dem Leben, der Natur und dem Menschen dienen, darf konstruktiv gerungen werden. Bezieht sich allerdings die Gewalt auf ein aggressives oder gar zerstörerisches Verhalten, ist sie verpönt und verboten. Obwohl dies inzwischen den meisten Menschen theoretisch klar sein dürfte, erhebt sich dennoch die wesentliche Frage, wer überhaupt Gewalt als solche definiert. Diese Frage ist besonders in den Beziehungen zwischen den Generationen wichtig: Beanspruchen nicht oftmals Menschen, ihre Handlung sei ja nur wohlgemeint gewesen? Davon abgesehen, dass Wohlmeinen nicht unbedingt als Wohltun empfunden wird, ist es von großer Bedeutung zu definieren, dass über die Definition von Gewalt nicht jene zu entscheiden haben, die sie — aus welchen Gründen auch immer — ausüben, sondern jene, die sie erleiden. Hier beispielsweise die Töchter und Söhne.
Vom gesetzlich verankerten und klaren Verbot jedweder erzieherischen Gewalt (BGB § 1631) ausgehend, kann sich hieraus ein in einer bestimmten Situation unauflösbares „strukturelles Dilemma“ ergeben: Eltern haben die Schule befürwortet und die Tochter oder den Sohn angemeldet; sie oder er ist eine Zeit lang hingegangen — und stellt schließlich fest: „Nein, das ist nichts für mich!“ „Da werde ich nur misshandelt!“ „Auf mein Interesse wird nicht eingegangen!“ „Ich werde gemobbt!“ „Es langweilt mich!“ — kurz: sie oder er artikuliert — verbal oder durch allerlei Symptome —, dass sie oder er nicht will. Wohlgemerkt: der Mutter und dem Vater sind manipulative Maßnahmen oder gar körperliche Drohungen oder Strafen klar untersagt. Was tun?
Da von einer drohenden oder bestehenden „Erziehungsunfähigkeit“ keine Rede sein kann, kommt es in solchen Fällen zu entsprechenden Gerichtsbeschlüssen: In der Dokumentation zur Erfurter Petition (3) wurden mit Bedacht 30 Seiten den in Deutschland in den letzten Jahren errungenen Urteilen gewidmet, die Mütter oder/und Väter von Vorwürfen, „nicht für die ordnungsgemäße Beschulung gesorgt zu haben“, befreiten — weil eine klare ethische Haltung juristisch nicht ohne positive Konsequenzen bleiben kann, bis die Legislative endlich den Wandel ermöglicht.
Wer Gewalt bewusst ablehnt, möge fünferlei bedenken:
Ein Leitsatz der Gewaltprävention ist die klare Aussage: „Nein heißt nein!“ Was in den Beziehungen zwischen Frauen und Männern offensichtlich ist, muss selbstverständlich auch im Zwischengenerationellen gelten.
In Familien, in denen Töchter und Söhne ihren Müttern und Vätern vertrauen — zumal sie keinerlei Gewalterfahrungen erleiden mussten — besteht kein Anlass zur Sorge, dieses Nein könne einer bloß kapriziösen Unlust entspringen. In Wirklichkeit ist das im Vertrauen artikulierte „Nein!“ die Hebamme des „Ja!“ zum Leben.
Gewalt ist nicht nur das Ausüben offener, verletzender, körperlicher Kraft gegen einen unterlegenen Mitmenschen; Gewalt ist auch der ganze Komplex, der als strukturelle Gewalt bezeichnet wird. In der Schule könnte es Mobbing sein; als herabwürdigende Bemerkung, etwa von einer Lehrautorität; oder als jede Art von Misshandlung — bis hin zum heimlichen oder offenen Terrorisieren. Als „strukturelle Gewalt“ kann allerdings auch das ganze Organisationsschema, das „System“ der Beschulung bezeichnet werden. Ein Beispiel hierfür ist in Österreich der enorme Druck, den die sogenannte „Externistenprüfung“ ausübt: eine subtile Form der Unterwerfung unter ein widersinniges (und widerliches!) schulisches Diktat. Ist es da nicht naheliegend, dass die Tochter oder der Sohn — dank der bisherigen guten, vertrauensvollen Begleitung — auf diese Gewalt mit einem nachvollziehbaren und gesunden „Nein!“ reagiert?
Wer dieser Gewalt als Normalität ausgeliefert ist, wird sie zur Selbstverständlichkeit erheben — durch „Identifikation mit dem Aggressor“. Die Folgen sind wahrlich fatal.
Wie artikuliert sich dieses „Nein!“? Dies kann auf andere Weise als verbal geschehen — etwa durch körperliche Symptome: verschiedene (Selbst-)Verletzungen („Ritzen“), durch Schlafstörungen, Albträume, Magenschmerzen, Kopfschmerzen oder Schweißausbrüche; ebenso durch besonders aggressives Verhalten oder durch Rückzug, Schweigen und stilles Leiden. Wer solche Symptome nicht als das erkennt, wofür sie stehen, riskiert, dass die geliebte Tochter oder der geliebte Sohn in eine Richtung der inneren Abwehr gezwängt wird, um die traumatisierende Situation zu bewältigen und zu verdrängen.
Es ergibt sich hier fast von selbst, dass es keines „Ersatzbegriffs“ bedarf: das Wort „Frieden“ (sogar verstanden als „Abwesenheit von Krieg“) dürfte wohl zu schwach und abgegriffen sein, um eine Lebensqualität zu beschreiben, in der Menschen selbstverständlich gut miteinander leben.
9) Der nächste Begriff ist von ethisch besonderer Bedeutung: „Erziehung“ (4). Vor allem dann, wenn es zu einer Auseinandersetzung mit Jugendamt oder Familiengericht kommt (beispielsweise aufgrund der Ablehnung von Gewalt, um die Tochter oder den Sohn in die Schule zu „schicken“!) und die Frage der „Erziehungs(un)fähigkeit“ gestellt wird. Auch hier gilt es klar zu erkennen, dass die dichotome Kategorie Erziehung für die Abrichtung des Nachwuchses steht, damit dieser zwangsweise in die „Normen der Normalität“ eingepasst wird. Es erscheint mir unsinnig und kontraproduktiv, diesen Begriff für etwas anderes zu verwenden.
Im Übrigen dürfte die oft zu hörende Losung: „Beziehung statt Erziehung!“ deshalb verfehlt sein, weil auch Erziehung eine Form von Beziehung ist — wenn auch eine pervertierte.
Die ganz außer Zweifel stehende Tatsache, dass die geliebte Tochter oder der geliebte Sohn für ihr oder sein gesundes, gedeihliches Sich-Entfalten zweifellos der gesunden Mutter und des gesunden Vaters bedarf, möchte ich als Begleitung umschreiben: Diese wunderbare Aufgabe beruht auf der Selbstverständlichkeit, dass alle Beteiligten Subjekte sind und sich als solche in eine Kommunikation einbringen. Wenn es mit Behörden und Gerichten zu Auseinandersetzungen rund um die sogenannte „Erziehungsunfähigkeit“ geht, scheint es mir wichtig, hier durch eine klare Position diesem unhaltbaren Argument wirksam und konstruktiv zu begegnen.
10) Zu guter Letzt sei ein Begriff aufgeführt, der einem weiteren Tabu entspringt und in den Auseinandersetzungen mit Behörden und Justiz im Zusammenhang mit unseren Töchtern und Söhnen in Bezug auf ihr angebliches Werden von größter Bedeutung ist: „Arbeit“. Hierbei möchte ich klarstellen, dass ich für dieses Wort die offizielle und gesetzliche Definition heranziehe: Arbeit beschreibt eine zumeist von außen diktierte, zweckgebundene und zielgerichtete Leistung, die gegen Geld erfolgt und — da steuer- und sozialversicherungspflichtig — ins Bruttoinlandsprodukt als den statistischen Maßstab unseres nationalen Wohlstands einfließt.
Deshalb beschreibt Arbeit nun einmal nicht, dass jemand sich beschäftigt, sich mit der Herausforderung einer Aufgabe auseinandersetzt, sich aktiv und kreativ einbringt, sich leidenschaftlich, gar genial einer wichtigen Sache widmet. Für all dies verwende ich Begriffe wie Aktivität, Tätigkeit, Beschäftigung, Auseinandersetzung oder Engagement.
All diese Erfahrungen können und sollen auch jungen Menschen gewiss nicht vorbehalten oder vorenthalten bleiben. Worauf sollte sich das ausgesprochene „Kinder-Arbeitsverbot“ beziehen? Selbstverständlich auf ein Verbot der Ausbeutung! Was angesichts der Exzesse der Frühindustrialisierung nachvollziehbar erscheinen mag, ist hierzulande jedoch inzwischen völlig unnötig, da uns insgesamt die Arbeit an sich ausgeht. Deshalb sollte befreiend darüber nachgedacht werden, wie sinnvoll es ist, junge Menschen viele Stunden täglich in einer Schule einzupferchen, wenn sie sich lieber aktiv für etwas engagieren würden. (Bitte haben Sie vor Augen: Da kämpft eine wohlmeinende Lehrerin an der „pädagogischen Front“, ihr gegenüber eine „wilde Meute“ von 13-, 14- oder 15-Jährigen, die kein Interesse am Lehrplan haben und viel lieber draußen etwas leisten würden. Wie sinnvoll ist das? Der Wichtigkeit wegen sei wiederholt: Nein, dies ist kein Plädoyer für die Ausbeutung durch korrumpierendes Geld, sondern ein Hinweis darauf, dass der Mensch von Natur aus sich in sein soziokulturelles Umfeld einbringen möchte — und zwar altersunabhängig.) Wer in den ersten Lebensjahren in seinem Aktiv-Sein gewürdigt wurde, wird eher seiner eigentlichen Berufung folgen.
In möglichen Auseinandersetzungen mit Behörden und Justiz dürfte es wesentlich sein hervorzuheben, dass die Tochter oder der Sohn bereits aktiv, kreativ, kompetent und engagiert ist. Ein möglicherweise wichtiges Argument könnte in diesem Zusammenhang die Aussage aus der Leitwirtschaft sein, wonach sie „mit dem schulischen Schrott nichts anfangen könne“ und nun händeringend nach engagierten, aktiven, kreativen Menschen sucht.
Ein weiteres Argument in diesem Zusammenhang: Nicht nur spielen schulische Diplome in immer mehr Berufssparten keine wirkliche Rolle mehr; inzwischen ermöglichen viele Universitäten (aus guten Gründen!) ein Studium ohne Abitur/Matura — allenfalls mit einem Eingangstest. Selbst die oft vorgebrachte Logik: „Schule → Hochschule → Diplom → Beruf → Geld → Erfolg → Prestige stimmt heute nicht mehr. Wer die Biographien wichtiger Persönlichkeiten studiert, wird oftmals feststellen, dass sie sehr originelle Wege gingen ... und deshalb so wesentlich wurden!
Selbstverständlich wäre es wichtig, über die „toxischen Begriffe“ hinaus auch „toxische Situationen“ klar zu benennen, von denen einige in diese Ausführungen mit eingeflossen sind. Eine der aus meiner Sicht dramatischsten Situationen, die womöglich als Schlüssel zum Verständnis so mancher Prozesse und Sackgassen unserer „Zuvielisation“ gelten kann, dürfte jene strukturelle Gewalt sein, die ich zuvor bereits als die „Normen der Normalität“ adressiert habe. Aufgrund solcher Normen werden Menschen nicht nur in ihrem Handeln manipuliert, sondern in ihrer ganzen Gefühls- und Denkweise, folglich in ihrer Wahrnehmung (und, wie ich gern sage, in ihrer „Wahrgebung“!). Was mit der Zeugung, der Schwangerschaft und der Geburt beginnt und sich über die Zeit vor der Schule, die Jahre in der Schule bis hin zum letzten Atemzug erstreckt, hängt in erster Linie mit eben diesen subtilen „Normen der Normalität“ zusammen.
Ist es nicht tröstlich, dass immer mehr Menschen die Lüge solcher Normen entdecken? Dass sie klar erkennen, wie sehr diese künstlich geschaffenen Setzungen ein Irrtum sind, der im Widerspruch steht: zum einen mit dem Lebendigen, dem Natürlichen, dem Menschlichen; zum anderen mit dem, was unsere Verfassungen und Menschenrechtskonventionen postulieren und letztlich mit dem Sinnvollen und Logischen?
Dies gibt (mir!) Anlass zur Zuversicht: Selbst, wenn wir, „(V)Erwachsene“, uns wohlerzogen verhalten wollen oder sollen, so könnte es sein, dass unsere geliebten Töchter und Söhne es ablehnen, sich in diese Sackgasse der „Normen der Normalität“ hineinmanövrieren zu lassen — und zwar aus gutem Grund! Besteht nun unsere „heilige Aufgabe“ nicht geradezu darin, auch Behörden und Justiz davon zu überzeugen, wie sehr ihre Grundannahmen unzutreffend sind?
Es gibt gute Argumente, welche Chancen es für uns alle, aber vor allem für unsere Töchter und Söhne, bedeutet, sie eben nicht den „Normen der Normalität“ zu unterwerfen, wozu die obsolete Beschulungsideologie in erster Linie zählt, sondern ihnen das Vertrauen zu schenken, dass sie kompetent und wirkmächtig sind, ein erfülltes Leben zu führen: eben im Sinne dessen, was ein gedeihliches Sich-Entfalten meint. Ein Ausdruck dieser würdevollen Dynamik ist das frei sich Bilden.
Mit der hier vorgenommenen Erörterung von zehn meiner Meinung nach besonders „toxischen Begriffen (die Liste könnte gewiss fortgeführt und erweitert werden!) hege ich kein „sprachpolizeiliches“ oder „sprachmoralistisches“ Ansinnen. Nach meinem Dafürhalten und meinen bisherigen Erfahrungen spiegelt die sprachliche Klarheit und Eindeutigkeit eine deutliche und eindeutige ethische Haltung wider, ohne die der irrsinnigen staatlichen Übergriffigkeit kaum wirksam und erfolgreich Paroli geboten werden kann. Anders formuliert: Der Gedanke, dass ein grundlegender Wandel ansteht, weil es um unser aller Leben und Überleben geht, erfüllt mich mit Freude und Zuversicht — vor allem, da das ethische Rückgrat dieses Wandels von jedem einzelnen Menschen, dir und mir, getragen und geprägt wird; wir selbst vermögen es, dies zu ermöglichen — durch unsere sprachliche Bewusstheit.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
(1) Gibt es eine Art von Parallelität zwischen der psychologischen Entwicklungshilfe und der von Ländern der 1. Welt den Ländern der sog. 3. und 4. Welt gewährten Entwicklungshilfe? Sind die systemimmanenten Mechanismen nicht ähnlich?
(2) Bernhard Bueb, Lob der Disziplin. Eine Streitschrift. List, Berlin 2006, ISBN 3-471-79542-1; Ullstein Taschenbuch, Berlin 2008, ISBN 978-3-548-36930-3.
(3) Zu dieser „krimihaften“ Dokumentation der von Dr. Katja Senkel eingebrachten Erfurter Petition: https://progenia.ch/shop/produkte/buchwelten/thueringen-vorreiter-land-der-bildungsfreiheit/
(4) Hier sei insbesondere auf Ekkehard von Braunmühl, Antipädagogik — Studien zur Abschaffung der Erziehung Weiheim und Basel (Beltz) 1975; Leipzig (tologo verlag) 2006; verwiesen.