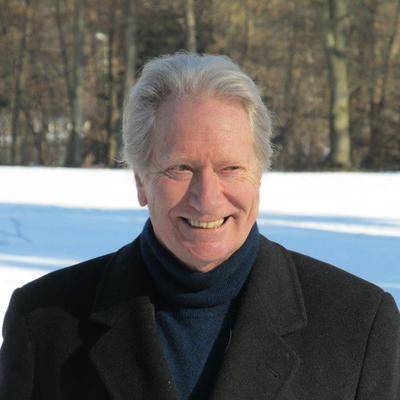Es war kurz nach zehn, als Cording an diesem Abend nachhause kam. Er schaltete den Fernseher ein, Steve hatte eben angerufen und ihn darauf aufmerksam gemacht, dass auf CBS eine Tahiti-Reportage lief. Leider bekam er nur noch die letzten fünf Minuten davon mit und die waren mit Tanzdarbietungen, Surfern und einem Sonnenuntergang gefüllt. In wie weit das Tahiti-Projekt in dem Bericht eine Rolle gespielt hatte, konnte er nicht beurteilen.
Cording überlegte, wann die Zeit gekommen wäre, in London anzurufen. Das Team brauchte mindestens 48 Stunden, um hierher zu kommen. Einigermaßen ausgeschlafen sollte es ja auch sein. Er verstand Omais Bedenken, wenn er sie auch nicht ganz teilte. Schließlich hatte Mike mit seiner Veröffentlichung der Rasmussen-Papiere Mut bewiesen und gezeigt, bei wem seine Loyalitäten lagen. Aber man wusste ja nie. Die Chefetagen verfügten immer über Mittel, ihre Leute wieder auf Linie zu bringen.
Die Tatsache, dass Omais Plan in ganz Polynesien bekannt war, während der Rest der Welt nicht die leiseste Ahnung davon besaß, war für Cording kaum zu glauben, wenn er an die engmaschige Vernetzung im Global Village dachte. Omai hatte sich des gleichen Tricks bedient, den die Amerikaner im zweiten Weltkrieg angewandt hatten, als sie nach Pearl Harbor dazu übergegangen waren, ihre Geheimcodes in der Navajosprache abzufassen. Die Navajo-Sprache kennt keine modernen Worte, es war für den Feind unmöglich, das komplexe System aus Lautmalereien, phonetischen Feinheiten und bildlichen Umschreibungen zu durchschauen.
Omai war noch einen Schritt weiter gegangen, er benutzte eine vergessene Kunstsprache. Vor fünfzehn Jahren hatte der Präsident der Victoria Universität auf Samoa die Idee gehabt, die verschiedenen maorischen Dialekte in einer für alle verständlichen Form zu einer Art polynesischen Esperantos zusammenzufügen. Das Experiment war kläglich gescheitert, aber die Sprache, die nie zum Leben erweckt worden war, schlummerte noch in den Archiven. Jede Gemeinde, mit der es Omai auf seinem Werbefeldzug zu tun hatte, konnte sich ohne weiteres aus den vergessenen Büchern bedienen.
Cording strich sich mit der Handfläche übers Kinn und stellte fest, dass es höchste Zeit war, sich zu rasieren. Und da er sich lieber vor dem Einschlafen rasierte als morgens nach dem Aufwachen, verschwand er im Badezimmer und kramte eine neue Klinge, Rasierschaum und Pinsel hervor. Während der Apparat sein Gesicht wie ein Schneepflug von der weißen Schaumpracht befreite, sah er im Spiegel die üblichen Horrorbilder auf dem Fernsehschirm.
Es war immer der gleiche elende Salat, den die Nachrichtensendungen seit Jahren auftischten: Feuersbrünste, Verhaftungen, Helikoptereinsätze, Politikerstatements, abgemergelte Kinder an den schlaffen Brüsten ihrer afrikanischen Mütter, eine Prise Basketball, Börsenkurse und Wetterberichte. Plötzlich hielt er inne. Sie fischten eine Leiche aus dem Potomac, das war an sich nichts Besonderes, aber Cording glaubte, ihn träfe der Schlag. Kurz bevor ein Polizist den Reißverschluss des Plastiksacks zuzog, war die Kamera auf das Gesicht des Toten gezoomt. Die Leiche war übel zugerichtet und grotesk aufgeschwemmt, aber trotzdem glaubte er für einen Moment, die charakteristischen Züge Thorwald Rasmussens erkannt zu haben. Jetzt spinn nicht rum, dachte er, da hat dir dein Unterbewusstsein einen Streich gespielt. Seit Rasmussens Verschwinden lebte ja auch er in latenter Angst.
Dennoch: die Sache ließ ihm keine Ruhe. Er ging hinüber zu Steve und bat ihn, die aktuellen CBS-News übers Internet aufzurufen.
„Stop!“, rief er, als der Leichensack geschlossen wurde. „Noch mal zurück. So ist gut. Kannst du das Bild vergrößern?“
Steve gehorchte und brachte das entsetzlich entstellte Gesicht formatfüllend auf den Schirm. Diesmal war sich Cording nicht mehr so sicher.
„Was meinst Du?“, fragte er den Jungen. „Könnte das Rasmussen sein?“
„Glaub ich nicht“, antwortete Steve. „Der Kerl muss ziemlich lange im Wasser gelegen haben, dem sind die Gesichtszüge ja total entglitten. Klar, bei sehr viel guten Willen lässt sich eine gewisse Ähnlichkeit nicht leugnen. Aber was bedeutet das schon?“
Er drehte sich schmunzelnd um.
„Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Rasmussens Entführer, falls sie ihn denn überhaupt umbringen wollten, keine effektiveren Methoden kennen würden, als ihn im Potomac zu versenken, an dessen Ufern er garantiert wieder auftauchen wird. So blöde können die gar nicht sein ...“
Da war was dran. So dumm waren sie nicht. Schon gar nicht, in einer so hochbrisanten Angelegenheit. Cording legte Steve die Hand auf die Schulter und ging zurück in sein Zimmer.
Als er am nächsten Morgen aufwachte, saß der Stachel des Verdachts noch immer tief. Irgendwie mochte er sich von dem Gedanken, dass Rasmussen ermordet worden war, nicht verabschieden. Sein Instinkt, auf den er sich in den meisten Fällen verlassen konnte, beharrte auf dieser Annahme. Und mit ihr wuchsen die Bedenken, was die bevorstehende Protestaktion der Polynesier betraf. Jeden Tag landeten hunderte neuer Boote auf Tahiti an, die sich dem Pirogenzug nach Makatea anschließen wollten. Die Lagunen entlang der Südküste füllten sich, als leide die Insel unter einem seltsamen Pilzbefall.
Wer garantierte ihnen, dass Präsident Selby, der sich ja erstmals offen zu dem Raubbau bekannt hatte, keine Kriegsschiffe gegen Omais Armada in Marsch setzte? Was passierte, wenn der Pirogenzug auf offenem Meer beschossen und niedergepflügt würde? Eine schreckliche Vorstellung, die so abwegig nicht war. Außer ihm aber schien sich in Omais Stab niemand darüber Gedanken zu machen. Die logistischen Vorbereitungen für das Unternehmen liefen auf Hochtouren. Cording kam sich dabei ein wenig überflüssig vor. Omai bekam er nur selten zu Gesicht, Maeva ging ihren Pflichten an der Universität nach und Steve ließ sich nur ungern bei der Arbeit am Table Mac stören. Immerhin verriet ihm der Junge, dass es ihm gelungen war, via Internet die zusätzliche Unterstützung ganzer Yachtclubs bis hin nach Neuseeland einzuholen. Sogar ein deutsches Kreuzfahrtschiff, das zur Zeit vor den Pitcairns ankerte, hatte zugesagt, die Armada zu begleiten. Cording beschloss, den Verdacht, Rasmussen betreffend, zunächst für sich zu behalten.
Da seine Dienste in Papeete zur Zeit nicht benötigt wurden, beschloss Cording dem allgemeinen Trubel in der Hauptstadt für einen Tag den Rücken zu kehren. Er wollte sich so weit wie möglich zurück ziehen, bis ans andere Ende der Insel, wo keine Aufbruchstimmung, sondern Ruhe und Gelassenheit herrschten. Auf Iti gab es einen Platz, dessen schlichte Schönheit ihn bereits bei seinem ersten Besuch auf Tahiti überwältigt hatte. Der Point de Vue lag oberhalb der „kleinen Normandie“, jener landwirtschaftlichen Nutzfläche, auf der siebzig Prozent aller Erzeugnisse angebaut wurden, die die Tahitianer zum Überleben brauchten. Von dort hatte man einen wunderbaren Blick über das Tal auf die Taille der Insel, hinter der sich die dunkelgrünen Bergrücken von Tahiti Nui in der Sonne rekelten.
Der Elektroroller, den er sich an der Reva-Tae-Station Taravao genommen hatte, war durch den gar nicht so steilen aber stetigen Anstieg überfordert. Einen Kilometer unterhalb des Gipfels legte Cording das Gefährt in den Straßengraben und erklomm den Rest der Strecke zu Fuß. Oben angekommen ließ er sich auf einer leicht abfallenden Wiese voller Gräser und Wildblumen nieder, umgeben von einer Herde weißer Kühe, die kaum Notiz von ihm nahmen.
Was für eine grandiose Aussicht! Er lag unter einem strahlend blauen Himmel inmitten eines Paradiesgartens, der sich als farbenfroher Teppich in sanften Schwüngen dem Ozean näherte. Schon auf dem Weg hierher war ihm aufgefallen, dass es in der Gegend keine Zäune mehr gab, keine parzellierten Felder und Äcker, auf denen die Nutzpflanzen in Reih und Glied standen. Bemerkenswert auch, dass er auf den letzten Kilometern keinem einzigen Menschen begegnet war, als seien die Bauern kollektiv in die Ferien geschickt worden. Ihm fiel ein, was Maeva gesagt hatte, als sie ihn vor Wochen in einer quälend langen Lektion mit der Philosophie der neuen tahitianischen Landwirtschaft* vertraut zu machen versuchte:
„Um zu verstehen, wie Landwirtschaft betrieben wird, muss man das Wesen der Natur verstehen.“
Die Grundidee einer natürlichen Landwirtschaft bestand darin, durch die richtige Kombination von verschiedenen Pflanzen ein sich selbst erhaltendes Ökosystem zu schaffen, das kaum mehr weiter bearbeitet werden musste. Diese Mischkultur, in der sich die Pflanzen gegenseitig unterstützten, verhinderte das einseitige Auslaugen der Böden und sorgte dafür, dass die Hauptarbeit der Bauern in der Ernte bestand. Indem man die ursprünglichen Wildpflanzen stehen ließ, schaffte man einen Verbund robuster, widerstandsfähiger Gewächse, die keine Unterstützung des Menschen nötig hatten. Der Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln und Dünger war praktisch überflüssig geworden.
Er ließ eine handvoll Erde durch die Finger rieseln. Ein gesunder Boden, hatte er einmal gelesen, enthielt in der obersten Schicht durchschnittlich etwa 60.000.000.000.000 (!) Bakterien und 1.000.000.000 Pilze pro Kubikmeter. Zusammen mit den 600 Regenwürmern betrieben sie ihren eigenen Ackerbau. Was brauchte es den Menschen? Wie hatte Maeva gesagt?
„An der Natur gibt es nichts zu verbessern. Wenn der Mensch einmal angefangen hat, in die Natur einzugreifen, zerstört er die natürliche Ordnung und ist gezwungen, immer wieder für Ausgleich zu sorgen. Daraus entsteht eine Unmenge an sinnloser Arbeit und neuer Belastungen.“
Er musste an den Wahnsinn denken, welcher der heimischen Agrarwirtschaft innewohnte, die ausschließlich auf Hocherträge ausgerichtet war. Die konventionelle Landwirtschaft arbeitete nicht mit, sondern gegen die Natur. In ihr waren die Bauern von Verwaltern und Förderern der Natur zu Zwangsernährern verkommen, zu bedauernswerten Sklaven der Banken, der Maschinenfabriken und der Chemieindustrie. Na Mahlzeit!
Cording schloss die Augen und inhalierte die von den Düften tropischer Früchte geschwängerte Luft. Die Orangen, die sich unter der heißen Mittagssonne erhitzten, dominierten den aromatischen Äther und übten eine fast betäubende Wirkung auf ihn aus.
Er musste eingeschlafen sein, jedenfalls stand die Sonne erstaunlich tief. Wenige Meter neben ihm hatte sich eine Kuh ins Gras gelegt und schaute ihn aus großen Augen an. Wenn er es bei Tageslicht noch bis zum Reva-Tae schaffen wollte, musste er jetzt aufbrechen. Er stand auf und blickte ein letztes Mal über das weite Tal auf die zerklüfteten Berge von Tahiti Nui, die sich bereits in den Schattenmantel gehüllt hatten. Für einen kurzen Augenblick hatte er das Gefühl, auf der Kommandobrücke eines Containerschiffes zu stehen, das sich mit einer Fracht neuer Ideen den Weg durch die endlosen Weiten des Pazifiks bahnte.
Anstatt den Elektroroller nach Taravao zu steuern, bog er auf halber Strecke rechts ab. Die Straße führte zur Nordküste Itis, nach Afaahiti, auch dort gab es eine Reva-Tae-Station. Somit sparte er sich fünf Kilometer Weg. Zu seiner Überraschung herrschte in dem Dorf ein erstaunlich reges Treiben. Als er sich der Station näherte, entdeckte er den Grund dafür: es war die Stunde, da der Reva-Tae-Supermarkt hier Halt machte. Cording hatte das zwanzig Meter lange Gefährt, welches die Insel zwei Mal wöchentlich umrundete, schon des Öfteren an anderen Orten gesehen. Und jedes Mal herrschte Volksfeststimmung unter den Anwohnern, die sich bei dieser Gelegenheit mit allem eindeckten, was im Haushalt gerade benötigt wurde.
Was für ein Einfall, den Supermarkt zu den Menschen kommen zu lassen und nicht umgekehrt! Auf diese Weise wurden nicht nur die Verkehrswege extrem entlastet, sondern auch der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaften gefördert. Der Reva-Tae-Supermarkt war kein einseitiges Geschäft. Die Bauern und Fischer am Rande der Strecke belieferten ihn mit ernte-und fangfrischer Ware. Auf Iti waren es vor allem Kinder, die Brotfrüchte, Süßkartoffeln, Yamswurzeln, Bergbananen, Edelkastanien, Kokosnüsse, Zitronen, Ananas, Passionsfrüchte, Papayas, Orangen, Sternfrüchte, Mangos, Wassermelonen, Pampelmusen, Vanille und die gewonnenen Monoi- und Tamanu-Öle herbei schleppten und dafür einen kleinen persönlichen Obolus empfingen.
Cording beobachtete die lautstarke, fröhliche Transaktion von einer Roulotte aus, die unweit der Station hielt. Erst als sich der Supermarkt aus dem Staub gemacht hatte und die Leute wieder in ihre Häuser zurückgekehrt waren, erhob auch er sich. Bevor er ins Hotel aufbrach, ging er ans Ufer und blickte hinaus aufs Meer, aus dem fahle Leuchtwolken stiegen und unter der Oberfläche pulsierend kreisten wie riesige Quallen. „Millionen Schatten und Phantome, versunkene Wünsche, nachtwandlerisch abenteuerliche Träume ...“ So hatte Hermann Melville die phosphoreszierenden Planktonwolken beschrieben, die Cordings Sinne verwirrten. Sich vorzustellen, dass diese zauberhaften Küsten ganz allmählich unter dem Dreck ersticken würden, den die Hebetanker vor Makatea aufwirbelten, machte ihn zornig.
„Was zum Teufel wollen die hier?!“, entfuhr es Bill Murray. „Warum greifen die Zerstörer nicht ein?“
„Die haben kein Recht dazu, Sir“, antwortete Agent Sledge, „immerhin befinden wir uns in fremden Hoheitsgewässern.“
Murray warf dem Mann einen abschätzigen Blick zu und starrte auf die zahlreichen Segel- und Motoryachten, die die drei Hebetanker vor der Nordküste Makateas seit gestern wie Schmeißfliegen umkreisten. Das behagte ihm ganz und gar nicht. Ihn quälte der Gedanke, dass ihnen offenbar jeder ungestraft auf den Pelz rücken konnte, obwohl er doch eigens dafür abkommandiert worden war, eben dies zu verhindern. Wer garantierte ihnen, dass sich keine Terroristen an Bord dieser millionenschweren Yachten befanden? Unter diesen Umständen wäre es ein Leichtes für sie, ihnen eine Haftmine an den Rumpf zu backen. Mit was für merkwürdigen Weisungen war die Marine hier erschienen? Das Völkerrecht zu verteidigen? Sie sollten unmissverständlich klar machen, dass diese Region im Umkreis von zwanzig Seemeilen nicht betreten werden durfte! Damit würde man sich eine Menge Ärger vom Hals halten. Sie waren die Vereinigten Staaten von Amerika, mein Gott ... Sie waren doch sonst nicht zimperlich!
„Sieht so aus, als müssten wir den für morgen geplanten Start der Armada auf unbestimmt Zeit verschieben“, eröffnete Omai seinen Besuchern, „es gibt eine ernst zu nehmende Zyklonwarnung.“
Er bat Steve, den Wetterdienst aufzurufen. Das Satellitenbild zeigte nördlich von Hawaii einen mächtigen, sich aufbauenden Wolkenwirbel. „Die Meteorologen behaupten, dass er über Makatea auf die Gesellschaftsinseln zusteuert“, sagte Omai. „Wenn das passiert“, fügte er leise hinzu, „haben wir verloren ...“
Cording war tief betroffen von der resignativen Stimmung, die plötzlich von Omai Besitz ergriffen hatte. Die mörderische Wucht des letzten Zyklons war jedem Tahitianer noch in bester Erinnerung. Vor drei Jahren war es, als so ein Himmelsgebräu an den Gesellschaftsinseln gerüttelt und nahezu 700 Todesopfer gefordert hatte. Seltsamerweise war Tahiti damals weitgehend verschont geblieben, es hatte hier nur zwölf Tote gegeben und es waren vor allem Gebäude eingestürzt, die ohnehin vor dem Abriss standen, wie zum Beispiel die wacklige Aluminiumkonstruktion der Universität auf dem Berg über Faaa. Früher dauerte es bis zu fünfzig Jahre, bevor sich ein solcher Brachialangriff wiederholte, inzwischen klopfte die Katastrophe in der Südsee in weit kürzeren Abständen an.
Wie aussichtslos der Versuch der Menschen war, sich mit der Natur zu versöhnen, dachte Cording. Die Erde tobte vor Schmerzen und sie schüttelte sich unterschiedslos auch jene aus dem Pelz, die ihr respektvoll die Hand reichten.
„Mit den Folgen des Zyklons könnten wir leben“, hörte er Omai sagen, „mit der Müllschwemme , die dieser mit sich bringt, nicht. Der Plastikdreck wird die Korallenriffe verkleben und die Fischgründe ruinieren. Unsere Atolle und Strände werden hinterher eine einzige Müllkippe sein.“
Omais Ängste waren nicht unberechtigt. Seit Jahren musste man befürchten, dass der sechs Millionen Tonnen schwere Plastikteppich von der Fläche Europas, der sich nördlich von Hawaii im Kreis drehte, die Richtung änderte. Bisher war er unter dem Einfluss subtropischer Winde und kontinentaler Randströmungen, die den Pazifik an dieser Stelle in eine spiralähnliche Bewegung zwangen, im energiearmen Zentrum des Giga-Wirbels gebunden. Zyklon „Martha“, wie ihn die Meteorologen nannten, begann nun, die gespenstische Halde durcheinander zu wirbeln.
Tausende Tonnen von Strandsandalen, Giftmüllbehältern, Kathodenstrahlröhren, Kleiderbügeln, Feuerzeugen, Volleybällen, Badeenten, Kunststofftauen, Zahnbürsten und Styroporplatten schossen in die Atmosphäre, regneten herab, wurden erneut hoch geschleudert, als wollte der Zyklon sie in seinem unendlichen Zorn zum Mond schießen. Aber selbst wenn ihm das gelänge, blieben immer noch siebzig Prozent der plastilinen Abfälle als Altlast auf dem Meeresgrund zurück, die sich dort zersetzen und das feinnervige Ökosystem des Pazifiks unter einem chemischen Schwamm ersticken würden.
Was waren dagegen die Schäden, die drei Hebetanker vor Makatea anrichten konnten, dachte Cording. Der politische Kampf war aus der Proportion geraten. Während die Menschen für Unabhängigkeit, Medikamente, Selbstbestimmung, Trinkwasser, Frauenrechte und neue Fahrradwege stritten, hatte die Waschmaschine der Evolution längst den Schleudergang eingelegt. Er sah Omai an. Gemeinsam holten sie tief Luft.
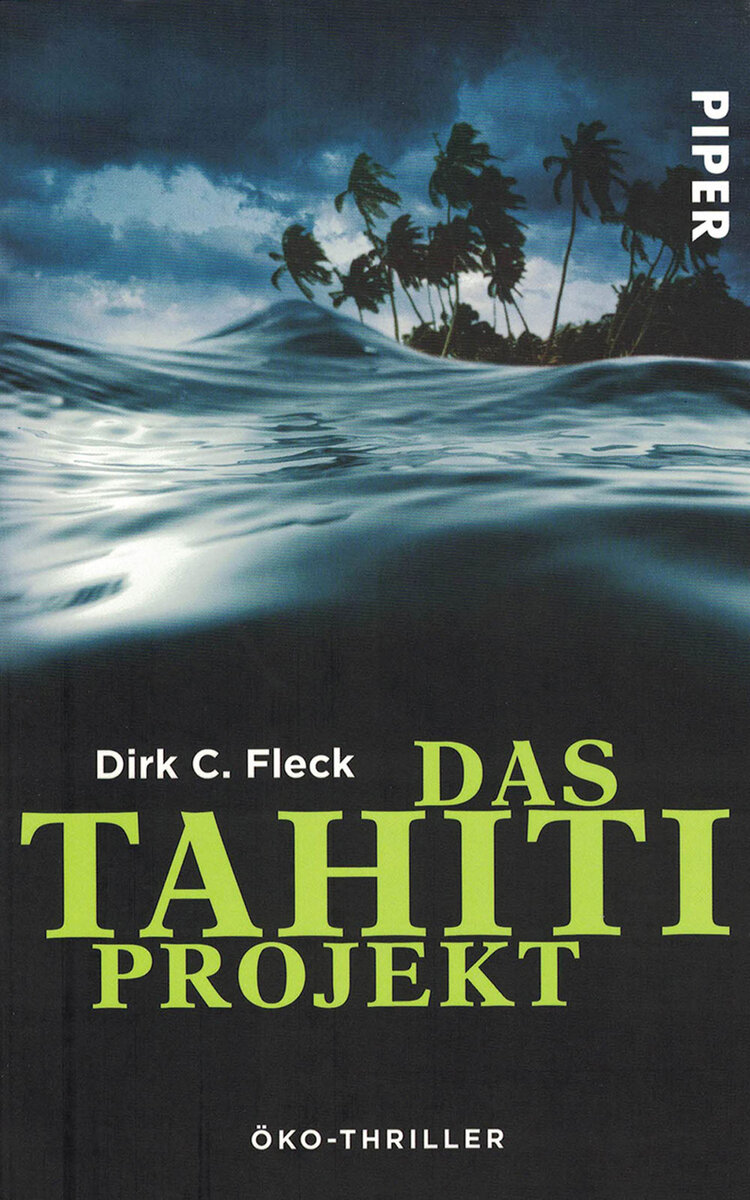
Hier können Sie das Buch bestellen: equilibrismus.org

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
*Die Erklärungen der im Roman verwendeten Fachbegriffe sowie Hinweise für interessierte Leser auf weiterführende Literatur oder Webseiten befinden sich im Buch. Obwohl das „Tahiti-Projekt“ ein Zukunftsroman ist, sind die in ihm dargestellten technischen Lösungen und sozioökologischen Modelle keine Fiktion: sie existieren bereits heute! Das einzig Fiktive ist die Annahme, dass irgendwo auf diesem Planeten tatsächlich mit konkreten Veränderungen in Richtung auf eine zukunftsfähige Lebensweise begonnen wurde.