Unis stramm auf Linie
Spätestens seit Corona plagt viele Menschen ein mulmiges Bauchgefühl. Irgendetwas stimmt nicht. Pseudowissenschaftlich anmutende Zahlenkolonnen, als Berichterstattung getarnte Stimmungsmache und immer gleiche Experten mit Einheitsmeinung bestimmen zunehmend die Inhalte der Zeitungen und Rundfunkanstalten.
Medienrealität und Wirklichkeit driften immer weiter auseinander. Eine unsichtbare Moralkeule schwingt über jedem Aufstiegswilligen. Der Debattenraum scheint im Eiltempo zu schrumpfen: nur kein falsches Wort in der Öffentlichkeit sagen, bloß nicht in der Nähe unliebsamer Leute gesehen werden, auf gar keinen Fall den offiziellen Erzählungen zu Themen wie Corona, Energiekrise, Klima und Ukrainekrieg widersprechen.
Viele wundern sich: Warum bleibt der Aufschrei aus den akademischen Institutionen aus? Mehr noch: Warum sind gerade diese besonders stramm auf politischer Linie? Diesen Fragen geht der in der DDR geborene Journalist und Professor Michael Meyen in seinem neuen, Ende August erscheinenden Buch nach.
Akademische Zeitreise
In „Wie ich meine Uni verlor“ nimmt Meyen den Leser mit auf eine Zeitreise durch seine akademische Biografie. In der DDR begann der 1967 auf der Insel Rügen Geborene sein Journalistik-Studium, erlebte als Student die wirre Wendezeit in Leipzig, später Zuckerbrot und Peitsche der westlichen Marktwirtschaft.
Als die Bologna-Reform bereits im Anmarsch war, landete Meyen an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München. Die will ihn heute mit einem Disziplinarverfahren loswerden; er gilt als Abweichler, als undankbarer Ostdeutscher, als Nestbeschmutzer — etwas, das Meyen eigentlich nie werden wollte. Akribisch reflektiert er, wie es dazu kommen konnte, und deutlich wird, die Saat spross bereits viel früher als gedacht.
Unis formen Eliten
„In den Universitäten wird das Personal geformt, das später unser Leben bestimmt.“ Sie seien, konstatiert Meyen, „das Nadelöhr, das jeder passieren muss, der irgendwann irgendwo etwas zu sagen haben will: Lehrer und Schuldirektoren, Staatsanwälte und Richter, Pfarrer, CEOs und Chefredakteure, Landräte, Theaterintendanten und Ärzte, Minister und Behördenleiter — sie alle haben studiert“. Wer die Universitäten beherrscht, dominiere die gesellschaftliche und politische Entwicklung, so Meyens Erkenntnis heute.
Wie das deutsche Führungspersonal heute geformt wird, beschreibt der Autor mit harten Worten: Wissenschaft sei zur „Religion der Gegenwart“ geworden, Professoren zu Priestern, die sagen, wo es langgeht.
Die Neugier, die Forscher antreiben sollte, wurde, so Meyen, „korrumpiert von einem System, das mit Geld und Ruhm lockt“. Dem akademischen Nachwuchs werde „von klein auf eingetrichtert, dass sich Anpassung und nachbeten besser bezahlt machen, als jeder Trip ins Ungewisse“.
Dem Professor ist klar, dass er spätestens mit diesem Buch seine akademische Reputation im „demokratischen Westen“ an den Nagel gehängt hat. Er wird den Vorgaben, die durch die Bologna-Reform etabliert wurden, nicht mehr genügen. Er beißt in die Hand seines Brotgebers, von dem er eigentlich profitiert habe. „Ich dürfte dieses Buch nicht schreiben“, betont er gleich zu Beginn.
Jene Pflichtpunkte, die Meyen wie jeder andere Professor für seine Uni im „Shanghai-Ranking“, in „Exzellenzinitiativen“ und für den „H-Index“ sammeln müsste, mit erwünschten Studien, möglichst oft zitiert, sind wohl im Cancel-Culture-Regime untergegangen, das es nicht mehr schaffen konnte, ihn selbst nach Wunsch zu formen. Sein Buch ist kein Bekenntnis zur bürgerlichen Moral, die vor allem auf Scheinheiligkeit beruht.
Der ostdeutsche „Makel“
Das war nicht immer so. Meyen hatte es zu einem angesehenen Forscher in seinem Gebiet gebracht. 2002 berief ihn die Münchner Uni auf einen Lehrstuhl. Er fuhr von Tagung zu Tagung, bekam Auszeichnungen. Als Ostdeutscher sei das nicht selbstverständlich gewesen: „Ich habe damals gedacht, diese BRD ist doch nicht so verkehrt.“ Immerhin habe sie ihn als „Ossi“ integriert.
Natürlich mit Vorbehalten: Die Diktatur-Erzählung schwang immer im Raum, so Meyen. Ostdeutsche mussten besser sein als andere, sich stets gegen ihre Vergangenheit bekennen. Westdeutsche legten fest, wie die DDR zu sein gehabt habe; dort geboren zu sein, galt als Makel. „Auch ich wollte beweisen, dass die Uni-Berufung kein Fehler war“, schreibt Meyen. Er wollte dankbar sein für die Gnade seiner Assimilation.
Fetische der Ökonomisierung
Heute sieht er das anders. Derzeit erlebe er das vierte universitäre System: zuerst die DDR, die — wenngleich mit autoritären Vorgaben — auch Arbeiterkindern ein langes Studium ermöglichte, dann die kurze Wendeepoche, die Meyen als „Zeit weitgehender Anarchie“ beschreibt, schließlich die Methoden vor und dann nach Bologna.
Politische Einflussnahme auf die Unis habe es immer gegeben, schränkt er ein. Aber vor der tiefgreifenden Bologna-Reform hätten die jungen Studenten Zeit für Forschung und Selbstfindung gehabt. „Sie konnten sich ausprobieren“, resümiert er, doch dies sei heute „den Fetischen der Ökonomisierung zum Opfer gefallen: Effizienz, Leistung, Rentabilität“.
Seit Bologna gehe es nur noch um Leistungspunkte, darum, möglichst viel zu publizieren und zitiert zu werden, gerne gegenseitig im eigenen akademischen Klub. Jeder kleine Aufsatz werde bewertet und archiviert. Ein Patzer, ein unpopuläres Thema oder „falsche“ Ergebnisse könnten, so Meyen, schnell das Ende der Karriere einläuten, bevor sie überhaupt begonnen hat. Mit Bologna hätten die Herrschenden den Studenten die Zeit zum Ausprobieren geraubt.
Werbeträger für das System
Meyen springt in seinem Buch zwischen den Zeiten hin und her. Er zitiert Professoren, die von den 1960er- und 1970er-Jahren berichten. Ihre Geschichten über Partys und experimentelle Forschung, gemeinsames politisches Nachdenken und Handeln sind zu historischen Anekdoten geworden. Meyen blickt zurück auf den Beginn seiner eigenen Karriere, wo er mit Studenten noch abends beim Bier saß und endlos diskutierte; von dort schwenkt er immer wieder in die Gegenwart: Nichts von dem sei übrig geblieben.
Heute jagten die Studenten Punkten und Reputationen hinterher, hätten verinnerlicht, dass Zeit Geld sei, wüssten, wie man sich anpasst, um auf der Karriereleiter voranzukommen. Es werde nicht mehr diskutiert, nur noch gepaukt. Persönlichkeitsentwicklung und selbstständiges Denken behinderten den Aufstieg.
Heute bestimmt der Markt, was möglichst effizient gelehrt wird. Fast die Hälfte aller Forschungsgelder werben Hochschulen als Drittmittel aus der Wirtschaft ein. „Wer das Geld gibt, bestimmt, was und wie geforscht wird“, weiß Meyen.
Gezielte Mittelvergabe nennt sich das, zunehmend auch aus den Ministerien. So habe sich die Politik „einen Weg in die Unis geplant, der viel eleganter ist als einst der Radikalenerlass“.
Mit dem Radikalenerlass katapultierte die Politik ab 1972 vermeintliche Extremisten aus den akademischen und institutionellen Betrieben, vor allem Kommunisten und Linke aller Couleur. „Heute säubert man nicht mehr, man infiltriert“, schreibt Meyen. Soll heißen: Man assimiliert künftige Professoren schon präventiv unter dem Druck der Moralkeule, besetzt die Lehrstühle der Bildungseinrichtungen nach politischem Wohlwollen. Die Besten-Auslese von Staat und Kapital bringe „Werbeträger für das System“ hervor.
„Hinter jeder Zahl steht ein Interesse“
Die Reputation dieser Werbeträger wird laut Meyen inzwischen von Zahlen bestimmt. Diese beziffern erwünschte Forschungsergebnisse, Social-Media-Klickzahlen, Professoren-Zitate in Medien. „Doch hinter jeder Zahl steht ein Interesse“, betont Meyen. „Zahlen sind nicht die Wirklichkeit“ — und leicht manipulierbar.
Wer sich in den letzten drei Jahren mit den Corona-Dashboards befasst hat, ahnt vermutlich, wovon Meyen schreibt. Diese Zeit, in der der Spiegel ihn zum „Prof. Dr. Kokolores“ stempelte, weil er skeptisch gegenüber politischen Maßnahmen war, mit den „falschen Leuten“ sprach, in unerwünschten Blättern publizierte, der neuen Kriegsrhetorik eine Absage erteilte, bezeugt eine Ära, in der Politik keinen Widerspruch mehr duldet.
Die Unterwerfung der Unis
Der Weg in diese Ära verlief schleichend und — schrittweise befördert durch die Digitalisierung — für viele lange Zeit unbemerkt, auch für Meyen. Er glaubt an ein gezieltes Projekt, das Schritt für Schritt, über Generationen hinweg, umgesetzt wurde.
„Die Unterwerfung der Universitäten war ein Generationenprojekt, gestartet in den 1990ern und ausgestattet mit einer enormen Gestaltungsmacht, zu der nicht nur Geld und Gesetze gehören, sondern auch intellektuelle Ressourcen und die Hoheit über die Kommunikationskanäle, die den Siegeszug der Identitätspolitik genauso auf dem Kerbholz haben wie den Aufstieg von Expertendarstellern, den Abschied der Linken von ihren Kernthemen und ihrer Klientel sowie das, was Paul Schreyer ‚entkoppelte Regierung‘ genannt hat oder das ‚Verschwinden von Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht‘ auf allerhöchster Ebene.“
Meyen spricht von einer verfahrenen Situation. Eine schnelle Umkehr, so sie jemals gewünscht würde, sei unmöglich. Dies würde mindestens so lange dauern, wie es bis dorthin gebraucht hatte. Denn das System Universität nähre sich längst nicht mehr nur aus der Macht der Geldgeber, sondern reproduziere seinen eigenen Geist. Ob die wenigen verbliebenen kritischen Querdenker eines Tages fähig sein werden, es zu überwinden? Diese Frage kann Michael Meyen natürlich nicht beantworten.
Der Westen und sein „Ossi“
Schließlich führt Meyens Geschichte — man hätte es fast ahnen können — immer wieder zurück zu seiner ostdeutschen Identität. Ein Kollege habe ihn kürzlich gefragt, ob er „noch im Widerstand der DDR“ verharre oder „schon in der modernen PR“ angekommen sei. Es ging um seine unliebsamen Arbeiten für eine unliebsame Zeitung, die sich in der Coronazeit gegründet hatte — unliebsam wie Meyens Geburtsland DDR.
„Der Klassenfeind, ich hör ihn trapsen“, kommentiert dies Meyen. Aus anderer Perspektive könnte man meinen:
Der „Ossi“, vom westlichen Hegemon allerlei widerborstiger und unschöner Eigenschaften bezichtigt, scheint auch weiterhin in westdeutschen Stein gemeißelt zu sein.
Dieser Ossi soll permanent Pluspunkte sammeln, durch Bekenntnisse, Stillhalten, Mitlaufen und besonders vorauseilenden Gehorsam. Er soll beweisen, dass er „Demokratie kann“. Ist er zu widerborstig, drückt ihm die Presse im Handumdrehen den Stempel „Nazi“ auf — selbst dann, wenn man sich, wie Meyen, stets zu linken Zielen wie sozialen Verbesserungen, Arbeiterrechten und Gleichwertigkeit aller Menschen bekannt hat.
Dass dies oft zum Gegenteil des Gewünschten führt, beweist der Osten Deutschlands seit 30 Jahren. Je mehr Zeit nach der „deutsch-deutschen Hochzeit“ verstreicht, desto mehr Widerstand scheint sich zwischen Elbe und Oder zu regen. Wie der gerufene Geist aus der Flasche durchkreuzt der kritisch-trotzige Blick der Ostdeutschen auf die Welt die Botschaften westlicher Einheitspropaganda. Aufgedrücktes Stigma ist immer ein bisschen Identität, die auch Meyen immer wieder einzuholen scheint.
Ironisch könnte man sagen: In diesem Punkt war die Identitätspolitik der modernen Moralkeulen-Minister anscheinend doch ein wenig erfolgreich, wenn auch nicht zur Freude der gefühlten Einheitsparteien-Elite im Deutschland des 21. Jahrhunderts — ein Hoffnungsschimmer für Widerstand am fernen Horizont?
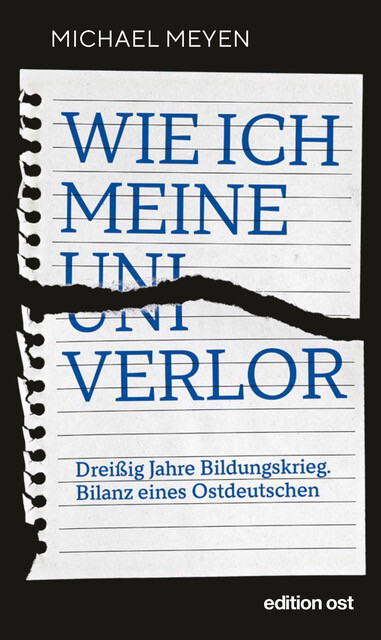
Hier können Sie das Buch bestellen: „ Wie ich meine Uni verlor: Dreißig Jahre Bildungskrieg. Bilanz eines Ostdeutschen“

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .





