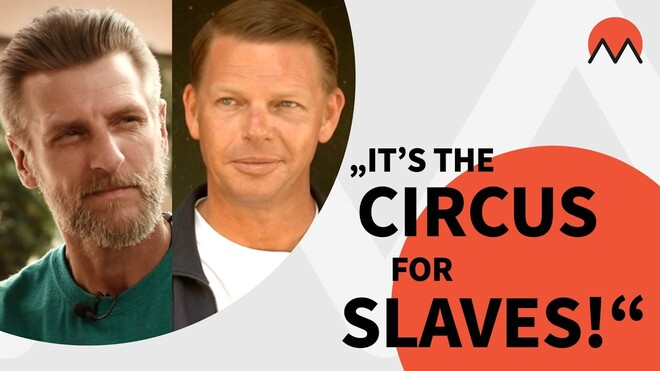Wie sehr sich Menschen an neue Gegebenheiten gewöhnen und gemäß nach diesen handeln, selbst wenn die Notwendigkeit nicht mehr besteht, lehrte mich eine Beobachtung in der Zeit, als ich mich während meiner kaufmännischen Ausbildung in einem mittelständischen Betrieb befand. Da gab es diese eine, kurz vor ihrem Renteneintritt befindliche Kollegin, die einem Kafka-Roman hätte entsprungen sein können. Frau Besch — Name geändert — hatte so ziemlich den langweiligsten und an Monotonie kaum zu überbietenden Job, den man sich vorstellen konnte. Jahr um Jahr, ganze Jahrzehnte fristete sie ihr Dasein in einem kleinen Büro im hintersten Winkel des kleinen Firmengebäudes und verrichtete banalen Papierkram, der eine Beleidigung für jedes menschliche Potenzial darstellt.
Monotonie war das, was den Wesenszug von Frau Besch charakterisierte. So wie die Arbeit, die sie erledigte, so war sie selbst: Ein Rädchen im System, das Dienst nach Vorschrift verrichtete, nichts hinterfragte und tat wie ihr geheißen.
In aller Regel kam sie zwei Minuten vor mir an der fußläufig vom Firmensitz wenige Minuten entfernten Haltestelle an. So konnte ich sie immer aus etwa hundert Meter Entfernung beobachten, wie sie tagtäglich den gleichen Weg wie ich in Richtung Arbeit nahm. Beide Hände an den Riemen ihres Rucksackes und mit zum Boden gesenktem Blick trottete sie Richtung Büro, so wie ein Sims, dem man per Mausklick einen Befehl gibt, an eine bestimmte Stelle zu gehen.
Das Firmengebäude war über zwei Wege erreichbar: ein kurzer Weg, der durch eine kleine Parkanlage führt, und ein etwas längerer Weg, der einmal um den Block führte und etwa zwei Minuten mehr an Zeit beanspruchte. Um pünktlich auf der Matte zu stehen, nahm jeder der mit den Öffentlichen fahrenden Mitarbeiter selbsterklärend die kürzere Wegstrecke. Doch so kam es eines Tages, dass der kürzere Weg durch die Parkanlage aufgrund einer Baustelle blockiert wurde und man den etwas längeren Weg um den Block auf sich nehmen musste. Eine neue Normalität des Arbeitsweges.
So trottete Frau Besch — so wie ich und all die anderen — den alternativen Weg zur Arbeit. So weit so gut. Doch eines weiteren Tages kam es, dass die Baustelle wieder verschwand. Wenn es sich nicht gerade um den Berliner Flughafen handelt, haben das Baustellen so an sich, dass sie auch wieder verschwinden. Was nicht verschwand — die Gewohnheit der Frau Besch, die zweite und damit längere Strecke auch weiterhin zu nehmen. Obwohl die kürzere Strecke zum Firmensitz wieder passierbar war, nahm Frau Besch davon keine Notiz und ging ihrer neuen Routine unhinterfragt nach. Dabei war vielleicht nicht auf dem Hinweg, sehr wohl aber beim Verlassen des Firmengebäudes ersichtlich, dass die Parkanlage wieder passierbar war. Aber Frau Besch nahm es nicht wahr, sie trottete unbeirrt weiterhin die längere Strecke. Ich machte auch keine Anstalten, sie darauf hinzuweisen, da ich einfach testen wollte, wann sie dies von alleine bemerken würde.
Frau Besch ging erst nach meinem Ausscheiden aus der Firma in Rente. Ob sie die Erkenntnis vor ihrer Pension ereilte, kann ich nur vermuten. Ich tippe eher auf Nein.
Dressur
Was können wir von dieser Beobachtung auf unsere jetzige Zeit ableiten? Das was ich bei Frau Besch beobachtete, ist aktuell ein kollektives Phänomen. Die Umgewöhnung auf eine mit Nachteilen behaftete Alternative, deren Handhabung so repetitiv durchgeführt wird, dass der oder die Betroffene irgendwann gar nicht mehr wahrnimmt, dass diese Norm vormals abnorm war. So war der Umweg zum Firmensitz eine Alternative, da der gewöhnliche Weg blockiert war, dessen Begehung aufgrund seiner kürzeren Distanz zum Ziel aus rationalen Gründen immer gewählt wurde.
Es vermag erschrecken, wie schnell wir Menschen uns an Dinge gewöhnen. Ich merke das selber, wenn ich maskiert aus einem Laden trete und manchmal erst nach einer halben Minute realisiere, dass ich immer noch diese Bazillenschleuder im Gesicht habe.
Bei anderen Mitmenschen, die sich über Corona lediglich aus den Angst-Medien berieseln lassen, muss dieser Effekt noch wesentlich intensiver sein. Man trägt weiterhin unbeirrt diese Masken. Aber kennt irgendjemand irgendjemanden, der wirklich mit Corona infiziert ist, oder sogar an (!) Corona gestorben ist? Beim Blick auf die Zahlen des des Robert Koch-Institutes sieht man, dass von den rund 196.000 positiv Getesteten — was nicht bedeuten muss, dass diese auch wirklich Corona haben — mittlerweile 181.000 wieder genesen und etwa 9.000 Tote in einen Zusammenhang mit Corona gebracht werden. Ohne Obduktion kann jedoch nichts mit absoluter Sicherheit gesagt werden.
Wir maskieren uns also allesamt, geben uns nicht zur Begrüßung die Hand oder umarmen uns, weil in Deutschland aktuell 6.000 Menschen mit einem zweifelhaften, überaus fehleranfälligen PCR-Test positiv auf ein Virus getestet wurden, das bei rund 90 Prozent der Infizierten asymptomatisch verläuft und bei 0,02 bis 0,4 Prozent der Betroffenen — bei denen zumeist ein hohes Alter und eine mehrfache Schwersterkrankung vorlag — zum Tod führen kann.
Der Serien-Plot von „Alarm für Corona-11“ scheint schon so ausgelutscht, dass Medien und Politik nun verzweifelt versuchen, neue Hot-Spots in Fleischereien herbeizuschreiben. Wirkliches Aufklärungsinteresse scheint nicht zu bestehen. Das Angebot des Vereins „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“, die betroffenen Mitarbeiter einem zweiten Test zu unterziehen, um Kreuzreaktionen auszuschließen, wurde bislang nicht angenommen. Es drängt sich der Verdacht auf, dass man vermeintlich Neu-Infizierte will. Und zugleich geht in der ganzen Diskussion um vermeintliche Hot-Spots in Fleischereien der Wald in den Bäumen unter.
Der zur Normalität gehörende Fleischverzehr wird überhaupt nicht zur Debatte gestellt. Dabei ist Fleisch aus diesen Schlachthöllen der eigentliche Hot-Spot für multiresistente Killerviren mitten auf unseren Tellern. Hier wird nie über eine Maskenpflicht gesprochen. Wir tragen Masken vor unserem Mund, um uns vor Coronaviren zu schützen, die — so glauben wohl viele — von den Blättern der Bäume zu uns herabsegeln könnten oder durch unsere Mitmenschen beim Reden auf uns übertragen werden könnten, aber lassen durch denselben Mund das billigste und mit zahlreichen Antibiotika vollgepumpte Fleisch an unseren Gaumen.
Damit nicht genug. Um den Vogel noch vollends abzuschießen, fabuliert man nun sogar eine „zweite“ Schweinegrippe-Pandemie herbei. Wobei dem Worte „zweite“ dieselbe Paradoxie inneliegt wie im Zusammenhang mit der Welle, also der „zweiten Welle“. Für etwas Zweites bräuchte man zunächst das Erste: ohne erste Welle keine zweite und ohne erste Schweinegrippe-Pandemie keine zweite.
Doch bei all den Bemühungen, den Anschein einer Gefahr noch irgendwie aufrechtzuerhalten, sind die belastenden Zahlen und Fakten mehr als eindeutig: Die Corona-Pandemie ist — schon lange — vorbei! Und dennoch handeln wir, als bestehe eine wirkliche Gefahr, die sämtliche anderen Gefahren in den Schatten stellt.
Was muss passieren, wie offensichtlich muss die Lage noch werden, dass irgendwann der Tag X kommt? Der Tag, ab dem alle, ja wirklich alle, die Masken wieder abnehmen? Der Tag, ab dem wir uns wieder wie völlig normal zur Begrüßung die Hand geben, uns umarmen und nicht einmal einen Gedanken daran verschwenden, ob dies nun angebracht sei oder nicht?
Um auf Erzählung zu Beginn dieses Artikels zurückzukommen: Wann verstehen wir, dass auf dem kürzeren Weg die Baustelle nicht mehr da ist, ja gar nie existierte? Wollen wir auf ewig so weitermachen? Unsere entfremdete und unterkühlte Ellenbogengesellschaft symbolisch manifestieren, indem wir uns mit selbigen begrüßen? Wie oft werden mir noch die verstörenden Bilder unterkommen, etwa das Bild einer sommerlich gekleideten Frau auf einem Fahrrad, die mit wehendem Kleid und einer Mundschutzmaske durch einen herrlich duftenden Park fährt?
Bekanntlich ist es der Glaube, der Berge versetzt. Aber ist es wirklich der Glaube, der Glaube an ein teuflisches Virus, der uns dazu veranlasst, wider jede Vernunft zu handeln? Oder ist es nicht mehr die Macht der Gewohnheit, Dinge so hinzunehmen, ohne diese zu hinterfragen? Wie viele Menschen strömen an christlichen Feiertagen in die Kirchen — zumindest vor 2020 — obwohl sie gar nicht wirklich an Gott oder an die Botschaften des Christentums glauben? Man macht es halt einfach, einfach weil es dazu gehört.
Vermutlich ist es am Ende mehr die Gewohnheit. Die im wahrsten Sinne des Wortes Drecksmasken hängen mittlerweile an den Rückspiegeln in Autos und an Handgelenken der Passanten. Sie wurde für das Betreten des öffentlichen Raums das „Mask have“. Jedwede Debatte über die Aufhebung wird — beispielsweise von Markus Söder — mit dem Argument abgeschmettert, dadurch könne der „falsche Eindruck entstehen“. Aber genau dieser falsche Eindruck ist in Wahrheit der richtige — nämlich der, dass die Pandemie schon lange vorbei ist. Trügen wir die Masken nicht mehr, hörten und läsen wir nicht mehr die Hiobsbotschaften auf den Public Screens, in Radio und TV, so würde von Corona niemand mehr Notiz nehmen.
Die Maske ist die Erinnerung an das, was schon lange nicht mehr ist. Sie wurde zum Symbol einer kollektiven Unterdrückung, eines Gehorsamdrills, eines gesellschaftlichen Experiments und einer Dynamik, die jeden Ausreißer durch sozialen Druck in die Mangel nimmt. Besonders absurd, wenn man dies mit dem skurrilen Fall aus Österreich vor wenigen Jahren ins Verhältnis setzt, als eine junge Frau eine Geldstrafe erhielt, weil sie durch das zu tiefe Versinken ihres Gesichtes in ihrem Schal gegen das Vermummungsverbot verstieß. Heute wäre sie eine vorbildliche Bürgerin.
Aber selbst wenn die Maskenpflicht bereits im Herbst aufgehoben werden würde, so würde ihr Schatten noch lange nachwirken. Nicht nur, weil das Maskentragen bei grellen Sonnenschein einen neuen „Bikinistreifen“ im Gesicht generieren wird, sondern weil dieses Bild der maskierten Menschen allerorts sich in das kollektive Gedächtnis einprägt hat und uns noch lange verfolgen wird.
Daher wird es Zeit, dass wir die Pandemie so schnell wie nur irgendwie möglich offiziell für beendet erklären. Das Maske-Abnehmen, das am Boden liegen von Masken, das Lächeln unseres Gesichtes muss wieder kultiviert werden. Am ersten August treffen sich auf der Straße des 17. Juni in Berlin mehr als eine halbe Million Menschen aus der gesamten Republik und werden mit der Stimme der Bevölkerung die Pandemie offiziell für beendet erklären.
Gemessen am R-Wert ist die Pandemie schon seit vier Monaten vorbei, an Fasching seit fünf Monaten: Es ist an der Zeit, die Masken abzulegen!

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .