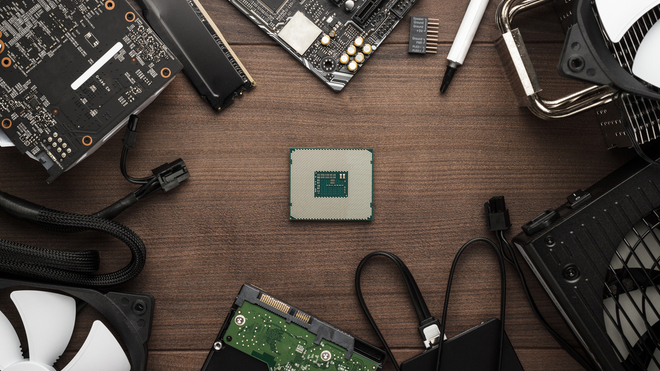Im Kern beschreibt Demut eine realistische Selbsteinschätzung. Der demütige Mensch erkennt seine Fähigkeiten ebenso wie seine Grenzen an, ohne sich über andere zu erheben oder sich selbst geringzuschätzen. Sie ist damit das Gegenstück zum Hochmut, der in vielen Traditionen als Quelle von Verblendung, Konflikten und Leid gilt. Demut bedeutet, das eigene Ego nicht zum Mittelpunkt der Welt zu machen, sondern sich als Teil eines größeren Zusammenhangs zu begreifen — sei es göttlich, kosmisch, sozial oder existenziell.
Im Christentum gehört Demut zu den grundlegenden Tugenden. Jesus von Nazareth wird als Vorbild einer Haltung beschrieben, die Macht nicht zur Selbstverherrlichung nutzt, sondern zum Dienen. Seine Botschaft stellt gängige Vorstellungen von Größe und Erfolg auf den Kopf: Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht.
Demut bedeutet hier nicht Passivität, sondern eine bewusste Entscheidung gegen Überheblichkeit und für Liebe, Mitgefühl und Verantwortung. Sie ist eng verbunden mit der Einsicht, dass der Mensch nicht alles aus eigener Kraft vermag.
Auch im Judentum wird Demut als Stärke verstanden. Besonders eindrücklich ist die Figur des Mose, der trotz seiner Führungsrolle als der demütigste Mensch gilt. Demut zeigt sich hier in der Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, ohne sich selbst zu verherrlichen. Sie schafft Raum für Weisheit; denn nur wer nicht von sich selbst eingenommen ist, kann wirklich zuhören, lernen und gerecht handeln.
Im Islam nimmt Demut — Tawāḍuʿ — eine ebenso zentrale Stellung ein. Sie richtet sich vor allem auf das Verhältnis des Menschen zu Gott. Alles, was der Mensch besitzt oder erreicht, wird letztlich als Gabe verstanden. Diese Sichtweise fördert Dankbarkeit und Bescheidenheit und schützt vor Hochmut, der im Koran ausdrücklich kritisiert wird. Die körperlichen Gesten des Gebets — Verbeugung und Niederwerfung — bringen diese innere Haltung symbolisch zum Ausdruck: Der Mensch erkennt seine Begrenztheit an und findet gerade darin Würde und Frieden.
In den östlichen Weisheitstraditionen verschiebt sich der Akzent von der moralischen Forderung hin zur erkenntnisbezogenen Einsicht. Der Buddhismus etwa kennt Demut nicht primär als Tugend, sondern als natürliche Folge von Einsicht in die Wirklichkeit.
Da das Ich als vergänglich erkannt wird, verlieren Stolz, Selbstüberhöhung und Kränkung ihre Grundlage. Demut entsteht hier nicht durch Anstrengung, sondern durch das Durchschauen von Illusionen.
Auch im Hinduismus wird das Ego als Schleier verstanden, der die wahre Natur des Selbst verdeckt. Wahre Demut ist die Frucht spiritueller Erkenntnis: Wer sich als Teil des einen Ganzen erkennt, kann sich nicht mehr absolut setzen. In der bhakti-orientierten Frömmigkeit zeigt sich Demut zudem als liebende Hingabe — nicht aus Angst, sondern aus Vertrauen und Verbundenheit.
Der Taoismus beschreibt Demut als natürliche Haltung im Einklang mit dem Dao, dem ursprünglichen Weg des Lebens. Das Weiche, Stille und Zurückhaltende erweist sich als wirksamer als das Harte und Dominante. Wasser, das stets den tiefsten Punkt sucht, wird zum Sinnbild einer demütigen Kraft. Der Weise stellt sich nicht in den Vordergrund, sondern handelt unauffällig und gerade dadurch nachhaltig. Demut ist hier kein moralischer Anspruch, sondern Ausdruck von Natürlichkeit.
Im Konfuzianismus tritt Demut vor allem in ihrer sozialen Dimension hervor. Bescheidenheit, Respekt und Lernbereitschaft gelten als Voraussetzungen für persönliche Reifung und gesellschaftliche Harmonie. Wer sich selbst nicht überschätzt, kann sich kultivieren und zum Wohl der Gemeinschaft beitragen.
Auch die antike europäische Philosophie kennt Formen der Demut, wenn auch unter anderen Begriffen.
Die Stoiker lehrten eine Haltung, die man als kosmische Demut bezeichnen könnte: Der Mensch soll unterscheiden zwischen dem, was in seiner Kontrolle liegt, und dem, was er annehmen muss. Diese Einsicht führt nicht zur Resignation, sondern zu Gelassenheit, innerer Freiheit und Weisheit. Der Mensch erkennt seinen Platz im Ganzen, ohne sich selbst zu verlieren.
In der modernen Psychologie erlebt Demut zunehmend Aufmerksamkeit. Sie wird verstanden als realistische Selbsteinschätzung, Offenheit für Kritik und Bereitschaft zum Lernen. Studien zeigen, dass demütige Menschen oft stabilere Beziehungen führen, weniger anfällig für Narzissmus sind und besser mit Unsicherheit umgehen können. Auch hier zeigt sich: Demut ist keine Schwäche, sondern eine Ressource.
Über alle religiösen, philosophischen und kulturellen Grenzen hinweg lässt sich ein gemeinsamer Kern erkennen: Demut bedeutet, sich selbst nicht zum Maß aller Dinge zu machen, ohne den eigenen Wert zu verleugnen. Sie verbindet Klarheit mit Mitgefühl, Wahrheit mit Offenheit und Selbstbewusstsein mit Begrenztheit. In einer Zeit, die stark von Selbstinszenierung, Konkurrenz und permanenter Bewertung geprägt ist, gewinnt Demut eine neue Aktualität. Sie lädt dazu ein, das eigene Leben nicht aus der Logik des Vergleichs, sondern aus der Tiefe von Verbundenheit, Verantwortung und Wahrhaftigkeit zu gestalten.
Politische Sprache im Licht philosophischer Demut
Demut gehört zu jenen Tugenden, die politisch selten eingefordert werden, philosophisch jedoch als Voraussetzung verantwortlichen Handelns gelten. Sie ist keine Geste der Schwäche, sondern Ausdruck realistischer Selbsterkenntnis. Aristoteles beschrieb Tugend als die Fähigkeit, Maß zu halten — als Mitte zwischen Mangel und Übermaß. Hochmut (Hybris) war für ihn kein Zeichen von Größe, sondern von Maßlosigkeit: das Überschreiten der eigenen Rolle, das Vergessen der eigenen Begrenztheit. Betrachtet man die politische Sprache der Gegenwart, entsteht der Eindruck, dass genau dieses Maß zunehmend verloren geht.
Selbstgewissheit statt Maß: Emmanuel Macron
Als Emmanuel Macron 2017 erklärte, man müsse „nur über die Straße gehen, um einen Job zu finden“, war die Empörung groß. Philosophisch betrachtet liegt das Problem dieser Aussage weniger in ihrer Provokation als in ihrem impliziten Menschenbild: Der Einzelne erscheint als autonomes, rational steuerbares Subjekt, das lediglich Willen zeigen muss, um erfolgreich zu sein. Slogans wie „Just do it“ des Sportartikelherstellers Nike weisen in die gleiche Richtung. Aristoteles hätte darin eine Verkennung der Umstände gesehen — jener sozialen, ökonomischen und biografischen Bedingungen, ohne deren Berücksichtigung moralische Urteile leer bleiben.
Später, als Macron betonte, Europa dürfe „nicht schwach oder defätistisch“ sein, verschob sich der Ton von sozialer Vereinfachung zu geopolitischer Selbstvergewisserung. Stärke wurde zur moralischen Kategorie erhoben. Doch Stärke ohne Selbstzweifel ist philosophisch prekär. Sie kippt leicht in das, was Augustinus als “Superbia” bezeichnete: jene innere Haltung, in der der Mensch sich selbst zum Maßstab erhebt und vergisst, dass sein Wissen immer fragmentarisch bleibt.
Die radikale Selbstabsolutierung: Donald Trump
Bei Donald Trump tritt diese Superbia offen zutage. „Ich allein kann das Problem lösen“ — dieser Satz markiert einen Bruch mit jeder Tradition politischer Demut. Für Augustinus war Hochmut die Ursünde; nicht weil er laut ist, sondern weil er den Menschen glauben lässt, er sei sich selbst genug. Trumps wiederholte Behauptungen, niemand wisse mehr als er selbst, oder seine Bezeichnung kritischer Medien als „Feinde des Volkes“, lassen keinen Raum für Korrektur, Dialog oder Lernfähigkeit.
Aus kantischer Perspektive ist dies besonders problematisch. Kant verstand politische Vernunft als prinzipiell begrenzt: Kein Mensch dürfe sich anmaßen, den allgemeinen Willen vollständig zu verkörpern. Wer sich selbst zur letzten Instanz erklärt, handelt nicht autonom, sondern despotisch — auch dann, wenn er demokratisch gewählt wurde.
Macht ohne Selbstrelativierung: Ursula von der Leyen
Auch subtilere Formen der Überheblichkeit verdienen philosophische Aufmerksamkeit.
Wenn Ursula von der Leyen sagt: „Wer einen von uns angreift, greift uns alle an“, ist dies zunächst ein Ausdruck kollektiver Solidarität. Doch zugleich verschiebt sich hier die Sprache vom Abwägen zur moralischen Eindeutigkeit. Die eigene Position wird nicht mehr als politisch, sondern als normativ überlegen präsentiert.
Kant hätte hierin eine Gefahr gesehen: Moralische Gewissheit ohne Selbstprüfung. In seiner Schrift „Zum ewigen Frieden” warnt er davor, politische Ziele mit moralischer Unfehlbarkeit zu verwechseln. Demut zeigt sich für Kant gerade darin, politische Entscheidungen als fehlbar zu begreifen — und sie deshalb begründungsfähig zu halten.
Rhetorische Überlegenheit im nationalen Diskurs: Friedrich Merz
Wenn Friedrich Merz über politische Gegner wie zum Beispiel Olaf Scholz sagt, andere Staats- und Regierungschefs hätten „keine Lust mehr“, ihnen zuzuhören, dann ist dies mehr als zugespitzte Kritik. Es ist eine rhetorische Hierarchisierung: Der Sprecher stellt sich über den anderen; nicht argumentativ, sondern symbolisch. Aristoteles hätte hierin ein Zeichen fehlender „Phronesis” gesehen — jener praktischen Klugheit, die nicht nur Recht behalten, sondern das Gemeinwohl im Blick haben will.
Politische Klugheit verlangt, Kritik so zu formulieren, dass sie Verständigung ermöglicht. Wo Sprache hingegen auf Überlegenheit zielt, wird sie selbst zum Machtinstrument — und verliert ihren ethischen Maßstab.
Die stille Arroganz: Olaf Scholz
Bemerkenswert ist, dass Hochmut nicht nur im Lauten, sondern auch im Schweigenden existiert. Olaf Scholz’ oft kritisierter Kommunikationsstil — ausweichend, formelhaft, distanziert — wurde von Kommentatoren als Überheblichkeit interpretiert. Philosophisch lässt sich dies als negative Form der Superbia lesen: nicht als Selbstverherrlichung, sondern als implizite Annahme, keine Rechenschaft schuldig zu sein.
Kant jedoch sah öffentliche Rechtfertigung als Kern republikanischer Moral. Wer Macht ausübt, müsse bereit sein, seine Gründe öffentlich darzulegen. Demut zeigt sich hier nicht im Tonfall, sondern im Willen zur Erklärung.
Fazit zu Demut in der Politik
Demut sollte auch in der Politik zur Tugend erhoben werden.
Was diese Beispiele verbindet, ist kein moralisches Versagen Einzelner, sondern ein struktureller Wandel politischer Selbstdeutung. Führung wird mit Gewissheit verwechselt, Zweifel mit Schwäche. Doch Aristoteles, Augustinus und Kant sind sich in einem Punkt einig: Wer seine Begrenztheit vergisst, verliert seine Orientierung.
Demut ist daher keine sentimentale Tugend, sondern eine politische Notwendigkeit. Sie bedeutet, Macht als vorläufig zu verstehen, Wissen als begrenzt und Entscheidungen als korrigierbar. In einer Zeit globaler Unsicherheit wäre Demut nicht das Ende von Führung — sondern ihr reifster Ausdruck.
„Wer seine Begrenztheit vergisst, verliert seine Orientierung.“
Dieser Satz beschreibt nicht nur eine individuelle Haltung, sondern benennt ein strukturelles Problem gegenwärtiger europäischer Politik. Gerade im Umgang mit dem Krieg in der Ukraine zeigt sich, wie sehr politische Orientierung verloren gehen kann, wenn Macht mit moralischer Gewissheit verwechselt wird.
Die europäische Politik tritt in diesem Konflikt häufig mit dem Anspruch auf, auf der „richtigen Seite der Geschichte“ zu stehen. Dieser Anspruch erzeugt eine Rhetorik der Alternativlosigkeit: Waffenlieferungen gelten als moralische Pflicht, Eskalationsrisiken als notwendiger Preis, diplomatische Initiativen als naiv oder gefährlich. Was dabei zunehmend verschwindet, ist das Bewusstsein eigener Begrenztheit — strategisch, historisch, militärisch und moralisch.
Hier wird Demut zu einer politischen Leerstelle. Nicht im Sinne von Nachgiebigkeit oder Kapitulation, sondern als Anerkennung der Tatsache, dass komplexe geopolitische Konflikte sich nicht aus moralischer Überlegenheit heraus steuern lassen. Wer glaubt, die Dynamik eines Krieges kontrollieren zu können, nur weil die eigenen Motive als gerecht empfunden werden, überschätzt die eigene Wirkmacht und unterschätzt die Unberechenbarkeit von Eskalation.
Die Arroganz zeigt sich dabei weniger in einzelnen Entscheidungen als in der Haltung, mit der sie getroffen werden. Wissen wird als ausreichend betrachtet, Prognosen als verlässlich, Folgen als beherrschbar. Abweichende Stimmen — insbesondere solche, die auf diplomatische Möglichkeiten oder langfristige Risiken hinweisen — werden rasch delegitimiert. Zweifel gilt als Schwäche, Zurückhaltung als mangelnde Solidarität. Doch genau hier bestätigt sich der Satz: Wer seine Begrenztheit vergisst, verliert seine Orientierung.
Demut wäre in diesem Kontext keine sentimentale Tugend, sondern eine politische Notwendigkeit. Sie würde bedeuten, Macht als vorläufig zu verstehen — auch die eigene —, und Wissen als begrenzt — insbesondere über die inneren Dynamiken eines Krieges. Und Entscheidungen als korrigierbar; nicht als moralisch sakrosankt. Eine demütige Politik würde Eskalation nicht ausschließen, aber sie würde sie nicht als Beweis von Entschlossenheit verklären.
Gerade Europa, das sich gern als zivilisatorische Friedensmacht versteht, läuft Gefahr, diesen Anspruch durch moralische Selbstgewissheit zu untergraben. Führung zeigt sich nicht darin, keine Zweifel zuzulassen, sondern darin, Verantwortung auch für unbeabsichtigte Folgen zu übernehmen.
Demut in weiteren Lebensbereichen
Demut gilt oft als ein Begriff der Religion oder als moralische Kategorie politischer Rhetorik. Dabei wird übersehen, dass sie weit über diese Kontexte hinausreicht. Jenseits von Glaubenssystemen und Ideologien lässt sich Demut als eine grundlegende Haltung beschreiben, die den Menschen in ein realistisches Verhältnis zu sich selbst, zu anderen und zur Welt setzt.
In der persönlichen Entwicklung zeigt sich Demut zunächst als die Fähigkeit zur Selbstbegrenzung. Sie bedeutet nicht Selbstabwertung, sondern die Anerkennung eigener Unvollkommenheit.
Wer demütig ist, gesteht sich Irrtümer zu und bleibt lernfähig. In einer Kultur, die Selbstoptimierung und ständige Sichtbarkeit fordert, wirkt diese Haltung beinahe subversiv: Demut erlaubt es, nicht alles kontrollieren zu müssen und dennoch handlungsfähig zu bleiben.
Auch im Bereich von Bildung und Wissenschaft spielt Demut eine zentrale Rolle. Erkenntnis entsteht hier nicht aus Gewissheit, sondern aus Zweifel. Wissenschaftliche Demut bedeutet, Wissen stets als vorläufig zu begreifen und offen zu bleiben für Korrekturen. Lernen wird so zu einem Prozess des fortwährenden Fragens, nicht des endgültigen Besitzes von Wahrheit. Diese Haltung schützt vor Dogmatismus und intellektueller Überheblichkeit.
Gerät diese Haltung unter Druck, verliert Wissenschaft ihre kritische Funktion. Der Vorwurf „bezahlter Wissenschaft“ speist sich weniger aus der Behauptung offener Manipulation als aus der Wahrnehmung struktureller Abhängigkeiten: Forschungsförderung, politische Erwartungshaltungen und mediale Verwertungslogiken können Anreize setzen, bestimmte Narrative zu bestätigen, statt sie zu hinterfragen. Wo Ergebnisse anschlussfähig an Regierungspositionen sein müssen, wird Zweifel schnell als Störung empfunden.
Gerade hier wäre wissenschaftliche Demut unverzichtbar. Sie würde bedeuten, Unsicherheiten transparent zu benennen, Widersprüche auszuhalten und Dissens nicht als Bedrohung, sondern als Qualitätsmerkmal zu begreifen. Eine Wissenschaft, die ihre Vorläufigkeit verschweigt, um politischer Handlungsfähigkeit zu dienen, riskiert ihre Glaubwürdigkeit. Sie tauscht Erkenntnisoffenheit gegen Autorität und füttert damit den Vorwurf der Instrumentalisierung.
Demut schützt Wissenschaft vor der Versuchung, sich als letzte Instanz politischer Wahrheit zu inszenieren. Sie erinnert daran, dass wissenschaftliche Beratung politische Entscheidungen nicht ersetzen kann — und auch nicht legitimieren sollte. Wo Wissenschaft sich dem Anspruch entzieht, endgültige Antworten zu liefern, bleibt sie kritisch, unabhängig und vertrauenswürdig. Wo sie hingegen Gewissheit simuliert, um Narrative zu stabilisieren, verliert sie ihre orientierende Kraft.
In der Arbeitswelt und insbesondere in Führungsrollen gewinnt Demut zunehmend an Bedeutung. Führung, die auf Demut basiert, verzichtet auf Allwissenheitsansprüche und versteht Autorität als Verantwortung. Sie schafft Räume, in denen andere gehört werden, und erkennt an, dass Erfolg selten das Werk Einzelner ist. Demut wirkt hier als soziales Bindemittel, das Zusammenarbeit und Vertrauen ermöglicht.
Zwischenmenschlich zeigt sich Demut in der Bereitschaft, die eigene Perspektive nicht absolut zu setzen. In Beziehungen bedeutet sie, Fehler einzugestehen, zuzuhören und Konflikte nicht als Machtkämpfe zu begreifen. Demut schafft Augenhöhe, weil sie die Verletzlichkeit aller Beteiligten anerkennt. Sie ist damit eine Voraussetzung für Empathie und echte Nähe.
Besonders deutlich wird die Notwendigkeit von Demut im Verhältnis des Menschen zur Natur. Angesichts ökologischer Krisen offenbart sich die Illusion menschlicher Allmacht. Ökologische Demut bedeutet, den Menschen nicht als Herrscher, sondern als Teil komplexer ökologischer Systeme zu begreifen. Sie fordert Zurückhaltung, Verantwortung und ein Bewusstsein für die Grenzen technischer Machbarkeit.
Demut im Rahmen der Digitalisierung
Auch im digitalen Raum sollte in Form von Demut eine korrigierende Kraft entfaltet werden. Sie zeigt sich hier als Bereitschaft, Unsicherheit auszuhalten, Fehler zu korrigieren und andere Perspektiven gelten zu lassen. In einer Zeit beschleunigter Kommunikation wird Demut zur Voraussetzung einer respektvollen Diskurskultur.
Dem Begriff Demut kommt im Zeitalter digitaler Kontrolle besondere Bedeutung zu.
Die digitale Transformation hat neue Formen von Macht hervorgebracht. Digitale Identitäten, algorithmische Entscheidungsstrukturen, Chat-Überwachung und automatisierte Inhaltskontrollen greifen tief in den Alltag ein — oft unsichtbar, oft als alternativlos kommuniziert. Nichts im Leben ist alternativlos, werte Leserinnen und Leser! In diesem Spannungsfeld gewinnt Demut eine neue, politische wie gesellschaftliche Bedeutung, die über klassische Moralvorstellungen hinausgeht.
Demut kann hier als Gegenhaltung zu einem Kontrollanspruch verstanden werden, der sich aus technischer Machbarkeit speist. Wo Daten gesammelt werden können, entsteht schnell die Versuchung, sie auch umfassend zu nutzen; wo Kommunikation analysierbar ist, wächst der Wunsch nach Vorhersagbarkeit und Steuerung.
Digitale Demut bedeutet, anzuerkennen, dass nicht alles, was technisch möglich ist, auch legitim, notwendig oder folgenlos ist. Sie fordert Zurückhaltung gegenüber dem Zugriff auf intime Lebensbereiche.
Im Kontext digitaler Identität zeigt sich Demut als Respekt vor der Vielschichtigkeit des Menschen. Digitale Identitätssysteme tendieren dazu, Individuen auf stabile, überprüfbare und verwertbare Merkmale zu reduzieren. Demut widerspricht dieser Reduktion. Sie erkennt an, dass Identität situativ, wandelbar und nicht vollständig erfassbar ist. Eine demütige digitale Ordnung würde daher Räume für Anonymität, Widerspruch und Unschärfe zulassen, statt lückenlose Eindeutigkeit zu erzwingen. Echte Demokratie ist demütig.
Besonders deutlich wird der Mangel an Demut in Formen der Chat- und Kommunikationskontrolle. Wenn private Kommunikation präventiv überwacht wird, geschieht dies häufig im Namen von Sicherheit oder Ordnung. Demut würde hier bedeuten, die eigene Fehlbarkeit staatlicher und technischer Systeme mitzudenken. Algorithmen irren, Kontexte werden missverstanden, Macht kann missbraucht werden. Eine demütige Haltung erkennt diese Risiken an und setzt auf klare Grenzen, Transparenz und Verhältnismäßigkeit.
Auch Zensur — ob staatlich, privatwirtschaftlich oder algorithmisch vermittelt — offenbart ein Spannungsverhältnis zur Demut. Wer Inhalte kontrolliert, beansprucht Deutungshoheit darüber, was sagbar ist und was nicht. Löschungen von nicht-regierungstreuen, dissentierten Artikeln und Videos im Internet sind nichts anderes als moderne Bücherverbrennung. Demut hingegen akzeptiert Ambiguität, Widerspruch und Unordnung im öffentlichen Diskurs. Sie vertraut darauf, dass gesellschaftliche Auseinandersetzung nicht vollständig steuerbar ist und dass offene Kommunikation ein gewisses Maß an Unsicherheit erfordert.
Im digitalen Raum ist Demut daher eng mit Machtkritik verbunden. Sie richtet sich nicht primär an Nutzerinnen und Nutzer, sondern an Institutionen, Plattformen und Gesetzgeber. Demut bedeutet hier, Kontrolle nicht als Selbstzweck zu verstehen, sondern als Ultima Ratio. Sie verlangt, technologische Systeme so zu gestalten, dass sie dem Menschen dienen — nicht umgekehrt.
Gleichzeitig betrifft digitale Demut auch den individuellen Umgang mit Technik. Sie äußert sich in Skepsis gegenüber totaler Transparenz, in Zurückhaltung beim Teilen persönlicher Daten und im Bewusstsein dafür, dass digitale Spuren dauerhaft wirken.
So wird Demut im Kontext digitaler Kontrolle zu einer ethischen Leitkategorie. Sie steht für Maßhalten in einer Welt, in der Überwachung, Profilbildung und Verhaltenssteuerung technisch trivial geworden sind. Demut erinnert daran, dass Freiheit nicht dort beginnt, wo alles sichtbar ist, sondern dort, wo Grenzen respektiert werden — auch und gerade im Digitalen.
Fazit
Demut ist keine moralische Schwäche, sondern eine Form der Stärke. Sie verzichtet auf Selbstüberhöhung, ohne Selbstwirksamkeit aufzugeben. Demut ist eine Haltung der Weltzugewandtheit — leise, aber tragfähig. In einer Zeit, die von „Gewissheiten”, Ansprüchen und Überforderung geprägt ist, eröffnet sie einen Raum für Maß, Verantwortung und menschliche Verbundenheit.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .