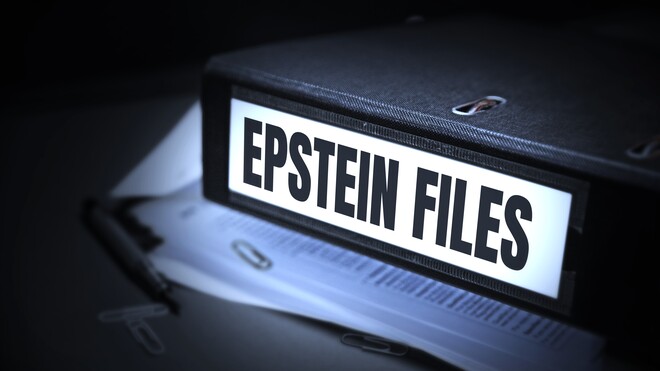Zentral für das Verständnis der aktuellen Handelspolitik ist die Frage nach den Absatzmärkten. Europas Wohlstand basiert in erheblichem Maße auf Exporten. Industrie, Maschinenbau, Chemie, aber auch Teile der Agrar- und Ernährungswirtschaft sind auf offene Märkte angewiesen. Dieses Modell funktionierte so lange, wie globale Nachfrage, stabile Energiepreise und geopolitische Berechenbarkeit gegeben waren. Genau diese Voraussetzungen sind jedoch in den vergangenen Jahren schrittweise entfallen.
Ein erster Bruchpunkt war der Verlust des russischen Marktes. Unabhängig von der moralischen Bewertung der politischen Entscheidungen ist wirtschaftlich unstrittig, dass Russland über Jahrzehnte ein relevanter Absatzmarkt für europäische Industrie- und Agrarprodukte war. Mit den Sanktionen und der politischen Eskalation wurde dieser Markt weitgehend geschlossen. Die wirtschaftlichen Folgen wurden lange kleingeredet oder als temporär dargestellt, sind aber bis heute nicht kompensiert. Neue Absatzräume, die diesen Verlust gleichwertig ausgleichen könnten, haben sich nicht in ausreichendem Maße eröffnet.
Auch das transatlantische Verhältnis hat an wirtschaftlicher Stabilität verloren. Die Vereinigten Staaten verfolgen seit Jahren eine offen protektionistische Industriepolitik. Programme zur Reindustrialisierung, massive Subventionen und nationale Beschaffungsregeln zielen darauf ab, Wertschöpfung im eigenen Land zu halten oder zurückzuholen. Für europäische Produzenten bedeutet das wachsende Markteintrittsbarrieren und Standortnachteile. Der US-Markt ist damit nicht mehr der offene Absatzraum, als den ihn europäische Strategen lange betrachtet haben.
Diese zwei Entwicklungen, Russland und USA, markieren eine geopolitische Konstellation, in der die EU zunehmend zwischen größere Machtblöcke gerät, ohne selbst über vergleichbare wirtschaftliche Steuerungsinstrumente zu verfügen.
Gleichzeitig verschärfen interne Faktoren den Druck. Hohe Energiepreise, verschärfte Regulierungen und eine zunehmend komplexe Gesetzgebung belasten insbesondere kleine und mittlere Unternehmen. Die industrielle Basis Europas steht unter Druck, Investitionen wandern ab oder werden verschoben.
Hinzu kommt die fiskalische Lage. Viele EU-Staaten sind hoch verschuldet, gleichzeitig steigen die Ausgaben für Verteidigung, Klimapolitik, soziale Sicherungssysteme und Zinsdienst. Der finanzielle Spielraum schrumpft. Wachstum, das diese Lasten tragen könnte, bleibt aus. In dieser Situation gewinnt Außenhandel eine neue Bedeutung. Nicht als langfristige Entwicklungsstrategie, sondern als kurzfristige Entlastung. Neue Märkte sollen Wachstum erzeugen, ohne dass innenpolitisch schmerzhafte Strukturentscheidungen getroffen werden müssen.
Besonders auffällig ist, dass in dieser Strategie die Landwirtschaft eine zentrale Rolle einnimmt. Agrarprodukte gelten als vergleichsweise leicht handelbar, standardisierbar und politisch weniger sensibel als industrielle Schlüsseltechnologien. Gleichzeitig ist die Landwirtschaft in vielen EU-Staaten stark reguliert, kostenintensiv und gesellschaftlich umstritten. Sie wird damit zum idealen Feld für handelspolitische Kompromisse. Marktöffnung nach außen lässt sich hier leichter durchsetzen als in anderen Sektoren.
Diese Logik erklärt, warum Agrarabkommen in Zeiten wirtschaftlicher Schwäche an Bedeutung gewinnen. Sie dienen nicht primär der Ernährungssicherung, sondern der Handelsbilanz.
Landwirtschaft wird in diesem Kontext weniger als strategische Infrastruktur betrachtet, sondern als Variable in geopolitischen Verhandlungen. Der Fokus verschiebt sich von regionaler Stabilität hin zu globaler Wettbewerbsfähigkeit.
Dabei entsteht ein grundlegender Widerspruch. Nach innen verschärft die EU Umwelt-, Klima- und Dokumentationsauflagen für landwirtschaftliche Betriebe. Investitionen in neue Stallungen, technische Umrüstungen und administrative Prozesse werden eingefordert, oft ohne ausreichende finanzielle Kompensation. Gleichzeitig öffnet man die Märkte für Importe aus Regionen, in denen andere Produktionsbedingungen gelten. Diese Asymmetrie ist kein Zufall, sondern Ausdruck einer Prioritätensetzung: Außenwirtschaftliche Ziele wiegen schwerer als die Stabilität der eigenen landwirtschaftlichen Struktur.
Die politische Kommunikation vermeidet es, diesen Zusammenhang offen zu benennen. Stattdessen wird von Chancen, Diversifizierung und globaler Verantwortung gesprochen. Doch unter der Oberfläche geht es um die Suche nach Absatz in einer Welt, in der traditionelle Märkte wegbrechen. Die EU agiert dabei weniger aus Stärke als aus Anpassungsdruck. Sie versucht, verlorene Spielräume durch neue Abkommen zu kompensieren, ohne die strukturellen Ursachen ihrer wirtschaftlichen Schwäche zu adressieren.
Diese Strategie birgt Risiken. Neue Märkte sind keine Garantie für nachhaltiges Wachstum. Sie sind abhängig von politischen Stabilitäten, Wechselkursen, Transportkosten und globalen Konjunkturen. Zudem verstärken sie die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten, die sich in den vergangenen Jahren als anfällig erwiesen haben. Für die Landwirtschaft bedeutet das eine doppelte Belastung: Sie muss sich sowohl an verschärfte interne Vorgaben anpassen als auch im globalen Wettbewerb bestehen.
Für die Bevölkerung bleibt diese Entwicklung oft abstrakt. Handelsabkommen erscheinen als technische Verträge, verhandelt fernab des Alltags. Doch ihre Wirkung reicht tief in die Versorgungssysteme hinein. Sie beeinflussen, woher Lebensmittel kommen, unter welchen Bedingungen sie produziert werden und wie stabil regionale Strukturen bleiben. Wenn Außenhandel zur Kompensation innerer Schwäche genutzt wird, gerät die Frage der Versorgungssicherheit zwangsläufig in den Hintergrund.
Die Konsequenzen: Landwirtschaft als Ausgleichsmasse und die Erosion der Versorgungssouveränität
Die handelspolitische Strategie, neue Absatzmärkte zu erschließen, bleibt nicht folgenlos. Sie verschiebt Prioritäten, verändert Machtverhältnisse und wirkt tief in die Strukturen der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelversorgung hinein. Wo Außenhandel als Kompensation innerer Schwächen dient, geraten jene Sektoren unter Druck, die sich am leichtesten in internationale Abkommen integrieren lassen. Die Landwirtschaft gehört dazu. Sie wird nicht offen geopfert, aber implizit neu bewertet: weniger als tragende Säule gesellschaftlicher Stabilität, mehr als verhandelbare Größe in geopolitischen und ökonomischen Kalkülen.
Für bäuerliche Betriebe bedeutet diese Verschiebung eine strukturelle Überforderung. Auf der einen Seite stehen wachsende Anforderungen an Umwelt-, Klima- und Tierschutz, an Dokumentation, Nachweisführung und technischer Umrüstung. Diese Anforderungen sind politisch gewollt und gesellschaftlich breit legitimiert.
Auf der anderen Seite öffnen Handelsabkommen den Markt für Produkte, die unter anderen Bedingungen erzeugt wurden. Der entscheidende Punkt ist nicht der moralische Vergleich, sondern die ökonomische Asymmetrie. Wer höhere Kosten trägt, ohne dafür einen stabilen Marktausgleich zu erhalten, verliert langfristig Wettbewerbsfähigkeit.
Diese Dynamik wirkt selektiv. Große, kapitalstarke Betriebe können Anpassungskosten eher schultern, kleinere und mittlere Höfe geraten schneller in existenzielle Schwierigkeiten. Die Folge ist eine fortschreitende Konzentration. Betriebe geben auf, Flächen werden zusammengelegt, Eigentumsstrukturen verändern sich. Dieser Prozess wird häufig als Effizienzsteigerung beschrieben, ist aber in Wirklichkeit eine strukturelle Verarmung ländlicher Räume. Vielfalt wird durch Skalierung ersetzt, Resilienz durch Abhängigkeit.
Gleichzeitig verändert sich die Rolle des Staates. Während er nach innen regulierend eingreift, zieht er sich nach außen auf die Rolle des Marktöffners zurück. Er setzt Rahmenbedingungen, überlässt die Anpassung jedoch weitgehend den Betrieben. Ausgleichsmechanismen bleiben begrenzt, zeitlich befristet oder bürokratisch schwer zugänglich. Die politische Verantwortung für die Folgen der Marktöffnung wird damit dezentralisiert. Sie liegt faktisch bei den Produzenten, nicht bei den Verhandlern.
Der politische Diskurs reagiert darauf häufig mit Beschwichtigungen. Globale Märkte seien stabil, Diversifizierung erhöhe Sicherheit, internationale Arbeitsteilung sei effizient. Diese Argumente sind nicht falsch, aber sie blenden einen zentralen Aspekt aus:
Versorgungssicherheit ist nicht nur eine Frage von Verfügbarkeit, sondern auch von Kontrolle. Wer über die Produktionsbedingungen, Lagerhaltung und Verteilung entscheidet, bestimmt letztlich auch über Zugang und Preis. Mit wachsender Abhängigkeit schrumpfen diese Einflussmöglichkeiten.
Besonders problematisch ist die schleichende Normalisierung dieser Abhängigkeit. Sie wird nicht als Verlust wahrgenommen, sondern als moderner Zustand. Regionale Selbstversorgung gilt als nostalgisch, Autonomie als ineffizient. Gleichzeitig werden Kompetenzen und Infrastrukturen abgebaut, die im Krisenfall schwer reaktivierbar sind. Landwirtschaftliche Kenntnisse, regionale Verarbeitung, lokale Vermarktung verlieren an Bedeutung. Was kurzfristig kostengünstig erscheint, erzeugt langfristige Verwundbarkeit.
Hinzu kommt eine politische Entkopplung. Handelsabkommen werden auf europäischer Ebene verhandelt, ihre Folgen tragen jedoch nationale und lokale Akteure. Diese Asymmetrie erschwert demokratische Kontrolle. Entscheidungen mit tiefgreifenden Auswirkungen auf Ernährung, Umwelt und regionale Wirtschaft werden in technischen Verfahren getroffen, fernab öffentlicher Debatte. Die Landwirtschaft wird so zum Gegenstand von Politik, ohne politisch gestaltbar zu bleiben.
Für Verbraucher äußert sich diese Entwicklung zunächst kaum spürbar. Regale bleiben gefüllt, Preise schwanken, aber Versorgungslücken bleiben aus. Gerade diese Stabilität macht den Prozess schwer greifbar. Die langfristigen Effekte, Verlust regionaler Strukturen, Abhängigkeit von Importen, eingeschränkte Wahlmöglichkeiten, sind nicht unmittelbar sichtbar. Sie zeigen sich erst, wenn Alternativen fehlen. Dann ist der Handlungsspielraum bereits eingeschränkt.
Ein weiterer Aspekt ist die internationale Dimension. Handelsabkommen verschieben nicht nur Märkte, sondern auch Produktionsanreize. Regionen mit geringeren Kosten und schwächeren Regulierungen werden in globale Lieferketten integriert. Das kann wirtschaftliche Entwicklung fördern, aber auch ökologische und soziale Konflikte verschärfen. Die Verantwortung dafür bleibt diffus. Die EU profitiert von günstigeren Importen, trägt aber die Folgekosten nicht unmittelbar. Diese Externalisierung ist Teil der Logik globaler Märkte, widerspricht jedoch dem Anspruch nachhaltiger Politik.
Für die europäische Landwirtschaft entsteht daraus ein paradoxer Zustand. Sie soll zugleich Vorreiter für Nachhaltigkeit sein und sich im globalen Wettbewerb behaupten. Diese Doppelanforderung ist politisch attraktiv, praktisch jedoch kaum einlösbar. Ohne klare Prioritätensetzung bleibt sie ein Zielkonflikt, der auf dem Rücken der Betriebe ausgetragen wird. Handelsabkommen verstärken diesen Konflikt, indem sie Wettbewerb intensivieren, ohne die Rahmenbedingungen anzugleichen.
Die Suche nach neuen Märkten ist aus Sicht der EU kurzfristig nachvollziehbar. Sie lindert ökonomischen Druck und schafft politische Handlungsspielräume. Doch sie verlagert Probleme, statt sie zu lösen.
Anstatt die innere Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz zu stärken, wird auf externe Kompensation gesetzt. Landwirtschaft und Ernährung werden dabei zu Instrumenten dieser Strategie, nicht zu ihrem Ausgangspunkt.
Diese Entwicklung muss nicht zwangsläufig in eine Versorgungskrise münden. Sie kann jedoch die Voraussetzungen dafür schaffen. Je weiter sich Produktion und Kontrolle voneinander entfernen, desto größer wird die Abhängigkeit von Faktoren, die politisch kaum steuerbar sind. Die Frage ist nicht, ob internationale Handelsbeziehungen sinnvoll sind, sondern welche Rolle sie im Gesamtsystem spielen sollen.
Am Ende steht eine grundsätzliche Entscheidung: Will die EU Ernährung als Teil ihrer strategischen Souveränität begreifen oder als Variable in einer exportgetriebenen Wirtschaftspolitik? Handelsabkommen wie das mit Mercosur geben darauf eine implizite Antwort. Sie priorisieren Marktzugang vor Strukturstabilität. Diese Prioritätensetzung ist politisch umstritten, ökonomisch riskant und gesellschaftlich folgenreich.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
EU-Mercosur partnership agreement – Opening opportunities for European farmers
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/mercosur/eu-mercosur-agreement/factsheet-eu-mercosur-partnership-agreement-opening-opportunities-european-farmers_en
EU und Mercosur unterzeichnen historische und ehrgeizige Partnerschaft (EU-Vertretung)
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-und-mercosur-unterzeichnen-historische-und-ehrgeizige-partnerschaft-2026-01-17_de
EU-Mercosur Abkommen: EuGH soll Vereinbarkeit mit EU-Verträgen prüfen (EP-Pressemitteilung)
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20260116IPR32450/eu-mercosur-abkommen-eugh-soll-vereinbarkeit-mit-eu-vertragen-prufen
EU-Mercosur agreement – Hauptziele und Handelszahlen (EU-Trade)
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/mercosur/eu-mercosur-agreement_en
Tausende Bauern protestieren in Straßburg gegen EU-Mercosur-Abkommen
https://www.gefluegelnews.de/article/mercosur-tausende-bauern-protestieren-in-strassburg
Verbraucherschützer warnen vor Risiken des EU-Mercosur-Abkommens
https://www.suedtirolnews.it/politik/verbraucherschuetzer-warnen-vor-eu-mercosur-abkommen