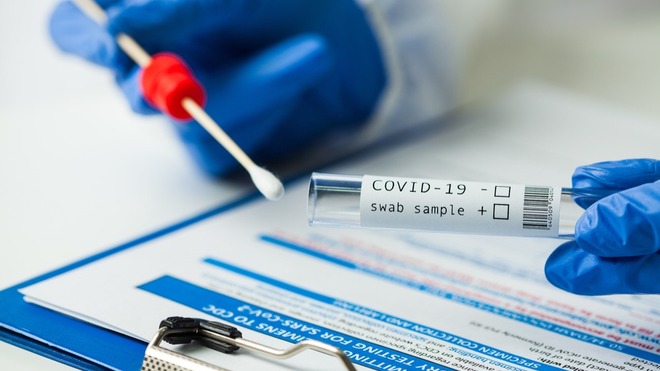Die Maul- und Klauenseuche (MKS) ist Anfang des Jahres in Ungarn, der Slowakei und in Deutschland ausgebrochen — hierzulande erstmals seit 1988. Betroffen war eine Herde Wasserbüffel im Land Brandenburg. Der Ausbruch hat jedoch durch Exportverbote und Sperrbezirke einen Millionenschaden auch in anderen Bundesländern angerichtet.
Die sofort ergriffenen Maßnahmen gegen die Ausbreitung umfassten die Einrichtung einer Sicherheitszone, Desinfektionsmaßnahmen sowie die Keulung von Rindern, etwa bei einem Milchbetrieb in Ungarn, bei dem fünf Prozent der Rinder Symptome aufwiesen und dennoch der ganze Bestand getötet wurde. Die nun aufgetretene Maul- und Klauenseuche sei tausendfach ansteckender, als beispielsweise die Vogelgrippe, so wurde erklärt und sogleich vor einer neuen Pandemie gewarnt. Dabei bedeutet ansteckend nicht unbedingt tödlich. Nur weil eine Krankheit sehr ansteckend ist, stellt sie noch nicht zwangsläufig ein hohes Risiko dar.
Das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) schreibt auf seiner Seite, dass es sich bei MKS um eine hochansteckende Krankheit handele, die aber für den Menschen ungefährlich sei. Es empfiehlt, kranke Tiere immer auch auf MKS zu untersuchen. Symptomatisch ist die Krankheit an mit Flüssigkeit gefüllten Blasen an Schleimhäuten und Hufen der Tiere zu erkennen. Weiterhin gehören zu den Symptomen Trägheit, ein Rückgang der Milchleistung und Schmerzen. Manche Tiere verlieren ihre Hornhaut an den Hufen und erleiden so starke Schmerzen, dass sie nicht mehr stehen können. Zudem sei es möglich, dass sich das Virus auf Skelett und Herzgewebe ausbreite, mit starken Schäden bis hin zum Tod. Es wird zwischen einer gutartigen Variante mit einer Letalität von zwei bis fünf Prozent und einer bösartigen mit einer Letalität von bis zu 80 Prozent unterschieden. Letztere trete aber vor allem bei Kälbern auf, die binnen 24 Stunden versterben. Bei der gutartigen Form beträgt die Zeit für die Heilung bis zu 14 Tage.
Beim Schwein verläuft die Krankheit weniger dramatisch als beim Rind. Symptomatisch lässt sie sich nicht von anderen Krankheiten wie der Stomatitis vesicularis (VS), der Vesikulären Schweinekrankheit (SVD) oder dem Vesikulären Exanthem (VES) unterscheiden. Bei Schafen und Ziegen sind erwachsene Tiere hauptsächlich von milden Varianten betroffen, während sich die tödliche Variante auf Lämmer beschränkt. Das FLI erklärt sogar, dass Schafe und Ziegen überhaupt keine Symptome zeigen — das ist aber kein Grund für Beschwichtigung, sondern mache sie zu symptomlosen Überträgern.
Wie ansteckend die Krankheit ist, wurde in Tierversuchen untersucht. Dabei wird die Ansteckung nicht selten dadurch herbeigeführt, dass die Erreger den Tieren direkt in die Mundschleimhäute oder in die Klauen injiziert werden. Auch die Verabreichung rekombinanter Adenoviren zur Testung von Impfstoffen wird zu diesem Zweck durchgeführt. Dabei handelt es sich um keinen natürlichen Ansteckungsweg. Zudem ist dieser Weg weit weniger effizient als die Infektion über Aerosole und erfordert etwa die 10.000-fache Virenlast.
Ein „Nachweis“ von MKS erfolgt mittels PCR-Test — der jedoch die bereits bekannten und mehrfach behandelten Probleme mit sich bringt. Das bedeutet: ein Nachweis mittels PCR-Test hat, wie schon bei der Vogelgrippe, überhaupt keine Aussagekraft. Weder kann er eine Infektion von einer Kontamination unterscheiden, noch lebendes von totem Erregermaterial, noch ist eindeutig klar, was genau der Test eigentlich misst. Unterschieden werden kann damit aber auch nicht zwischen den beiden Varianten. Es bleibt unklar, ob die betroffenen Tiere an der tödlichen Variante oder der milden Variante erkranken. Die Unterscheidung von tödlichen und milden Erregern wird mittels PCR-Test getroffen und ist daher wenig verlässlich.
Grundsätzlich sind auch andere Nachweismethoden möglich, diese sind aber eher langwierig und werden daher in der Praxis, in der schnelles Handeln erforderlich scheint, höchstens nachträglich eingesetzt.
Grundsätzlich gilt aber, dass ganze Tierbestände schon aufgrund eines einzelnen Falles ohne nähere Untersuchung, ob es sich um einen tödlichen oder milden Erreger handelt, gekeult werden können — und gesetzlich vorgeschrieben sogar gekeult werden müssen.
Das Seuchengesetz besagt in § 3, dass schon bei einem bloßen Verdacht alle „empfänglichen“ Tiere getötet werden müssen. Als empfängliche Tiere gelten alle, die potenziell an MKS erkranken können. Tritt also in einem Rinderzuchtbetrieb ein einzelner Verdachtsfall auf, ordnet die Behörde die Tötung aller Tiere an.
Nach amtlicher Feststellung der Krankheit müssen dann alle anderen empfänglichen Tiere getötet werden — welche Tiere zu diesem Zeitpunkt auch immer noch übrig sein mögen. Dieser Nachweis wird in der Regel mittels PCR-Test erbracht, kann aber auch auf der einfachen Einschätzung des zuständigen Veterinärs beruhen. Das ist gerade dann schwierig, wenn die Krankheit — wie bei Schweinen — symptomatische Ähnlichkeiten zu anderen Krankheiten hat. Die Anzucht des Erregers im Labor, nachfolgende Nachweismethoden des Erregers und Negativkontrollen an gesunden Tieren werden in der Praxis nicht durchgeführt — und müssen das auch nicht.
Die Landwirte werden gegen eine schnelle Keulung der Tiere in der Regel keine Einwände erheben. Denn die MKS führt selbst in der milden Form zu einem Leistungsabfall der Tiere und kann für einige Tiere den Tod bedeuten — was für den Landwirt Verluste bedeutet. Rentabler ist es daher, den Bestand zu töten und sich den Schaden durch die Tierseuchenkasse erstatten zu lassen.
Wie schon bei der Vogelgrippe wird auch hier die schnelle Keulung der Tiere zu großen Teilen von ökonomischen Erwägungen getragen. Eine genaue Todesrate der MKS lässt sich auf diese Weise gar nicht bestimmen — sie wird verzerrt durch die vorschnelle Keulung großer Bestände, auch bei minimalem und möglicherweise falschem Verdacht. Dies gilt insbesondere, wenn bei allen Krankheitssymptomen auch auf MKS getestet werden soll und wird. Ein unzuverlässiger PCR-Test gibt dann unter Umständen ein falsch-positives Ergebnis, woraufhin ein MKS-Ausbruch behauptet wird, der vielleicht gar nicht existiert.
Hinzu kommt, dass, wie schon bei der Vogelgrippe, auch bei MKS, Impfungen und Heilungsversuche — die bei einer Letalität von fünf Prozent und einer Erholungsphase der Tiere von bis zu 14 Tagen ja durchaus vielversprechend wären, verboten sind. Landwirte dürfen ihre Tiere also gar nicht zu heilen versuchen, sondern müssen sie gleich töten lassen. Impfungen sind — vorbehaltlich einiger Ausnahmen — ebenfalls nicht erlaubt. Dennoch gibt es Impfstoffe gegen sechs der sieben Serotypen der MKS. Diese verhindern allerdings nicht die Infektion, sondern sollen die Tiere lediglich vor Erkrankung schützen und die Virenlast verringern. Ein großer Hersteller solcher Impfstoffe ist der Konzern Boeringer-Ingelheim. Auch an mRNA-Impfstoffen gegen MKS wird bereits geforscht, unter Anderem in China und Australien.
So hat der US-amerikanische Konzern Tiba Biotech im Rahmen eines von „Meat and Livestock Australia“ aufgelegten und mit 20 Millionen US-Dollar ausgestatteten Programms einen mRNA-Impfstoff entwickelt, der vollkommen synthetisch ist und dessen Entwicklungskosten sich auf 2,5 Millionen Dollar belaufen. Tiba Biotech arbeitete in der Vergangenheit bereits eng mit dem US-amerikanischen Militär zusammen, erhielt Unterstützung durch die Gatesfoundation, forschte an einem Grippeimpfstoff, der Covid-19 mit einschließen sollte und an einem Impfstoff gegen die Vogelgrippe.
Die Wirksamkeit der mRNA-Stoffe wird als sehr hoch eingeschätzt, wobei diese Einschätzung auf die Bildung bestimmter Antikörper und Entzündungsmarker beruht.
Ähnlich wie bei den Corona-Genspritzen sagen diese jedoch lediglich, dass der Körper aus irgendwelchen Gründen Immun- und Entzündungsreaktionen produziert — bei Corona war der Grund der Impfstoff an sich, der ein vielfältiges Toxin darstellt. Impfungen wurden dann auch medial verstärkt diskutiert und als einzige Antwort auf MKS angepriesen. Wenig Überraschend finanziert auch die Gates Foundation die Erforschung von Impfstoffen.
Die Wirksamkeit von Impfstoffen wird selten prozentual angegeben, kann aber, wie ein Feldversuch in Äthiopien zeigt, die empfohlenen 75 Prozent unterschreiten. Die Wirksamkeit der Impfungen mit abgetöteten Erregern wird als die höchste eingeschätzt, dicht gefolgt von den mRNA-Stoffen — die Erfahrung mit den Corona-Genspritzen zeigt jedoch, dass es sich dabei um eine Täuschung handeln kann. Das beschriebene Nebenwirkungsprofil wird kaum prozentual erfasst und beschränkt sich auf Schmerzen an der Einstichstelle sowie einige systemische Folgen. Die mRNA-Stoffe werden allgemein als „sicher“ klassifiziert, wobei auch hier die Erfahrung mit den Corona-Spritzen zeigt, dass auf diese Einstufung nicht zu vertrauen ist. Es gibt keine wirklich umfassenden Daten bezüglich Wirksamkeit und Nebenwirkungen. Eine der Herausforderungen bei Impfungen ist, dass die Impfung immer exakt gegen den zirkulierenden Stamm erfolgen muss, und dass die Immunität relativ schnell nachlässt. Das bietet natürlich einen Anlass für wiederholte Impfungen.
Der weltweite Markt für Impfstoffe gegen MKS wird für das Jahr 2024 auf zwischen 2,27 Milliarden und 3,01 Milliarden US-Dollar geschätzt. Dieser Markt könnte natürlich erheblich wachsen, wenn die EU als Markt erschlossen würde. Denn in der EU wird derzeit von einer vorbeugenden Impfung abgesehen. Tatsächlich haben Ungarn und die Slowakei mit der begrenzten Durchführung von suppressiven Impfungen auf betroffenen Höfen reagiert, während Deutschland seine Impfdatenbank aktivierte und das Land Brandenburg Impfstoffe herstellen ließ, die binnen einer Woche bereitstanden. Dabei handelte es sich um Impfstoffe, die auf abgetöteten Erregern basieren.
Denn in Europa wird seit 1992 nicht mehr vorsorglich gegen MKS geimpft, da die Krankheit hier als ausgerottet galt. Doch ausgerechnet jetzt taucht sie wieder auf. Kann das Zufall sein? Nicht unbedingt. Schon vergangene Ausbrüche der Krankheit, etwa in Großbritannien, hatten einen Laborursprung. Auch das Ministerium für Staatssicherheit der DDR stellte 1983 in einem Bericht fest, dass ein Ausbruch der MKS an der Ostseeküste auf einen gescheiterten Impfstoffversuch im Forschungslabor der Insel Riems zurückzuführen war. Impfversuche können also, wenn sie schiefgehen, einen Krankheitsausbruch verursachen. Wenn nun also Impfungen gegen Serotyp O — insbesondere mRNA-Impfungen — wie weiter oben gezeigt entwickelt wurden, und Serotyp O in Deutschland, Ungarn und der Slowakei auftrat, dann könnte es sich um ein missglücktes Impfexperiment handeln.
Aber auch eine bewusste Freisetzung des im Labor gezüchteten Virus ist möglich. Diese Möglichkeit brachte die ungarische Regierung in Reaktion auf den Ausbruch von MKS in Ungarn Anfang des Jahres ins Spiel. Dabei sprach die Regierung Orbán von einem Angriff mit einer Biowaffe. Auch in der Slowakei gibt es Stimmen, die diese Möglichkeit ins Spiel bringen — allerdings nicht von offizieller Seite. Das wäre denkbar, wenn man bedenkt, dass Ungarn und die Slowakei in der EU von der herrschenden Linie abweichen und auf ihre Souveränität beharren. Hinzu kommt, dass Ungarn ein Verbot von Kunstfleisch anstrebt — ein „Lebensmittel“ das gerade als Ersatz für die Tierhaltung in Stellung gebracht wird.
Auch zeitlich ist der „Ausbruch“ interessant. Noch im September 2024 hatte sich der damalige Landwirtschaftsminister Cem Özdemir mit dem MKS-Spezialisten des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI), Michael Eschbaumer, auf der Insel Riems getroffen wo das Institut Biolabore betreibt und an Viren und anderen Erregern forscht.
Ähnlich wie bei der Vogelgrippe könnte MKS genutzt werden, die Landwirtschaft und Tierzucht bewusst zu zerstören. Dazu passt, dass MKS lediglich mit positiven Tests „nachgewiesen“ wird und auf dieser Grundlage ganze Tierbestände getötet werden.
Ob dabei in Brandenburg überhaupt MKS ausgebrochen ist, steht als Frage im Raum. Die Behörden weigern sich, Informationen dazu herauszugeben.
Symptomatisch ist die Krankheit zudem kaum von der Blauzungenkrankheit zu unterscheiden. Auch bei dieser gibt es Symptome wie Schwellungen der Mundschleimhäute, Apathie, Fieber und Absinken der Milchleistung. Eine weitergehende Unterscheidung ist nur mittels Labortests möglich, bei denen jedoch ebenfalls die PCR-Methode angewandt wird. Wie das Friedrich-Löffler-Institut über die Blauzungenkrankheit schreibt bringt diese Krankheit zwar einige unangenehme Symptome mit sich — unter anderem Aborte von schwangeren Tieren — kann aber ausheilen und liefert dann eine robuste Immunität der Tiere. Die Krankheit ist in der EU anzeigepflichtig und als einzig wirksame Maßnahme gegen sie wird die Impfung angegeben — die im Gegensatz zu MKS routinemäßig erfolgt. Auch hier gibt es gefährlichere und harmlose Varianten, wobei die harmlosen dominieren und die Symptome für die Tiere zwar unangenehm, aber selten gefährlich sind.
Auch im Falle eines Auftretens der Blauzungenkrankheit ordnet die Behörde die Tötung der Tiere an, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Behandlung ist hier auf Anordnung der Behörde mittels Insektiziden möglich — was allerdings die Tierprodukte für den Markt unbrauchbar machen dürfte. Da auch diese Krankheit mit verminderter Leistung und damit mit wirtschaftlichen Verlusten für den Halter einhergeht wird dieser im Zweifelsfall gegen die Tötung der Tiere wohl nichts einzuwenden haben. Es ist also durchaus möglich, dass die Ausbrüche von MKS in Wahrheit Fälle der Blauzungenkrankheit waren — die lediglich mittels PCR-Test oder anhand der Symptomatik als MKS diagnostiziert wurden.
Die Blauzungenkrankheit wurde bereits 2023 in Deutschland festgestellt. Hier ist der Serotyp 3 (BTV-3) aufgetreten. Seit Mai 2024 wurden über 15.000 Fälle der Krankheit festgestellt. Interessanterweise gab die Tierärztekammer bereits 2022 ein Schreiben heraus, in dem Impfstoffe des Herstellers SanVet Biotech gegen BTV-3 der Blauzungenkrankheit zurückgerufen wurden. Auch im April 2024 folgten weitere Rückrufe von Impfstoffen derselben Firma. Der Grund: Nach der Impfung wurden positive PCR-Testergebnisse festgestellt — was mit einer Infektion der Tiere mit der Blauzungenkrankheit gleichgesetzt wird. Laut Hersteller können dabei auch typische Symptome der Blauzungenkrankheit auftreten.
Bei den Impfungen handelt es sich um autogene Impfstoffe, also solche mit abgetöteten Erregern. Es erscheint daher nicht unwahrscheinlich, dass möglicherweise lebende Erreger statt abgetöteter injiziert wurden, die sich anschließend verbreiteten.
Wie Bauern bei der Anwendung von Impfstoffen gegen Blauzungenkrankheit berichtet haben sind die Nebenwirkungen der Impfungen zum Teil sehr schwerwiegend. Darunter etwa eine enorme Zunahme von Aborten schwangerer Tiere.
Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit haben also genau die Krankheit zur Folge, die sie zu verhindern versprechen. Als Folge des Ausbruchs und des Rückrufs von Impfstoffen hat das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) im Juni 2024 weitere Impfstoffe per Eilverfahren zugelassen. Dabei handelte es sich um Präparate des Konzerns Boeringer-Ingelheim, Ceva Tiergesundheit GmbH und Virbac Tiergesundheit GmbH. Zumindest Boeringer Ingelheim hat enge Verbindungen zum Friedrich-Löffler-Institut — dazu mehr in einem späteren Artikel. Auch mit Ceva Tiergesundheit GmbH arbeitet das FLI in mehreren Bereichen zusammen, unter anderem im Rahmen von Forschung oder im Projekt „OneHealth Region Vorpommern“.
Wie man sieht, besteht eine große Unsicherheit bezüglich der angeblichen Ausbrüche von MKS. Die Krankheit lässt sich symptomatisch kaum von vielen anderen Krankheiten unterscheiden, und eine Differentialdiagnostik wird lediglich mittels eines sinnlosen PCR-Tests durchgeführt. Massenhafte Tests, wie sie beim Auftreten jedweder Symptomatik empfohlen werden, können zahlreiche falsch-positive Fälle erzeugen und damit den Eindruck einer Epidemie erwecken. Die schnelle Keulung der Tiere ist zwar gesetzlich vorgeschrieben und aus ökonomischer Sicht verständlich — obwohl weder MKS noch Blauzungenkrankheit in der Regel wirklich tödlich sind — und für den Menschen keine Gefahr darstellen. Zudem ist es möglich, dass Ausbrüche auf Impfstoffversuche oder sogar eine bewusste Freisetzung des Erregers zurückzuführen sind.
Letztlich sind es vor allem die strengen EU-Regularien, die solch drastische Maßnahmen wie die massenhafte Tötung erforderlich machen — nicht jedoch die tatsächliche epidemiologische und virologische Realität.
Wie schon bei der Vogelgrippe dienen die regelmäßig beschworenen Pandemien mehreren Zielen: Sie helfen, einen Impfstoffmarkt zu eröffnen, der derzeit in der EU noch verschlossen ist, und zerstören die Landwirtschaft — und damit die Versorgung der Menschen, die dann in den Händen der Oligarchie zentralisiert und monopolisiert werden kann — inklusive Fleisch und Milch aus dem Labor, die in Ungarn verboten werden sollen. Diese Produkte können, bei einer großflächigen „Pandemie“, verbunden mit massenhaftem Töten der Tiere, als Retter in der Not eingeführt werden — wobei dann auch zur Versorgung der Menschen der notwendige Zwang geschaffen werden kann. Auf diese Weise reißen die Konzerne und Oligarchen die Lebensmittelversorgung an sich und überführen die Welt in einen neuen Feudalismus — an dem bereits seit Jahren gearbeitet wird, wie der Kampf gegen die Landwirtschaft in der EU, Großbritannien und den USA beweist. Auch die Maul- und Klauenseuche könnte dabei eine Waffe gegen die Landwirte sein, um diese zur Aufgabe ihrer Arbeit zu zwingen.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen: