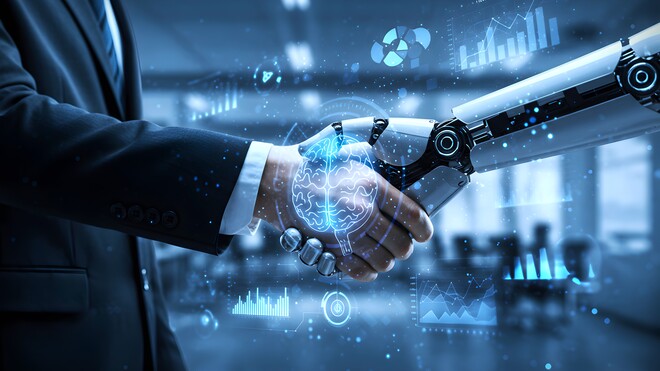Überfüllte Hörsäle, Studieren als Selbstverwertungszweck, Dozentenmangel, Bologna-Workload, Bulimielernen, Burnout mit 20. Aber nichts rührt sich, man arrangiert sich mit den Umständen, macht irgendwie das Beste daraus, igelt sich ein und unterlässt jeden Blick über den Tellerrand.
„Unrecht“ löse halt nicht immer gleich „Empörung“ aus, meint Tilman Reitz, Soziologieprofessor an der Universität Jena. Er steckt selbst mitten drin in der Mühle, die heute „unternehmerische Hochschule“ heißt. Den Spagat zwischen Publikationszwang, Drittmitteleinwerbung, Korrekturarbeit und dem Selbstanspruch, gute Lehre zu machen, bezahlt er mit wenig Schlaf und viel Frust. Im Interview mit dem Rubikon äußert er trotzdem die Hoffnung auf Besserung. Dafür brauche es allerdings „massiven Druck“ von unten.
Herr Reitz, 50 Jahre nach der sogenannten 68er-Bewegung gibt es in Zeitungsfeuilletons und TV-Talkshows deutsche Erinnerungskultur satt. Studentenrevolten, Kommune I, Bader-Meinhof-Bande, RAF, deutscher Herbst: Zwar alles irgendwie spannend, aufregend, romantisch – aber eben doch auch Schnee von gestern. Derweil gehen bei unseren französischen Nachbarn seit Wochen Menschen zu Zehntausenden gegen die neoliberale Reformpolitik von Staatspräsident Emmanuel Macron auf die Straße, besetzen Studenten landesweit Unigebäude, stürmen Hörsäle und legen den Lehrbetrieb lahm. Bräuchte es derlei nicht vielleicht auch mal wieder bei uns?
Tilman Reitz: Ja und Nein. Die spannende Frage ist ja, aus welchen Gründen es eine Revolte „braucht“. Wenn die nicht einleuchten, rücken die Mittel rasch ins Zwielicht. Zum Beispiel hat mir eine – nach meiner Einschätzung nicht konservative – Kollegin aus Frankreich berichtet, dass an ihrer Uni keine sachliche Verhandlung möglich sei, sinnlose Zerstörung vorherrsche und das Vertrauen zwischen Studierenden und Lehrenden zerrüttet sei. Dabei würde ich schon sagen, dass es in Frankreich einen Anlass zu protestieren gibt: Macronwill dort gerade in etwa das durchsetzen, was bei uns die Agenda 2010 und Hartz IV waren …
Wogegen sich an hiesigen Hochschulen seinerzeit gerade kein Protest regte…
Ja, leider. Wenn damals die Hörsäle besetzt worden wären, hätte sich zumindest ein Teil des Landes einer Politik widersetzt, die vielen Menschen viel Leid gebracht hat. Der neue Kapitalismus wäre hier dann vielleicht weniger stark geworden, die deutsche Regierung hätte sich vielleicht weniger skrupellos als wirtschaftliche Hegemonialmacht in der EU etabliert. Aber: Es braucht gute politische Urteilskraft und einiges Glück, um die Situation zu erkennen, in der man etwas tun muss und kann. Und vor allem muss auch in dem Milieu, in dem sich Protest entfaltet, schon etwas in Bewegung geraten sein.
Und diese Voraussetzung fehlt an hiesigen Hochschulen?
Eigentlich wären die rapide gestiegenen Studierendenzahlen genau eine Entwicklung dieser Art. Die damit verbundene Verunsicherung und Schwächung von Regeln ist für mich gerade der einzige Anlass, eine oppositionelle Dynamik bei den Studierenden für aussichtsreich zu halten. Allerdings bleibt dann immer noch offen, woher genau diese Gruppe das gesamtpolitische Mandat nehmen kann, das die 68er beansprucht haben.
Wenn man damals gegen beengte Lebensnormen, entfremdete Arbeit, Alternativlosigkeit in Berufs- und Familienleben rebelliert und gleichzeitig die größeren Kontexte kapitalistischer Profitwirtschaft, postkolonialer Herrschaft und Kriegführung angegriffen hat, gäbe es heute vergleichbare Anlässe: pseudokreative Selbstausbeutung, eine Mischung aus Selbstzwang und Fremdzwang zur Arbeit, mit dem großen Ziel, sich im internationalen Wettbewerb durchzusetzen, anderen Weltregionen immer noch mehr Ressourcen zu rauben und dort noch mehr Müll abzuladen, eine neue Welle der Hochrüstung, neue Arten der Kriegsführung et cetera. Doch der Kern legitimer Unzufriedenheit oder eigener Hoffnungen muss ziemlich stark sein, damit sich die Unzufriedenen auch hartnäckig und glaubhaft für weitergehende Änderungen einsetzen können.
Anpassungsdruck
Bleiben wir nur bei den inneren Zuständen der Hochschulen: Wogegen könnten oder müssten Studierende in Ihren Augen mit gutem Recht aufbegehren?
Die Studierenden in Deutschland haben sich vor einigen Jahren mit einem begründeten Protest durchgesetzt: Sie müssen trotz aller sonstigen marktliberalen Reformen weiter so gut wie keine Studiengebühren zahlen. Die entscheidende Gegenstrategie der Bundes- und Landesregierungen ist schwerer zu sehen: Sie komprimieren die Studienzeiten, nehmen billigend in Kauf, dass sich die Betreuungsverhältnisse verschlechtern und erhöhen den Ausbeutungsdruck aufs wissenschaftliche Personal.
Das Verhältnis Professur zu Studierenden hat sich kontinuierlich verschlechtert, zwischen 2005 und 2015 etwa von 1 zu 62 auf 1 zu 73. Die vielen neuen befristeten Projektstellen, die man unterhalb der Professur geschaffen hat, reißen das nicht heraus. Aber sie bringen denen, die auf ihnen arbeiten, Sorgen und Nöte, die sich auch in der Betreuungsqualität niederschlagen. Und dass die Zahl der miserabel bezahlten Lehraufträge drastisch wächst, macht die Lage für niemanden besser.
*Und trotzdem arrangieren sich alle irgendwie damit, Lernende und Lehrende gleichermaßen? *
Ja, denn die Reformen bringen auch Anpassungsdruck. Über die offizielleren Änderungen für die Studierenden, die seit den frühen 2000er Jahren unter dem Titel Bologna-Reform umgesetzt werden, wurde viel gestritten. Ein Aspekt der Reform ist eine verdichtete Betreuung und Kontrolle der Studierenden, was man auch Verschulung des Studiums nennen kann. Das gibt zugleich Orientierung und reduziert Freiräume: Die Studienstruktur ist vorgegeben, freiwillige Seminarbesuche kommen fast nicht mehr vor und gerade diejenigen, die ihr Studium ernstnehmen, geraten irgendwann unter starken Zeitdruck. Studieren steht unter diesen Bedingungen nur noch sehr begrenzt für selbstständige, erwachsene Annäherung an die Wissenschaft.
Also gäbe es durchaus Gründe genug, auf den Putz zu hauen. Nur: Warum passiert dann dergleichen nicht?
Für die Studierenden gibt es keinen akuten Protestanlass. Alles wird schleichend und stetig etwas schlechter. Die Gefechte um Studiengebühren und um Bologna sind vorbei. Dagegen hätten die wissenschaftlich Beschäftigten allen Grund zum Aufruhr, vor allem im Mittelbau oder im sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchs, aber auch die immer stärker überlasteten Professorinnen und Professoren, die zwischen Projektanträgen, Standardlehre und Verwaltungsaufgaben eigentlich keine Zeit mehr für echte Wissenschaft haben. Um es mit Rio Reiser und „Ton Steine Scherben“ zu sagen: Alles, was uns fehlt, ist die Solidarität.
Welt in Aufruhr – Uni im Tiefschlaf
Wer ist „uns“? Die Studierenden selbst oder alle Hochschulangehörigen zusammen?
Schon im Mittelbau und beim Nachwuchs sind die Situationen der Einzelnen so verschieden, dass eine organisierte Interessenvertretung schwerfällt. Die Professorinnen und Professoren waren nie übermäßig begabt für kollektives Handeln und verteidigen am ehesten ihre schrumpfenden Standesprivilegien. Eigentlich müssten sich in dieser Lage die Studierenden für das unterprivilegierte Lehrpersonal einsetzen, auch um die eigene Situation zu verbessern. Aber das wäre eine relativ ungewohnte Form von Solidarität und eine Einsicht in eigene Interessen, die ziemlich viel Vorwissen erfordert. Womöglich zündet trotzdem bald irgendwo ein Protestfunke, vielleicht auch in einer ganz anderen Ecke, man kann so etwas schwer voraussagen.
Vor Kurzem hielten Studierende das Gebäude des Fachbereichs Sozialökonomie der Universität Hamburg für einige Tage besetzt. Dabei problematisierten die Aktivisten ausdrücklich besagte Missstände in den „ökonomisierten Hochschulen“ und schlugen sogar den Bogen zur aktuellen französischen Protestbewegung, nach dem Motto: „Unsere Sorbonne ist die HWP“. An anderen deutschen Hochschulen regte sich trotzdem nichts. Dieser „Protestfunke“ hat schon mal nicht gezündet …
Immerhin hat das gezeigt: Protest ist möglich und die Studierenden, die in der Hamburger Sozialökonomie aktiv sind, sehen die Lage des Lehrpersonals offenbar ganz ähnlich wie ich und viele Leute in meinem Umfeld. Es hat sich also entweder herumgesprochen, wo das Problem liegt, oder eine bestimmte Wahrnehmung breitet sich aus. Dass die Hamburger aktiv werden, mag auch daran liegen, dass die Hochschule für Wirtschaft und Politik, die HWP, aus der die besetzte Fakultät entstanden ist, eine dezidiert linke, reformerische Tradition hat. Doch generell wächst die Bereitschaft, etwas zu tun. In Berlin hat ja etwa die Bewegung für eine Hochstufung der Hilfskraft-Tarifverträge – die es dort gibt – sehr erfolgreich mobilisiert. Meine Vermutung ist trotzdem, dass ein gemeinsames Thema, das alle wichtigen Gruppen empört, erst noch gefunden werden muss.
Wo wir bei „Protestfunken“ sind: Wir erleben gerade die Wiederkehr des „Kalten Krieges“, der sich zu einem heißen auswachsen könnte, aber Deutschland und Europa setzen auf Militarisierung statt Mäßigung. Die neoliberale Wachstumsökonomie droht der Menschheit die Lebengrundlagen zu entziehen, aber Deutschland und Europa sperren sich gegen echte Klimaschutzpolitik. Und mit dem Syrienkrieg kommt noch das dazu, was für frühere Generationen Vietnam war. Wenn schon die inneren Zustände der Hochschulen Studierende nicht „empören“, müssten nicht die politisch-gesellschaftlichen Begleitumstände – die ja immer auch in die Unis hineinwirken – Gegenwehr oder wenigstens Widerspruch provozieren?
Dazu kann man zwei Dinge sagen. Einmal in leichter Brecht-Abwandlung: Wo Unrecht ist, wächst nicht zwingend Empörung. Syrien ist mit Vietnam schwer vergleichbar, weil der Westen inzwischen je nach Deutung unentschlossener oder subtiler agiert. Und auch wenn man die US-Politik der Regime-Changes samt Förderung islamistischer Rebellen völlig ablehnt, ist Präsident Assad kein Sympathieträger für Linke. Selbst gegen die Militarisierung insgesamt bildet sich kein einheitlicher Protest, weil überall eine, in Einzelfällen berechtigte, Angst vor neuen Rechten in der Friedensbewegung herrscht.
Die deutsche Linke ist von einer Art grün-roter Spaltung durchzogen, die deutlich tiefer reicht als die Linie zwischen Grünen und Linkspartei. Meine ungefähre Idee zu den Ursachen ist, dass die jungen akademischen Linken zunehmend moralisch motiviert antreten und auch das Establishment einen liberal-moralischen Diskurs pflegt. Dadurch wird es fast zufällig, wo der Protestimpuls landet. Der andere Punkt ist natürlich, dass einem die Hochschulen und das durchgetaktete Studium nicht sehr viel Zeit zu kritischer Reflexion oder politischer Aktivität lassen.
„Viel Arbeit für die Tonne“
Müssen Sie als Linker nicht der Wahrheit ins Gesicht sehen: Die Hochschulen sind einfach nachhaltig entpolitisiert, vor allem ist das, was man unter „politisch links“ versteht, komplett marginalisiert.
Das stimmt nicht ganz. Im Vergleich zu den 1980er und 1990er Jahren haben sich viele Studierende und viele im wissenschaftlichen Personal wieder politisiert. Wir haben ja sogar die etwas absurde Politisierung von oben, bei der Unileitungen zur Teilnahme am „March for Science“ aufrufen. Neben dieser offiziellen Politik nehmen linke Haltungen im akademischen Milieu deutlich zu – das zeigen auch Wahlanalysen. Problematisch finde ich eher, wie sehr sich die kritischen Kolleginnen und Kollegen – mich selbst eingeschlossen – mit den Regeln des Betriebs abgefunden haben. Es scheint selbstverständlich oder eben alternativlos, dass man möglichst hochrangig publizieren, möglichst viele Drittmittel einwerben, auf möglichst vielen tollen Tagungen präsent sein will oder muss. Im Zweifelsfall macht man das sogar immer für die gute Sache. Die Mechanismen wurden alle schon kritisch analysiert. Doch die Konkurrenz scheint zumindest als Herrschaftstechnik effizienter zu sein als Verbote.
Um der, wie Sie sagten, fehlenden „Solidarität“ auf die Sprünge zu helfen, sollten Studierende mehr über die Arbeitssituation der Lehrenden erfahren. Wie lehrt es sich heute unter den Bedingungen der „unternehmerischen Hochschule“, dem Druck der Drittmitteleinwerbung, in überfüllten Hörsälen und Seminaren?
Ganz einfache Probleme hängen mit teilweise selbstverschuldeter Überlastung zusammen. Forschung und Lehre sind dabei randständig geworden. Korrekturen, Gremien, Anträge, Tagungsreisen, Projektbeaufsichtigung und vieles mehr summieren sich so, dass man im Semester am Schlaf sparen muss und auch bei viel Mühe unzuverlässig wird. Die Hörsäle und Seminarräume sind oft gar nicht so voll, aber am Ende landen doch über tausend Seiten Korrekturarbeit pro Jahr oder, zählt man Dissertationen und Habilitationen mit, pro Semester auf dem Tisch.
Dort, wo die Studierendenzahlen etwas sinken, kommt sofort Panik auf, dass nun weniger Geld für die nötigen Stellen da sei, was bei sogenannten Überlaststellen auch stimmt. Die Drittmitteleinwerbung stellt sich den Profs und ihren Mitarbeitenden oft sehr verschieden dar: Die einen wollen eigentlich nicht noch eine Baustelle, aber vielleicht doch mehr Reputation. Die anderen brauchen das Projekt, um überhaupt wieder für zwei bis drei Jahre bezahlt arbeiten zu können, und schreiben gewöhnlich den größten Teil der Anträge, oft in unbezahlter Mehrarbeit.
Generell sind sehr viele Anträge besser ausgearbeitet als die Ergebnisse. Wenn sie trotzdem abgelehnt werden – im Schnitt kommen wohl nur 20 Prozent durch – landet all diese Arbeit gleich in der Tonne. Vieles mehr wäre zu ergänzen, etwa die regelmäßigen Gutachten zu Stipendienverlängerungen, die sowieso in 99 Prozent der Fälle positiv ausfallen.
Bei all dem ist Ihre Situation als verbeamteter Professor noch vergleichsweise komfortabel, oder? Sie werden gut bezahlt und müssen nicht ständig um eine Anschlussbeschäftigung kämpfen.
Ja. Beim Nachwuchs sieht es viel schlimmer aus. Dort sind politische Kämpfe nötig, um das ständige Ringen um den Job zu beenden. Das deutsche Hochschulsystem hat die Zahl der befristeten Beschäftigungen in 10 bis 15 Jahren locker verdoppelt. Das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz soll diesen Zustand etwas zivilisieren, schreibt die andernorts arbeitsrechtswidrigen Befristungen aber auch fest.
Wenn es zum Beispiel Kürzestbefristungen erschwert, bleiben Nachwuchsforschende zwischen den Projekten öfter ohne Brückenfinanzierung. Und das Niveau von zwei- bis dreijährigen Vertragslaufzeiten, das sich allmählich einpendelt, gibt auch keine starke Planungssicherheit. Das Hauptproblem ist, dass die meisten, die wirklich in der Wissenschaft bleiben wollen, das gelobte Land der Professur weiterhin nicht erreichen. Nach den erlaubten zwölf Jahren befristeter Arbeit endet in der Regel die Beschäftigung insgesamt.
Marxismus in der Wettbewerbsmühle
Kann unter derartigen Bedingungen überhaupt noch von „freier“ Forschung und Lehre die Rede sein?
Von Freiheit wird nicht selten ideologisch geredet, aber man kann konkret sehen, wo die Einschränkungen zunehmen. Grundlegend ist, dass freie Zeit fehlt. In so gut wie allen Projektanträgen bin ich außerdem dadurch eingeschränkt, dass ich auf das Interesse oder Wohlwollen der Geldgeber, meistens aber vor allem auf das der Gutachtenden aus der Wissenschaft hinarbeiten muss. Das Ergebnis ist viel vorauseilender Gehorsam. Auch das System der Publikationen, die vorab im Peer Review von Kolleginnen und Kollegen beurteilt werden müssen, erzeugt viel Druck. Eingeschränkt bin ich schließlich auch in der Wahl meiner Forschungspartner, sie müssen ja Reputation haben. Und die Anwendungs- beziehungsweise „Impact“-Orientierung in den Sozialwissenschaften führt immer häufiger dazu, dass man haltlose politisch-ideologische Versprechen machen muss. Es wäre ziemlich leicht, ein großzügigeres, mehr von Forschungsneugier getriebenes System zu gestalten.
Sie selbst befassen sich ja unter anderem mit Marxismus. Erfreuen Sie sich dabei der uneingeschränkten Unterstützung durch die Unileitung?
In der Jenaer Soziologie haben viele marxistische und marxismusnahe Forschende vor mir dafür gesorgt, dass dieser Themenkreis und diese Sichtweise grundsätzlich akzeptiert werden. Gleichzeitig gibt es die Haltung: Wenn wir, also die kapitalismuskritische Seite, unsere Stellung halten wollen, müssen wir in den Wettbewerben des akademischen Kapitalismus dreimal so erfolgreich sein wie die anderen. Und dann kommen so seltsame Dinge zustande wie die Frage, ob wir nicht auch im Forschungsprofil „Light. Life. Liberty“ mitverantwortlich für Liberty sein müssen, um nicht den marktliberalen Ökonomen, der konservativen Politologie und anderen „Wettbewerbern“ das Feld zu überlassen.
Wie groß ist der Frust unter den Lehrenden? Oder sind Leute wie Sie, die diese Zustände auch aufgrund Ihrer Sozialisation hinterfragen, inzwischen „wegfluktuiert“?
Wie stark genau der Frust ist und wohin er hochschulpolitisch drängt, lässt sich schwer sagen. Orte, Fachkulturen und so weiter machen einen erheblichen Unterschied. Klar scheinen mir drei Dinge: Erstens gibt es tatsächlich große Frustration, sowohl unter den überlasteten Profs als auch unter den prekär-befristet Beschäftigten. Damit bin ich überhaupt nicht allein, alle die Arbeitssituation berührenden Gespräche der letzten Zeit gingen in diese Richtung. Zweitens gibt es aber auch eine starke Ideologie, die behauptet, dass man dem „Nachwuchs“ nicht zu viel Sicherheit geben darf, um den Wettbewerb aufrechtzuerhalten und das System nicht „zuzubetonieren“. Dieses Feiern planmäßig zerstörter Lebensläufe nimmt zu, je höher die Leute in der Hochschulhierarchie steigen – es ist also besonders in der Professorenschaft, bei Hochschulleitungen und in Ministerien verbreitet. Drittens hat sich bisher eben noch kein effektiver Druck dagegen formiert, auch wenn die Bereitschaft wohl wächst.
Nichts ist unmöglich
Ist die Arbeits- und Beschäftigungssituation Thema im Lehralltag? Nehmen also die Studierenden wahr, unter welchem Druck die Lehrenden stehen, wie sehr sie mitunter überlastet sind?
Die Studierenden nehmen schon etwas wahr, aber meistens unter ganz unpolitischen Vorzeichen. Ihnen geht es ja völlig zu Recht erst einmal darum, jemanden für die Hausarbeit, Abschlussarbeit, Prüfung, Beratung zu finden. Die typische Aussage ist, „Ich weiß, Sie haben sehr viel zu tun, aber …“. Viel seltener bis gar nicht höre ich dagegen Fragen wie: „Wann machen Sie eigentlich etwas gegen die für Sie und uns offensichtlich miese Situation?“
Sie waren Mitinitiator einer Online-Petition gegen die Fortsetzung der „Exzellenzinitiative zur Förderung von Spitzenforschung“, der sich im Frühjahr 2016 über 100 Erstunterzeichner aus dem Wissenschaftsbetrieb angeschlossen hatten. Was ist daraus geworden?
Wenig. Immerhin haben dann noch über 3.000 Leute unterschrieben, Studierende, Lehrende, Gewerkschafter, einige aus der Hochschulpolitik. Es gab aber die recht auffällige Verteilung, dass namhafte Forschende an Standorten, die auch nur eine kleine Chance im Wettbewerb hatten, so gut wie gar nicht vertreten waren. Vielleicht fanden sie alle unsere Argumente schlecht, vielleicht glauben sie alle an die Exzellenzstrategie. Aber da mindestens eine große repräsentative Umfrage ergeben hat, dass die Mehrheit der deutschen Profs diese Initiative für nicht nützlich hält, drängt sich eine andere Vermutung auf: Man will alles vermeiden, was den dringend nötigen, von den Unileitungen schon eingeplanten Geld- und Prestigeerfolg beim Exzellenzwettbewerb gefährden könnte.
Zum Abschluss Ihre Prognose: Was wird aus den Unis werden? Werden die Bedingungen irgendwann wieder besser und was spricht dafür? Oder wird alles noch schlimmer?
Unter den amtierenden Landesministerien und unter der Großen Koalition wird hier wie überall sonst alles bleiben wie bisher: notdürftige Zuschüsse, wettbewerbsförmige Verteilung des Geldes und tendenzielle Ausweitung des Wettbewerbsdrucks, höchstens kosmetisch ausgeglichene Prekarisierung des Nachwuchses, bleibende Unterbetreuung der Studierenden. Deutschland gilt im internationalen Vergleich als konservativer Wohlfahrtsstaat, im Bereich Hochschule ist das mit Händen zu greifen. Wenn ich mal mit hochschulpolitisch irgendwie mächtigen Leuten rede, finden sie größere Reformen unnötig oder aussichtslos. Das Einzige, was dagegen helfen könnte, wäre massiver Druck von Hochschulpersonal und Studierenden. Ich halte das aus den genannten Gründen für unwahrscheinlich, aber es ist überhaupt nicht unmöglich.

Tilman Reitz, Jahrgang 1974, ist Professor für Wissenssoziologie und Gesellschaftstheorie am Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Soziologie der Geistes- und Sozialwissenschaften, politische Philosophie und Ideologiekritik, Ästhetik und Kultursoziologie. Er war Mitinitiator einer Online-Petition gegen die Fortsetzung der „Exzellenzinitiative zur Förderung von Spitzenforschung“ (heute „Exzellenzstrategie“), der sich im Frühjahr 2016 über 100 Erstunterzeichner aus dem Wissenschaftsbetrieb angeschlossen hatten. Anfang April erschien von ihm und seiner Kollegin Tine Haubner im Beltz Juventa Verlag: „Marxismus und Soziologie: Klassenherrschaft, Ideologie und kapitalistische Krisendynamik“.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .