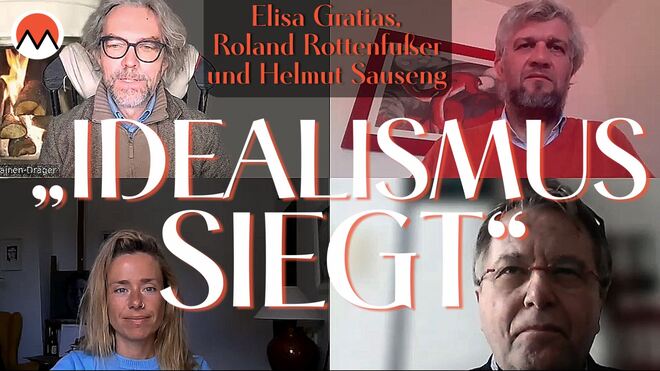Die Voraussetzung für Versöhnung ist nicht die Konservierung der Untragbarkeiten, sondern ihre Abschaffung. Die beginnt in der eigenen Lebenswirklichkeit. Die Protestbewegung beraubte sich ihrer Existenzgrundlage durch den Verrat an diesem Gedanken. Ihr Sinn ging verloren, als sie nach der Ermordung von Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer im Oktober 1977 die Untragbarkeiten ausblendete. Sie stimmte in die Trauer der Nation ein, reduzierte ihre große Idee auf ein Minimum und wechselte die Seiten.
Der Feind
Seit Mitte der 1950er-Jahre wurden von der Bundesrepublik ausländische Arbeitskräfte angeworben. Die Gastarbeiter sollten den Mangel an ungelernten Kräften in der Industrie decken. Es warteten körperlich schwere und teilweise gefährliche Tätigkeiten, Schmutz, Schweiß, die Monotonie der Fließbandarbeit, Schichtbetrieb und Akkordlohn. Die Aussicht auf ein Einkommen lockte Italiener, Spanier, Griechen, Türken, Portugiesen, Tunesier, Marokkaner und ab Ende der 1960er-Jahre Jugoslawen ins Wirtschaftswunderland (7). Es sind diese Milieus, die die Idee der Revolution erreichen muss, um die Etablierten aus der Ecke der Bequemlichkeit zu holen.
Die Installation des Niedriglohnsektors, ein Instrument, das den Wert menschlicher Arbeitskraft drückt, beinhaltet den Versuch, Arbeiter gegen Arbeiter auszuspielen. Noch heute wird dem Facharbeiter mit der Floskel seiner Systemrelevanz derartig Honig um den Bart geschmiert, dass der Eindruck entsteht, er sei tatsächlich wertvoller als eine ungelernte Kraft aus dem Ausland, die seinen Arbeitsplatz reinigt.
Dabei ist er im unternehmerischen Verständnis lediglich ein Kostenfaktor, der zum Beispiel Konzernbosse dazu bewegt, sich ständig mit der Frage zu beschäftigen, wie sie ihn durch Automatisierung aus dem Produktionsprozess entfernen oder noch mehr Leistung aus ihm herauspressen können, um den Profit zu steigern.
Während sich die Studentenrevolte in den USA nach der Ermordung von Martin Luther King langsam auflöste, und der anhaltende Krieg in Vietnam zeigte, dass die US-amerikanische Militärmaschine von innen durch die einfachen GIs zersetzt werden muss, erreichte der Protest in Europa 1968 seinen Höhepunkt. Die Utopie einer sozialistischen Demokratie wurde in Frankreich greifbar. Die Universitäten in Paris, Nantes und Bordeaux wurden besetzt und ihre Umgebung zum Schauplatz von Straßenschlachten. Die Arbeiter eigneten sich die Taktiken der Studenten an: Sie besetzten Betriebe, übernahmen die Kontrolle in Fabriken und setzten die Bosse vor die Tür. Das System wackelte, fiel aber nicht: Man verständigte sich und fand Kompromisse.
Die Erziehung
Die RAF wollte eine solche Lösung durch ihre Militanz ausklammern. Sie war an diesem Punkt also schon gescheitert, weil sie ihre Interessen über die der noch nicht politisch überzeugten Masse stellte, die sich mit bescheidenem Wohlstand und unbedeutenden Zugeständnissen schnell besänftigen lässt. Während ihre Aktionen bis 1975 die Aufmerksamkeit auf sich zogen, ging der Protestbewegung die Radikalität in der Sache verloren. Das System, das sie stürzen wollten, absorbierte ihre Energie. Es kaperte ihre Sprache, stahl ihre Ideen und machte aus ihren Vorbildern billige Massenware.
Die Gesichter von Mao Tse-tung, Karl Marx und Che Guevara zierten Anstecker, Poster und T-Shirts. Die Kritik verwandelte sich in Stil und die Opposition in ein politisches Angebot. Die raffinierte Macht des Kapitalismus fraß seine Gegner auf.
Der außerparlamentarische Widerstand erlahmte. Die Entführung von Hanns Martin Schleyer und die Reaktion des Regimes, auf die Forderungen der Entführer nicht einzugehen, zeigte, dass ein arbeitsteilig organisiertes Herrschaftssystem durch Gewalt gegen Menschen nicht vom Thron gestoßen werden kann. Seine Ermordung kam einer Kapitulation vor den eigenen Werten gleich: Rache statt Revolution des Bewusstseins. Die Protestler wendeten sich ab. Sie suchten Absolution im Lager des Feindes und passten sich an.
Die Kinder der Revolte wurden ihre eigenen Erzieher. Die Forderung der Studenten nach Selbstbestimmung verwandelte sich in die Verpflichtung zur Ordnung. Die Autonomie wurde zur Verfügbarkeit und ihre rebellische Kreativität zur marktkonformen Flexibilität. Sie transformierten sich zu Architekten einer neuen Ökonomie des Ichs — ein neoliberaler Humanismus, der das Individuum vergöttert und es gleichzeitig ökonomisch entleibt.
Die Tragik ist, dass der moralische Impuls jener Generation echt war. Ihre Leidenschaft, ihre Opferbereitschaft und ihre Sehnsucht nach Gerechtigkeit waren Ausdruck einer seltenen Klarheit. Doch der Feind, den sie bekämpften, verstand, was sie selbst nicht begriffen: Die wirksamste Herrschaft ist die, die sich als Freiheit drapiert und die Sklavenketten unsichtbar macht.
Heute trägt diese Tarnung viele Namen: Gendergerechtigkeit, Trend, Work-Life-Balance, Alternative. Die Dialektik der Aufklärung hat sich in die Dialektik des Marketings verkehrt. Serviert wird Oberflächlichkeit statt Sinn, Auswahl statt Erkenntnis, Endlosschleife statt Schlussstrich. Die Freiheit des Subjekts endet, wo es sich einredet, aus freien Stücken zu wählen, obwohl es gar keine Wahl hat — das System und seine Untragbarkeiten sind das Problem, das System hat eine Lösung, das System ist die finale Lösung. So behauptet sich der Zustand als Naturgesetz.
Das Karussell
In der Spätphase des Kapitalismus, der Diktatur des Profits, die sich in einen Finanzfeudalismus verwandelt, wird jede Alternative in die Ästhetik einer Kampagne eingewickelt. Selbst der Widerstand wird kuratiert. Die herrschaftsfreie Gesellschaft, einst der moralische Horizont einer ganzen Generation, ist zur Projektbeschreibung im universitären Diskurs verkommen. Der Klebstoff der Unbedingtheit, jene existentielle Ernsthaftigkeit, die kritisches Denken, individuelles Handeln und die Propaganda der Tat durch gelebte Moral miteinander verband, wurde aufgelöst. Der Mensch rebelliert heute mit Unterhaltungswert im digitalen Vakuum.
Protest ist Pose, Empörung ein monetarisierbarer Klick. Jeder Impuls, der eine Gesellschaft verändern könnte, wird in Echtzeit kanalisiert. In der gewünschten Dosierung rotiert er auf dem Karussell der Bekömmlichkeit, während jedes Verhältnis verschwimmt.
Völkermord in Gaza, Massaker im Sudan, die Vertreibung der Massai in Ostafrika im Namen des Wildtierschutzes: Was sind diese Grausamkeiten schon gegen die zersetzende Kraft eines Tweets, der das zarte Gemüt eines Staatsdieners triggert, oder den politischen Terror, den ein Farbbeutel verbreitet, der vorsätzlich gegen die Fassade einer Waffenfabrik geschleudert wird? Ja, das lässt die Nation erschaudern.
In dieser Unwirklichkeit lebt die Idee der Freiheit weiter. Nicht als politisches Programm, sondern als verbindliche Erkenntnis, dass die Rückkehr zur natürlichen Vernunft — verstanden als Einheit von Geist, Gefühl und Verantwortung — die Voraussetzung jeder menschlichen Erneuerung ist, um das Maß als Freiheit zu begreifen. Die Befreiung von der Maßlosigkeit durch die Abschaffung von Zins, Erbe, Werbung, Spekulation und so weiter ist keine Utopie. Die Ökonomie des Genug ist die Notwendigkeit, um die Eskalation zu verhindern, die die Sucht nach dem „Mehr als genug“ hervorbringt.
Die Preisfrage
In dieser Hinsicht eröffnet sich eine Lehre: Wenn eine Bewegung sich selbst als Fraktion und Avantgarde versteht, verliert sie schnell Anschluss an den unmittelbaren sozialen Raum — an die alltäglichen Kämpfe, an das Verhältnis zur breiten Bevölkerung. Und wenn moralischer Anspruch in militante Praxis übergeht, ohne eine tragfähige Theorie der Masse und der Gesellschaft zu entwickeln, dann bleibt das Risiko einer Entkoppelung real.
Die Rote Armee Fraktion ist damit zugleich ein Beispiel für die produktive Kraft revolutionärer Selbstbestimmung und für die strukturelle Schwäche einer Bewegung, die ihre eigene Autonomie zur Bedingung machte. Sie übersah, dass die Befreiung des Bewusstseins vom Sein, also die Abkehr des Subjekts von seiner freiwilligen materiellen Knechtschaft, der Revolution vorausgehen muss. In einer Gesellschaft der vollen Teller und der gefüllten Bäuche ist das ein unrealistisches Unterfangen.
Auf die Gegenwart angewendet, würde das bedeuten, dass eine alles veränderte Revolution nur mit denen zu realisieren ist, die nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen haben. Es sind die Ausgestoßenen, die Vertriebenen, die Flüchtlinge, die Heimatlosen — die menschliche Schlacke, die der Kapitalismus zurücklässt.
Rückblickend lässt sich unterstellen, dass die politischen Positionen der RAF visionär in ihrer Forderung nach Herrschaftsfreiheit und globaler Solidarität gewesen sind, aber zugleich problematisch in ihrer Elitenstruktur und der strategischen Verkürzung. Der Blick blieb auf die Aktion gerichtet, nicht auf gesellschaftliche Einbettung und Massenmobilisierung. Diese Herausforderung, die Suche nach einem realen Moment der Möglichkeit, ist zu lösen.
Die RAF hat das nicht geschafft. Sie übersah, dass die Befreiung des Menschen voraussetzt, dass er sich seiner Gefangenschaft und Ausbeutung bewusst ist und eine Sehnsucht nach Befreiung entwickelt, um der Unhaltbarkeit zu entkommen. Was in der Dritten Welt galt, war in den westlichen Zentren der Überfütterung und speziell in der BRD kein tragfähiger Ansatz. Das Wirtschaftswunder hatte die NS-Ideologie ersetzt und das Auto den Hitlergruß. Die reale Oberflächlichkeit des Materiellen zu verlieren, um die Substanz der Freiheit zu gewinnen — der Preis war für die Masse der Bevölkerung zu hoch.
Die Gegenwart
Und heute? Die Vorstellungen von Solidarität, Gleichheit und Würde sind zum Dekor verkommen. Der politische Mensch der Gegenwart ist aufgeklärt und gehorsam zugleich. Er feiert seine Individualität, während er standardisiert lebt und an einen Fortschritt glaubt, der seine Abhängigkeit perfektioniert. Insofern sind weder die moderne Linke noch Bewegungen wie Fridays for Future Erben der Studentenrevolte. Sie sind deren Karikatur, ausgepolstert mit einem Moralismus, der Veränderung will, aber keine Abkehr. Diese Scheinheiligkeit, die denen, die mehr als genug haben, erlaubt, weiterhin zu leben, als wäre alles in Ordnung, während der Rest darbt, als sei das die Erneuerung, die die Welt rettet, ist eine Simulation von Haltung.
Ist das ein Grund, warum die Gesellschaften zittern? Was ist mit ihnen los? Die relative Ruhe und Stabilität, das, was Herrschaft als Freiheit anpreist, ist vorbei. Die Angst vor der großen Veränderung geht um. Der Verlust an Kultur wird beklagt, als sei diese nicht einem ständigen Wandel unterworfen. Stillstand ist ihr Tod. Wer im Gestern verharrt, wacht im Morgen nicht mehr auf — oder findet sich im Reservat wieder.
So oder so: Dass die Abdankung des Realsozialismus 1989 der verzögerte Knockout für das ökonomische System war, das sich vom Industriekapitalismus zum Finanzimperialismus wandelte, ist eine Fußnote. Die digitale Revolution ist viel interessanter. Der sprunghafte technologische Fortschritt wirbelt die Arbeitswelt durcheinander. Roboter in den Fertigungshallen, Künstliche Intelligenz als Verwaltungsakteure in den Büros und der Mensch als nutzlose Produktivkraft auf der Straße — das ist lediglich eine Zwischenetappe. Die verordnete Medizin besteht aus Teilzeitarbeit und subventionierten Jobs, die keiner braucht, und einem Arbeitskräftemangel, der nicht existiert.
Beschäftigungstherapie und Serviceleistungen kennzeichnen eine neue Form der Volkswirtschaft, die Konsumenten voraussetzt, die als vereinzelte Funktionseinheiten die Fähigkeit verloren haben, die kleinste Schwierigkeit selbst zu lösen. Alles wird fremdgeregelt. Angefangen bei der kaputten Glühbirne, die ein Techniker wechselt, über den Essenslieferanten, der das Rühren im Kochtopf erspart, bis hin zur überstrapazierten Psyche, die ein Seelenklempner per Online-Fernbetreuung aufmöbelt.
Es kristallisiert sich eine Ökonomie der Pflegefälle heraus. Ein Zurück gibt es nicht. Die Entwicklung kennt nur eine Richtung: Vorwärts in die Sinnlosigkeit! Das ist los.
Was kann getan werden? Eine Option wurde genannt: das „Mehr als genug“ abschaffen und eine Ökonomie des Genug begründen. Um die Analyse der Methodik in die inhaltliche Erschöpfung zu treiben und den ermüdenden Kreislauf der Wiederholung literarisch zu schließen, der sich von der Baader-Meinhof-Gruppe bis in die Gegenwart fortsetzt, bietet sich die Realisierung eines neuen Buches an. Der Titel wäre gesetzt: „Was die RAF zu lehren versäumte“. Oder man fängt an, zu handeln und sich selbst und seine Lebensrealität zu verändern.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
(7) Hans Böckler Stiftung: Der lange Weg zur Anerkennung — Gewerkschaften und „Gastarbeiter“ in den 1950er/60er Jahren. Verfügbar auf, https://www.gewerkschaftsgeschichte.de/gewerkschaften-und-migration-59333-gewerkschaften-und-gastarbeiter-in-den-1950er-60er-jahren-59350.htm, abgerufen am 10.10.2025.
(8) rafinfo.de: Der Deutsche Herbst—Die Schleyer-Entführung. Verfügbar auf https://www.rafinfo.de/hist/kap10.php, abgerufen am 10.10.2025.
Siehe außerdem:
https://www.youtube.com/watch?v=SeIsyuoNfOg
https://youtu.be/SeIsyuoNfOg?si=jnj33AS-dHwO4NNc&t=340
https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/dutschke_rudi.html