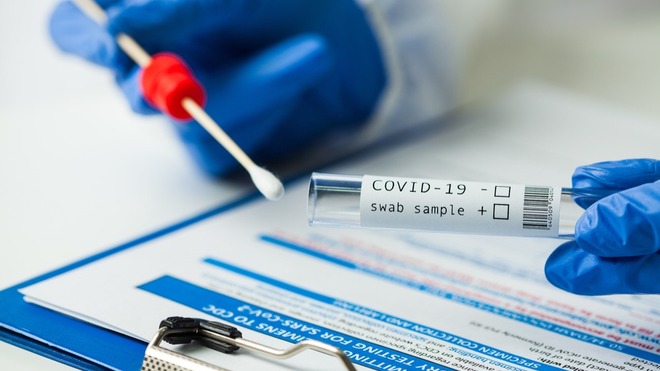Der mediale Abriss seiner Aussagen war wie gewohnt nicht sehr phantasievoll; man ordnete das Interview zusammengefasst wie folgt ein: Goldhändler spricht mit Pop-Titan – denn das Gespräch wurde für den Kanal von Kettner Edelmetalle geführt.
Nun kann man durchaus kritisieren, wenn Werbung und Geschäft mit journalistischer Arbeit vermischt werden – wie es auf jenem Kanal offenbar der Fall ist. Wesentlich weniger Bedenken zeigen diese Kritiker der Stunde allerdings, wenn irgendein an sich unpolitischer Influencer etwas zum Besten gibt, dessen Botschaft man gern weit verbreitet sehen möchte (AfD-Verbot, „Lass dich impfen“, „Stay with the Ukraine“ und ähnliche Botschaften) – dann schaut man darüber hinweg, dass dessen Aussage durchaus als Werbestrategie für sich und seine Werbekunden genutzt wird. Dennoch stimmt es natürlich: Kettner Edelmetalle dürfte Journalismus und Werbegeschäft gleichermaßen bedienen. Doch das ist auch nicht die Problematik, die man dem Interviewer Bohlens jetzt anhängen möchte. Etwas anderes soll damit ausgedrückt werden: Dass ein Goldhändler sich überhaupt politisch inszeniert, hält man für untragbar. Und Bohlen bekam in den Netzwerken denselben Vorwurf zu hören– zusammengefasst in folgender Frage: Wer ist er eigentlich, um so eine Meinung kundtun zu dürfen?
Über Demokratie spricht man nicht
Das waren gleichwohl sogar noch die freundlicheren Widerworte, die Dieter Bohlen erfuhr. Viele Kommentatoren bei X rückten Bohlen umgehend in die Nähe der Nationalsozialisten – ja, er würde sprechen wie jene, die 1946 in Nürnberg vor Gericht saßen. Der Musiker soll also tatsächlich sein wie Ernst Kaltenbrunner oder Julius Streicher, also wie zum Tode verurteilte Verbrecher gegen die Menschlichkeit? Oder waren die beiden genannten Nationalsozialisten auch nur unterhaltsame, manchmal leicht krawallige, aber an sich ganz brave und biedere Männer wie jener Pop-Titan? Wenn das so wäre, müsste man sich doch gar nicht so sehr fürchten vor der vermeintlichen Rückkehr der Nazis – oder wie muss man diese Gleichsetzung jetzt werten?
Es ist schon erstaunlich, wie jene Massenpsychose, die reflexhaft jeden kritischen Geist sofort zu „nazifizieren“ trachtet, alles abräumt, was vorher in der Erinnerungskultur von Bedeutung war. Der Nationalsozialismus galt als singulär in der deutschen Geschichte – nun kann offenbar jeder Musiker, der ein launiges Interview gibt, schon einer sein, der bei der SS anheuern könnte. Früher hätte man so ein Gebaren noch als Relativierung des Nationalsozialismus eingeordnet.
Aktuell ist zu vernehmen, dass der Deutsche Filmverband einigen Filmschaffenden von früher die Ehrenmedaille entziehen wird – unter anderem auch Heinz Rühmann. Die Betroffenen hatten eine NS-Vergangenheit und wären daher einer Auszeichnung nicht würdig. Kann ja sein – aber wem nützt es, Toten eine Ehrung zu nehmen? Das erinnert an posthume Exkommunizierungen der mittelalterlichen Kirche – damals buddelte man Häretiker (oder solche, die man dafür hielt) schon mal aus dem Grab und machte ihnen den Prozess. Gleichzeitig zeigen sich die Herrschaften aus dem Kulturbetrieb aber reichlich unsensibel in Bezug auf die Rüstungs- und Mobilisierungspolitik der Bundesregierung. Sollte uns die Erinnerungskultur nicht künftig vor solchen Entwicklungen wie jenen der Kriegsertüchtigung bewahren? Längst hat sich die Pflege dieser Erinnerung gewandelt, sie ist zur Popkultur geworden und der Nazi ist zu einer Stilikone des Bösen mutiert, die keinen Realitätsbezug mehr aufweist.
Vielleicht demnächst mehr zum Thema, wie der Nazi im Laufe der Zeiten wahrgenommen wurde und wie er sich in der Betrachtung gewandelt hat – jetzt aber zurück zu Bohlen. Dessen Untat: Er hat sich zur Situation geäußert. Leider nicht wohlwollend; das hätte man ihm gerne durchgehen lassen. Nein, er äußerte sich kritisch zur Politik. Und das ist offenbar nur Menschen vorbehalten, die eine gesonderte Qualifikation aufweisen. Wer sei er eigentlich, dass er glaube, sich auf so eine verwegene Art und Weise äußern zu dürfen? In diese Richtung lief die Empörung in den Netzwerken. Constanze Stelzenmüller, vormalige Journalistin und mittlerweile Direktorin des Center on the United States and Europe (CUSE), das Teil der Brookings Institution ist – dabei handelt es sich um eine transatlantische Nichtregierungsorganisation (NGO), die im Jahr 2024 unter anderem von der Bundesregierung mit zwei Millionen Dollar unterstützt wurde – verhöhnte Bohlens Aussagen wie folgt: „Bekannter Demokratieexperte zu den deutsch-russischen Beziehungen.“
Über Demokratie muss man sprechen
In Äußerungen wie jener von Stelzenmüller kommt die vollumfängliche Verachtung für demokratische Standards zur Geltung – und auch die Verachtung für jene, die in der Demokratie etwas wagen, was mittlerweile sogenannten Fachleuten vorbehalten ist: Über Politik und Gesellschaft zu sprechen. Hierzu haben sich jene, die fortwährend und gezielt von „unserer Demokratie“ schwafeln, eine Art Brandmauer gegen jene errichtet, die ihnen mit ihrer Meinung – die ihrer eigenen zuwiderläuft – lästig erscheinen und die sie gerne ausgemerzt sähen.
Solchen Leuten sprechen diese Kreise ab, sich zur Situation überhaupt adäquat äußern zu können. Tut es dann doch jemand, im aktuellen Fall eben jener Musiker und ehemaliger Castingshow-Juror, dann gibt man sich pikiert und fragt laut in die Runde: „Wer ist er? Was weiß er? Ja, was glaubt er denn, was er kann?“
Dann höhnt man: Wenn ein Edelmetallverkäufer Fragen stellt und ein Pop-Troubadour darauf antwortet, dann müsse das ja sehr fundiert sein. Diese Verachtung ist kein bedauernswerter Ausfall, auch kein Zufall, sondern hat System und wird strategisch repetiert und plakativ angewandt – Stichwort: Stigmatisierung.
Denn „unsere Demokratie“ hat sich ein Geflecht aus sogenannten Fachleuten und Experten geschaffen, die als Instanzen hochgejubelt werden, die den einzig wahrhaftigen Durchblick haben und denen man deshalb vertrauen soll. Dabei handelt es sich freilich um Köpfe und Nasen aus dem Sektor sogenannter Nichtregierungsorganisationen, die nur noch existieren können, weil sie von der Bundesregierung monetär gestützt und beatmet werden. Diese Einrichtungen betonen immer wieder, dass die Finanzierung der Zivilgesellschaft – so nennen sie sich selbst, um den Schein von Unabhängigkeit aufrechterhalten zu können – existenziell für die Demokratie ist. Würde man die Förderprogramme einstellen, fiele das Land in ein dunkles Mittelalter zurück und sei quasi nicht mehr zu retten. So positioniert sich dieser Sektor voller „Fachgrößen“, „Kenner“ und „Geisteskapazitäten“ als systemrelevant – denn nur dort fänden sich Leute, die das Zeug dazu hätten, die Demokratie richtig zu bewerten.
Mainstreamdeutschland wurde darauf eingeschworen, dass dieses Themenfeld der Demokratie etwas sein sollte, worüber nur Sachkenner zu sprechen hätten. Klar, man kann den anderen das Mitreden nicht verbieten – aber man kann sie lächerlich machen, sie ächten und ihnen die Zurechnungsfähigkeit absprechen.
Frisch geframt weiß dann der brave Bürger, was er von solchen Meinungsbeiträgern zu halten hat: Dieter Bohlen darf dann zwar mit Kettner Edelmetalle sprechen und seine Sicht auf die Lage darlegen, aber den Leuten ist klarzumachen, dass hier nur einer spricht, der nicht vorher in den Stand versetzt wurde, wirklich und wahrhaftig von der großen Sache der Demokratie zu sprechen – so wie all jene Gelehrten, die sich von Nichtregierungsorganisationen einen Teil des Geldes wehrloser Steuerzahler abzweigen lassen. Diese seien die wirklichen Eingeweihten, ja die Hohepriester des Demokratischen – nur sie wüssten, wie die Dinge zu betrachten seien. Die anderen stochern im Dunkeln, sind Stümper. Ihre Interpretation der systemischen Abläufe sind laienhaftes Geschwätz und nicht erhabene Analysen, wie man sie nur bei den Experten „unserer Demokratie“ finden kann.
Die Hohenpriester „unserer Demokratie“
Dieses Label „unserer Demokratie“ ist schonungslos ehrlich. Es macht mittels Possessivpronomen sichtbar, wem das System gehört oder gehören sollte: Mainstreamdeutschland – dem selbsterklärten hellen Teil des Landes, der sofort vom Sofa kriecht, wenn die nationale Einheitsfront der NGOs aufruft, auf den Straßen Plakate hochzuhalten. Die, die sich von solchen Organisationen aufrütteln lassen, gehört „deren Demokratie“ auch ein kleines Stück weit. Aber nur solange sie den Parolen und Losungen widerwortlos folgen. Tun sie das an einer Stelle nicht, gehen sie zum Beispiel in der Frage der no borders, der nationalstaatlichen Auflösung durch Grenzenlosigkeit, nicht in vollem Umfang mit, sind auch sie nicht mehr Teil „deren Demokratie“.
Dann kann es schnell passieren, dass sie zu Dunkeldeutschland gezählt werden: Zur AfD, diversen Leugnern, zum BSW, zu den Kriegsgegnern, den Ungeimpften, zu Dieter Bohlen, Dieter Nuhr, Dieter Hallervorden und anderen Leuten, die nicht Dieter heißen und sich anmaßen, etwas über Staat, Gesellschaft und Demokratie zum Besten zu geben, ohne dafür ausreichende Kenntnisse zu besitzen.
Die demokratische Grundidee wäre – wenn es sie tatsächlich irgendwo gäbe – so grandios simpel: Jeder Mensch hat eine Stimme und ist damit Teil des Souveräns. Dass Demokratie eine hochdiffizile Angelegenheit sein soll, die nur von Menschen verstanden und begangen werden kann, die sich irgendeine Expertise erworben haben sollen, ist völlig abwegig. Schlimmer noch: Es stellt den Versuch dar, die Grundidee, wonach Demokratie ein System für alle und jeden sein sollte, zu pervertieren und sie stattdessen zu einem Elitenprojekt zu erheben.
Das war Demokratie im Westen freilich immer: Die Eliten der vordemokratischen Zeit begriffen schnell, wie sie das System für sich nutzen konnten. Exemplarisch hat das Giuseppe Tomasi di Lampedusa in seinem Roman „Der Leopard“ dem alten Fürsten in den Mund gelegt: Der Aristokrat schaute gelassen auf das drohende Risorgimento, die Nationalverstaatlichung Italiens, das den alten Ständecharakter Siziliens durch eine Demokratie ersetzen sollte und meinte: „Es muss sich alles ändern, damit alles so bleiben kann, wie es ist.“ Die Eliten verinnerlichten diese Erkenntnis schnell, sie wurden oberflächlich zu Demokraten und machten weiter wie eh und je.
Heute aber gesellen sich von Steuergeldern und global investierenden Mäzenen fremdfinanzierte Organisationen in den Mittelpunkt des Geschehens und wollen dieses System abermals zu einem Elitenprojekt nach ihren Vorstellungen formen. Zu diesem Zweck haben sie sich selbst zu Fachleuten ernannt, die die Demokratie lesen und deuten können, wie einst nur Priester den Lauf der Sterne.
Diese „Expertise“ war es in fernen Zeiten, mit der die Religion und die Schaffung eines neuen Standes – der Priester – ihren Anfang nahmen. Eine Kaste von Interpretationsingenieuren prägte sich heraus, die Transzendenz bewerkstelligte und sich so einen bequemen Platz in der Gesellschaft sicherte. Die vermeintlichen Fachleute „unserer Demokratie“ ähneln diesen Sternendeutern von früher ungemein.
Natürlich konnte damals auch der am Pyramidenbau beteiligte Ägypter nachts zum Himmel blicken und sich seine Gedanken zum Sternenbild machen. Aber seine Beobachtungen galten als tapsige Laienversuche, die man milde belächeln oder eben rüde abkanzeln konnte. Die Fachleute aus dem Zivilgesellschaftsbusiness handhaben es ganz ähnlich. Sie streben die Exklusivität der Deutungshoheit an und erklären, dass nur sie die Demokratie – für sie: „unsere Demokratie“ – begreifen. Alle anderen sind Stümper und Scharlatane und sollen sich lieber am Pyramidenbau beteiligen.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .