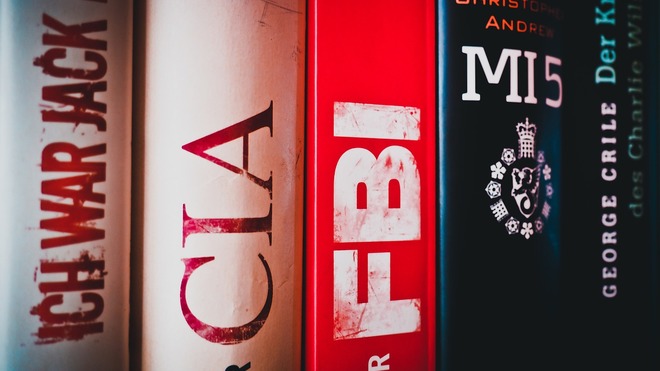Das im Exil in Stockholm zwischen 1934 und 1938 entstandene politische Gedicht des deutschen Dramatikers und Lyrikers Bertolt Brecht (1898 bis 1956) „An die Nachgeborenen“ bietet eine geeignete Grundlage, die heutige Zeit zu beschreiben. Brecht legte in diesem Gedicht ehrlich, erschütternd und mahnend Rechenschaft ab über das Leben im Nationalsozialismus der 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts. Er schrieb:
„Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten! (…)
Was sind das für Zeiten, wo
Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist,
Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt“ (1).
Zeitgenossen, die im Wohlstand leben, fern von schrecklichen Kriegsschauplätzen, werden Brechts Worte nicht auf das Heute übertragen können. Doch sehen wir uns die gegenwärtige Welt einmal an:
Die Wirtschaft wird weltweit mit horrenden Summen auf Kriegswirtschaft umgestellt, weil Russland und andere östliche Großmächte angeblich eine Bedrohung darstellen. Es herrschen Willkür und Gewalt. Russland ist seit jeher ein Dorn im Auge des kapitalistischen Systems. Doch die Völker sind für die Kriege nicht verantwortlich, die Natur des Menschen ist friedlich. Schuldig sind allein die herrschenden Schichten, die sich gegenseitig zu unterjochen versuchen. Die Machtgier derer, die innerhalb der Völker als Obrigkeit fungieren und durch ihre soziale Stellung vom Geist der Gewalt durchdrungen sind, führt immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen, in denen die Völker zugunsten ihrer Herren verbluten.
Die selbst ernannten „Führer der Welt“ führen täglich ein groteskes Polit-Schauspiel auf. Was am Tag zuvor versprochen oder angedroht wurde, wird am darauffolgenden Tag infrage gestellt oder widerrufen. Nur Kriege werden nicht infrage gestellt. Uneinigkeit in der Regierung, Streben nach Geltung oder reine Willkür sind mögliche Ursachen für dieses Verhalten.
Den Völkern wird aus verständlichen Gründen verschwiegen, dass die Regierungschefs weltweit kooperieren und hinter verschlossenen Türen geheime Pläne schmieden. In der Regel werden die armen Bürger (99 Prozent der Bevölkerung) durch diese geheimen Pläne ärmer und die reichen (1 Prozent) noch reicher.
Nach außen hin geben sich die führenden Politiker zerstritten, drohen mit der Zerstörung des anderen Landes oder einem Atomkrieg. Das Volk bekommt dadurch Angst vor einem dritten Weltkrieg und interessiert sich nicht für die geheimen Pläne.
Benötigt die Wirtschaft Bodenschätze, die im eigenen Land nicht vorhanden sind, werden die Länder, die diese besitzen, mit Kriegen überzogen und deren Bürger aus ihrer Heimat vertrieben, um leichter an das begehrte Gut heranzukommen. Die Welt schaut tatenlos zu.
Gefällt den Herrschenden der Präsident einer Regierung nicht, werden die Bürger in Befürworter und Gegner gespalten und gegeneinander aufgehetzt. Demokratisch abgehaltene Wahlen werden annulliert und wiederholt, wenn das Ergebnis ihren Vorstellungen nicht entspricht. Das destabilisiert die gesamte Gesellschaft und letztlich das Land.
Bereits im Jahr 1905 schrieb der russische Schriftsteller und Vertreter des gewaltfreien Widerstands Lew Nikolajewitsch Graf Tolstoi (1812 bis 1910) in den „Politischen Flugschriften“:
„Man könnte die Unterordnung eines ganzen Volkes unter wenige Leute noch rechtfertigen, wenn die Regierenden die besten Menschen wären; aber das ist nicht der Fall, war niemals der Fall und kann es nie sein. Es herrschen häufig die schlechtesten, unbedeutendsten, grausamsten, sittenlosesten und besonders die verlogensten Menschen. Und dass dem so ist, ist kein Zufall“ (2).
Viele Erwachsene reagieren auf die wirren Anweisungen dieser Politiker wie Kinder oder wie primitive Urmenschen: in Form eines magischen Autoritätsglaubens, kritiklos und umnebelt von Stimmungen und Glücksverheißungen.
Und das hat Folgen: Die Autoritätsgläubigkeit führt unweigerlich zur Autoritätshörigkeit, die in der Regel den Reflex eines absoluten geistigen Gehorsams und einer Verstandeslähmung auslöst. Vollsinnige Erwachsene können dann nicht mehr selbstständig denken und vernünftig urteilen. Sie glauben den dreisten Lügen von Politikern, Wissenschaftlern und Massenmedien und sagen nicht mehr Nein. Mit diesem Verhalten stärken sie jedoch das gesellschaftliche System.
Bertolt Brecht machte schon frühzeitig auf die Gefahr von Willkür und Gewalt im Nationalsozialismus aufmerksam und verfasste daraufhin die Parabel „Maßnahmen gegen die Gewalt“. Anhand dieser Parabel kann sich jeder erwachsene Bürger mit der Thematik auseinandersetzen und durch selbstständiges Denken zur Erkenntnis sinnvollen Handelns kommen (3). Die Verstandeslähmung durch Angst müsste nicht sein. Noch immer in der Geschichte der Menschheit mussten sich die Bürger eines Volkes Tyrannen aller Couleur beherzt entgegenstellen und gegen sie rebellieren, um die ihnen zustehende Freiheit zu erkämpfen und sich nicht unterjochen zu lassen.
Aus diesem Grund kommt abschließend Albert Camus zu Wort, ein Repräsentant des französischen Existenzialismus atheistischer Prägung. Er gibt in seinen libertären Schriften Antworten auf die Frage, was tun in finsteren Zeiten, wenn die Politik den Bürgern Angst macht, sie aber nicht verzweifeln sollen. Seine Gedanken haben noch heute Bestand, da sich die Probleme der Welt nicht grundsätzlich geändert haben.
„Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!“
Brechts im Juni 1939 veröffentlichtes Gedicht „An die Nachgeborenen“ in Auszügen:
„Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!
Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn
Deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende
Hat die furchtbare Nachricht
Nur noch nicht empfangen.
Was sind das für Zeiten, wo
Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist,
Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!
Man sagt mir: los und trink du! Sei froh, dass du hast!
Aber wie kann ich essen und trinken, wenn
Ich dem Hungernden entreiße, was ich esse, und
Mein Glas Wasser einem Verdurstenden fehlt?
Und doch esse und trinke ich.
Ich wäre gerne auch weise.
In den alten Büchern steht, was weise ist:
Sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit ohne Furcht verbringen,
Auch ohne Gewalt auskommen,
Böses mit Gutem vergelten,
Seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen,
Gilt für weise.
Alles das kann ich nicht:
Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten! (…).
Ihr aber, wenn es so weit sein wird,
Dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist
Gedenkt unserer
Mit Nachsicht“ (4).
Maßnahmen gegen die Gewalt
Bei der Parabel „Maßnahmen gegen die Gewalt“ von Bertolt Brecht springen dem wachen Bürger Parallelen zur weltpolitischen Situation der Gegenwart sofort ins Auge. Auch heute weichen wir vor der Gewalt verordneter illegaler Maßnahmen der Regierungen zurück und sagen nicht Nein. Wir beginnen, uns mit der heraufziehenden Tyrannei zu arrangieren.
Werden wir uns weiterhin der staatlichen Gewalt unterziehen, weil wir wie Herr Keuner in Brechts Gleichnis („Geschichten vom Herrn Keuner“) „kein Rückgrat zum Zerschlagen“ haben? Und werden wir dem Agenten einer fremden Macht deshalb jahrelang gehorchen und ihm dienen, weil wir auf den richtigen Zeitpunkt warten, um Nein zu sagen wie Herr Egge? Anhand der Parabel kann sich jeder erwachsene Bürger mit der Thematik auseinandersetzen und durch eigenständiges Denken zur Erkenntnis sinnvollen Handelns kommen.
Brecht beschreibt in seiner auf einem Vergleich beruhenden Kurzgeschichte, wie die beiden Hauptfiguren, Herr Keuner und Herr Egge, auf ihre Weise auf staatliche Gewalt reagieren. Herr Keuner, der Denkende, rechtfertigt seine unterwürfige Reaktion auf die Gewalt gegenüber seinen Schülern mit den Worten: „Ich habe kein Rückgrat zum Zerschlagen. Gerade ich muss länger leben als die Gewalt.“
Anschließend belehrt Herr Keuner seine Schüler mittels einer Geschichte aus der Zeit der Illegalität: Eines Tages tritt ein Agent der neuen Herrscher der Stadt ungefragt in das Haus und in das Leben von Herrn Egge. Diesem fremden Agenten gehorcht und dient Herr Egge, der gelernt hatte, Nein zu sagen, sieben Jahre lang, spricht aber kein einziges Wort mit ihm. Erst nach dessen Tod atmet er auf und antwortet auf die vor sieben Jahren gestellte Frage des Agenten „Wirst du mir dienen?“ mit einem „Nein!“ (5).
Möglicherweise ist es das kleinere Übel, sich dem Schicksal zu fügen, keinen offenen Widerstand zu leisten und seine Meinung nicht offen zu sagen, wenn man erkannt hat, dass man im Moment nicht die Macht hat, etwas gegen die Gewalt zu tun.
Vielleicht ist es klüger, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, um Nein zu sagen. Es ist eine Illusion zu glauben, man könne gegen den Staat aufkommen. Der Staat ist gut gerüstet.
Ich revoltiere, also sind wir!
Der Mensch vermag sich nur dann zu seiner vollen Größe aufzurichten, wenn er sich den Anordnungen der Macht nicht beugt, sondern sich mit gesunder Empörung zur Wehr setzt.
Albert Camus gibt in seinen libertären Schriften Antworten auf die Frage, was tun in finsteren Zeiten. Die libertäre Zeitschrift Reconstruir fragte Camus:
„Geben Ihnen die Gipfeltreffen zwischen den Vertretern der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion irgendeine Hoffnung, was die Möglichkeit der Überwindung des Kalten Krieges und der Teilung der Welt in zwei antagonistisch sich gegenüberstehende Blöcke betrifft?
Camus‘ Antwort:
„Nein. Die Macht macht denjenigen verrückt, der sie innehat“ (6).
Die letzte Frage der Zeitschrift in diesem Interview lautete:
„Wie sehen Sie die Zukunft der Menschheit? Was müsste man tun, um zu einer Welt zu kommen, die weniger von der Notwendigkeit unterdrückt und freier wäre?“
Darauf antwortet Camus mit der „Botschaft“, die die nachfolgende Generation inspirieren sollte:
„Geben, wenn man kann. Und nicht hassen, wenn das möglich ist“ (7).
Für Camus war nichts unentschuldbarer als der Krieg und der Aufruf zum Völkerhass. Deshalb wollte er auf den Frieden hoffen und für ihn kämpfen. Wörtlich sagte er:
„Ich setze auf den Frieden. Darin liegt mein ganz eigener Optimismus. Aber man muss für ihn etwas tun, und das wird schwer. Darin liegt mein Pessimismus“ (8).
Camus‘ Denken kulminierte in der Auffassung von Revolte im Sinne eines unablässigen Kampfes um ein höheres Maß an Freiheit: „Ich revoltiere, also bin ich!“ Die Auflehnung im Namen von Menschenrecht und Menschwürde kann aber nie für den Einzelnen allein geschehen. Sie geschieht für alle Menschen: Ich empöre mich, also sind wir!
Für den freien Menschen gibt es kein höheres Ziel als die Verwirklichung der Freiheit aller. Gerade das ist die eigentliche Hingabe an die Menschen der Zukunft.
Die wahre Großzügigkeit gegenüber der Zukunft besteht darin, alles der Gegenwart zu geben.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
(1) https://www.deutschelyrik.de/an-die-nachgebornen.html
(2)Lew Nikolajewitsch Tolstoi, Rede gegen den Krieg, Politische Flugschriften, herausgegeben von Peter Urban, Insel Taschenbuch, 703; Eines ist not (Über die Staatsmacht), Seite 74.
(3) Dr. Rudolf Hänsel (2021), Bertolt Brecht: „Maßnahmen gegen die Gewalt“. Politische Parabel aus der Zeit der Illegalität. In: „Global Research“, 2. November 2021.
(4) https://www.deutschelyrik.de/an-die-nachgebornen.html
(5) Dr. Rudolf Hänsel (2021), Bertolt Brecht: „Maßnahmen gegen die Gewalt“. Politische Parabel aus der Zeit der Illegalität. In: „Global Research, 2. November 2021.
(6) Lou Marin (Herausgeber) (2013), Albert Camus — Libertäre Schriften (1948-1960), Seiten 363 folgende.
(7)Am angegebenen Ort, Seite 364.
(8) Am angegebenen Ort, Seite 82.