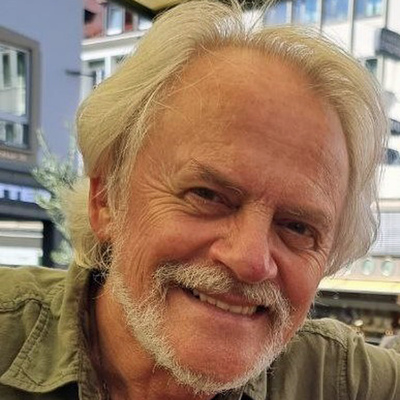Vor ein paar Tagen hatte ich mich in einem Essay dazu bekannt, nicht für „mein Land“ kämpfen zu wollen. Die einzelnen Argumente, mit denen ich meine Position erläuterte, lassen sich online hier nachlesen. Natürlich hatte ich mit Kritik an dieser politisch inkorrekten Haltung gerechnet, doch nicht ausgerechnet von einem Freund, der sein halbes Leben mit christlichem Gedankengut verbracht und darüber hinaus sich viel mit Zen-Philosophie beschäftigt hat. Eine der wichtigsten Meditationen im Buddhismus ist die Metta-Meditation beziehungsweise die Meditation der liebenden Güte, bei der man an alle fühlenden Wesen liebevolle Gedanken aussendet — auch der Feind gehört zu den „fühlenden Wesen“.
Selbst jetzt, da ich mich G.s Einwänden nähere, bin ich noch eigenartig erregt und befremdet von seinem Vorwurf, ich würde es mir mit meiner pazifistischen Haltung zu leicht machen — was ich auch von mir Nahestehenden zu hören bekomme. Ich will seine Fragen hier erst einmal der Reihe nach aufzählen, denn es liegen ihnen Überlegungen zugrunde, die von vielen, vielleicht sogar von den meisten meiner Landsleute, geteilt werden. Also:
- Wie hättest du dich als Mann in der Ukraine entschieden? Hättest du dir dort auch die etwas spitzfindige Frage gestellt, was denn „dein Land“ sei?
- Wie hättest du dich als Mann in Russland entschieden, als die von Hitler kommandierten deutschen (!) Soldaten kurz vor Moskau standen, nachdem sie im Land bereits furchtbar gewütet hatten? Und hättest du mitgekämpft, um die Überlebenden in Auschwitz zu befreien?
- Wärest du in einer UN-kontrollierten Friedenstruppe (Blauhelme) zur Selbstverteidigung kampfbereit?
- Was hältst du von Rüstung zur Abschreckung gegen einen angriffsbereiten Aggressor, wie es zurzeit Putin ist oder Trump wäre?
Bevor ich mich den Einwänden im Einzelnen zuwende, stelle ich fest, dass alle vier Punkte an der Intention meines Essays nahtlos vorbeischießen (!), in etwa so, wie jemand im Rahmen einer Diskussion auf ein Reizwort reagiert, ohne den gedanklichen Kontext zu berücksichtigen.
Meine Absicht war, den Leser auf eine Reise mitzunehmen, bei der er mich bei meinen Gedanken über Sinn und Zweck kriegerischen Handelns begleiten kann, in das ich mich als Person freiwillig verwickeln lasse oder eben nicht. Damit spielen sich meine Gedanken sozusagen in einem supranationalen Raum ab, wo es einerseits um die Frage eines rein persönlichen Ja oder Nein geht, andererseits um die philosophischen Grundlagen kriegerischen Handelns überhaupt.
Da in modernen Zeiten nicht mehr Stämme oder Clans gegeneinander Krieg führen, sondern Staaten, muss ich zwangläufig auch — quasi von außen — über den Staat und seine Funktion nachdenken.
G. findet das „spitzfindig“.
Nun also zu G.s Frage Nummer eins, der aus meiner Sicht am einfachsten zu beantwortenden Frage: Als Mann in der Ukraine hätte ich mich ebenso wenig wie in jeder anderen Nation mit dem Konstrukt „mein Land“ identifiziert. Also hätte ich schnellstmöglich das Land verlassen (wie so viele ukrainischen Männer). Hätte man mir das verboten — warum musste der ukrainische Staat zu dieser Zwangsmaßnahme greifen? —, dann wäre ich lieber ins Gefängnis gegangen, als mich an der Front verheizen zu lassen. Mein Leben ist mir nun mal mehr wert als das Gedankenkonstrukt „nationale Ehre“ oder das soziale Ideenkonstrukt „Identität“, die mir im Laufe meiner Sozialisation eingebläut wurden.
Im Fall des Falles hätte sich für mich die Frage so gestellt: Lieber ein lebendiger russischer Staatsbürger oder ein toter Ukrainer?
Die Frage Nummer zwei ist heikler. Hätte ich als russischer Soldat den Zweiten Weltkrieg für einen Krieg wie jeden anderen gehalten, hätte ich mich wie bei Frage Nummer eins verhalten und mich in die Mongolei abgesetzt. Hätte ich hingegen gewusst, dass die angreifenden Nazis sich nicht „nur“ mein Territorium und seine Ressourcen einverleiben wollen — also die üblichen Kriegsziele —, sondern dass sie einen Vernichtungskrieg gegen die Menschen meines Landes führen mit dem Ziel, möglichst viele meiner Landsleute umzubringen (wie tatsächlich geschehen), dann hätte vermutlich auch ich zur Waffe gegriffen.
Dann wäre es nämlich nicht um die Verteidigung einer abstrakten Staatsidee gegangen, sondern um die Verteidigung von Leib und Leben, das ohne diese Verteidigung verwirkt gewesen wäre.
Die Zusatzfrage, ob ich mitgekämpft hätte, um die Überlebenden in Auschwitz zu befreien, ist in diesem Zusammenhang irrelevant, da meines Wissens (so gut wie) kein Russe aus diesem Grund gekämpft hat. Antisemitismus war in Russland zwar keine offizielle Richtlinie, aber in der Praxis gang und gäbe.
Die dritte Frage verstehe ich nicht. Die Blauhelme sind ja nicht zum Kämpfen da, sondern in aller Regel zur Verhinderung von Kämpfen. Wenn das denn gelänge — wie im Suezkonflikt, auf Zypern oder in Namibia —, könnte ich mir vorstellen, den Blauhelmen anzugehören. Dann hätte ich Leib und Leben von Menschen geschützt und nicht die Existenz eines Staates. Schrecklich fände ich hingegen, bei Massakern wie in Ruanda oder Srebrenica zuschauen zu müssen. Wäre ich in so einer Truppe, was unwahrscheinlich ist, und würde angegriffen werden, würde ich mich natürlich verteidigen. Was aber hier ebenfalls belanglos ist, weil ich in meinem Essay den persönlichen Selbstverteidigungsfall ausdrücklich gutgeheißen hatte.
Einfacher wird es wieder bei der Frage vier. Bei den Rüstungsspiralen während des Kalten Krieges konnte man zuschauen, wie die jeweilige Aufrüstung die nächste Aufrüstung der Gegenseite bewirkte. So führte die Gründung der NATO zur Gründung des Warschauer Paktes, woraufhin eifrig hin und her gerüstet wurde. Mit anderen Worten: Ich halte Rüstung zur Abschreckung gegen einen angriffsbereiten Aggressor für ein untaugliches Mittel.
Rüstung treibt eine Volkswirtschaft nur in die offenen Hände der Rüstungsindustrie und in generationenlange Verschuldung, wie uns in Deutschland soeben vorexerziert wird.
Wirkungsvoller und weitaus günstiger kommen meines Erachtens ein Land Investitionen in diplomatische Initiativen sowie reine Defensivkräfte, kombiniert mit einer strategisch gut organisierten sozialen Verteidigung mit grundsätzlicher Kooperationsverweigerung mit einem eventuellen Aggressor. Die interessanten Möglichkeiten der sozialen Verteidigung und zivilen Konfliktbearbeitung bleiben aber so lange unerforscht, solange man dem Glaubenssatz anhaftet, nur mit immer mehr Waffen für Frieden sorgen zu können.
Interessanterweise ging G. auf keinen meiner Punkte ein. Warum er das nicht getan hat, ist mir unerklärlich. Zuletzt noch dies: Wenn ich zur Geburt „automatisch“ getauft werde, dann ist es nur gut und billig, wenn ich später der Religion den Rücken kehren kann. Schließlich habe ich sie mir ja nicht ausgesucht. Auf keinen Fall kann man aber aus meiner Zwangstaufe den Schluss ziehen, ich müsse in den darauffolgenden Jahrzehnten Christ sein. Warum muss man aber eine Zwangsstaatsbürgerschaft ein Leben lang aufrechterhalten? Und wenn schon: Wieso muss ich mich einem Staat verpflichtet fühlen, für den ich mich nie entschieden habe?
Der Gehalt des Wortes „angriffsbereit“ müsste, unabhängig von allem anderen, sorgsam geprüft werden: Handelt es sich um eine Vermutung, eine Schlussfolgerung oder eine faktisch unterlegte Gewissheit? Auf welchen Annahmen beruht sie? Was hat zu der vermuteten Angriffsbereitschaft geführt? Und welche friedlichen, ökonomischen und/oder diplomatischen Maßnahmen lassen sich treffen, diese zu schwächen oder gar auszuhebeln?

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .