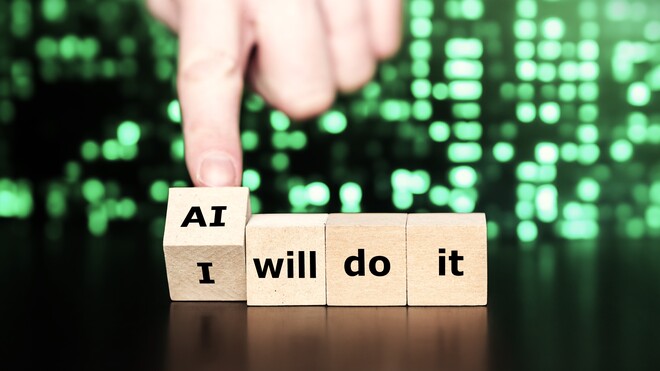Ich bin nicht grundsätzlich gegen „Links“ — im Gegenteil hat mich soziales, ökologisches und weltoffenes Gedankengut wesentlich geprägt. Ich will die Frage, ob Weisheit und Güte mehr auf der linken oder auf der rechten Seite des politischen Spektrums zuhause sind, an dieser Stelle auch überhaupt nicht erörtern. Es geht mir allein um die Frage, ob politischer Einfluss in Deutschland heute überhaupt noch mit fairen und demokratischen Mitteln erreicht werden kann. Dies ist nicht mehr so, wenn folgender Fall eintritt: Wählt die Mehrheit „Links“, regiert Links; wählt die Mehrheit „Rechts“, regiert ebenfalls Links.
Eine „schwarz-blaue“ Republik wäre sicher nicht das, wonach ich mich zutiefst sehne. Nur: Unter bestimmten Umständen würden demokratische Prinzipien verlangen, dass wir genau von so einer Konstellation regiert werden.
Nicht entscheidend wären dabei die Gefühle der Minderheitenvertreter. Der demokratische Wettkampf kennt Gewinner und Verlierer. Letztere müssen ihre Niederlage akzeptieren und auf ihre nächste Chance warten.
Es ist sicher legitim, dass die stärkste Partei — derzeit also die Union — entscheidet, keine Koalition mit anderen „bürgerlichen“ Kräften einzugehen. Sie kann entscheiden, die AfD als „nicht satisfaktionsfähig“ einzustufen und die Hand über den großen Graben hinweg ins linke Lager auszustrecken, also mit SPD oder Grünen zu regieren, anstatt mit „Blau“. Normalerweise wären die „linken“ Kräfte dann aber verpflichtet, sich zumindest teilweise mit den „konservativen“ zu arrangieren. Der erkennbare Mehrheitswille in der Bevölkerung — wie etwa eine Zustrom-Begrenzung in der Flüchtlingsfrage, ein Abschleifen extremer Erscheinungsformen der „Wokeness“ oder eine Fokussierung auf die Interessen der Leistungsträger statt der Leistungsempfänger — müsste sich im Programm der Regierung wiederfinden.
Da Union und SPD zahlenmäßig im Verhältnis von 22 Prozent zu 16 Prozent zueinander stehen, müsste sich die Waage noch stärker zugunsten der Union neigen — nicht, weil ich das so will, sondern weil die Mehrheit das so entschieden hat. Man nennt das auch Demokratie. Der Blick auf die Oppositionsparteien zeigt auch nichts anderes als ein Übergewicht der im weiteren Sinn „rechten“ Kräfte. Es stehen 21 Prozent AfD gegen 20 Prozent Grüne und Linke bei der letzten Bundestagswahl.
Triumphierende Wahlverlierer
Die Lage ist insofern für SPD, Grüne und Linke unkomfortabel. Würde alles korrekt zugehen, so würden deren politische Vorstellungen dauerhaft von solchen des „rechten Lagers“ überstimmt und damit marginalisiert werden. Nun bedient sich „Links“ aber allerlei Tricks, um seine Niederlage in einen Sieg umzumünzen und — eigentlich demokratiewidrig — doch die Richtlinien der deutschen Politik maßgeblich zu bestimmen.
Gerade SPD-Chef Lars Klingbeil wirkt dabei, als könne er vor Kraft kaum noch laufen — die ideale Verkörperung jener Zeile der Popgruppe ABBA: „I feel that I win, when I lose.“
Wie machen Klingbeil & Co das?
- Durch Zurschaustellen eines nicht durch tatsächliche Qualitäten oder politische Erfolge begründeten Selbstbewusstseins. Man kann auch sagen: durch Chuzpe — Frechheit.
- Durch die Erpressung des Koalitionspartners: „Wenn du mir nicht zu Willen bist, gehen wir raus aus der Koalition. Dann bleiben dir nur noch die Grünen, und dann wird es noch schwieriger.“
- Durch eine funktionierende „Brandmauer“, die die Union von der Machtalternative „Schwarz-Blau“ dauerhaft abschneidet. Die Tabuisierung jeder Annäherung an die AfD hat Formen angenommen, die faktisch bewirken, dass die Unionsparteien wie angekettet an das linke Lager wirken. Das umgekehrte Erpressungspotenzial („Wenn du mir nicht entgegenkommst, versuchen wir es eben mit einer Koalition Merz-Weidel“) haben die „Christdemokraten“ freiwillig aus der Hand gegeben.
- Gestützt wird diese Tabuisierung auch durch die unausgesprochene Drohung mit der Aktivierung der linken „Zivilgesellschaft“. Bei Zuwiderhandlung drohen mindestens Massendemonstrationen, bei denen eine gut organisierte Linke gegenüber der schlecht organisierten Rechten im Vorteil wäre. Im Extremfall kämen auch Nötigung, die Besetzung von Sälen, Beschimpfung und Diffamierung als „Nazis“ zum Einsatz. Alles, was ich hier aufgezählt habe, hat es schon gegeben, nachdem die Union am 30. Januar 2025 zusammen mit der AfD für einen Antrag zur Migrationspolitik, gestimmt hatte.
Mit diesen Methoden hat die SPD bisher einiges erreicht. Zum Beispiel sieben Ministerposten in der neuen Bundesregierung, die Weiterfinanzierung linker NGOs — auch solcher, von denen Friedrich Merz mit rüden Methoden bekämpft worden war — , das Vorschlagsrecht für zwei von drei neuen Richterposten für das Bundesverfassungsgericht, das Aushebeln der Schuldenbremse entgegen einem zentralen Wahlversprechen des heutigen Kanzlers sowie eine starke Aufweichung seiner vollmundigen Ankündigung von Grenzkontrollen ab Tag Eins seiner Kanzlerschaft. Das sind viele Erfolge für eine 16-Prozent-Splitterpartei, die in der Wählergunst seit der Wahl noch weiter abgesunken ist.
Der lästige Wählerwille
Eines aber konnte selbst ein äußerst geschicktes und selbstbewusstes Vorgehen des linken Lagers bislang nicht erreichen: die Existenz der AfD zu beenden. Noch immer verfügt sie mit ihren 20,8 Prozent der Abgeordneten im Bundestag über einige Möglichkeiten — wie etwa das Recht, Anfragen und Anträge einzubringen oder das Recht, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen. Das kann für die Regierungsparteien lästig sein und Abläufe verzögern, wird für sie jedoch in der Regel nicht wirklich gefährlich.
Der wichtigste Punkt, an dem die AfD speziell dem „linken“ Lager aus SPD, Grünen und Linken einen Strich durch die Rechnung macht, ist jedoch folgender: Sie verhindert allein durch ihre Existenz die Bildung einer rot-rot-grünen Koalition. Diese würde derzeit 36 Prozent der Abgeordneten auf sich vereinen, im Fall eines Ausscheidens der AfD jedoch weit mehr als 50 Prozent erreichen und könnte somit auf Dauer die Regierung stellen. Die Union mit derzeit 22 Prozent könnte bis auf weiteres nicht dagegen ankommen. Diese Hindernisse wären mit einem Mal beseitigt, wenn es die AfD nicht mehr geben würde. Konkret: wenn man sie verbieten könnte.
Einem solchen Verbot stehen bis jetzt weder mangelnder „guter Wille“ seitens der Altparteien noch übermäßiger Respekt vor dem Wählerwillen im Weg — sondern einzig und allein das Bundesverfassungsgericht.
Immer wieder hört man mit Blick auf einen Verbotsantrag gegen die AfD: „Das würde beim Bundesverfassungsgericht nicht durchkommen.“. Speziell als das Gutachten des Verfassungsschutzes öffentlich wurde, in dem ein „Worst of“ an Äußerungen der AfD aufgelistet worden war, wurde deutlich: die Vorwürfe waren eher „dünn“. Sie würden vermutlich nicht ausreichen, um ein AfD-Verbot beim Bundesverfassungsgericht durchzusetzen.
Dienstbare „Kontrolleure“
Ein wichtiger Punkt für ein AfD-Verbot wäre ja der so genannte ethnisch-abstammungsmäßige Volksbegriff, den die Partei favorisiert. Hierzu sagte ausgerechnet der Ehemann der ehemaligen Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht Frauke Brosius‑Gersdorf, der Staatsrechtler Hubertus Gersdorf, dieser sei nicht grundgesetzwidrig. „Für einen Verstoß gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, konkret gegen die Menschenwürde-Garantie, genügt der Vorwurf des ‚ethnisch-abstammungsmäßigen Volksbegriffs‘ nicht“, sagte Gersdorf gegenüber der Berliner Zeitung. Staatsangehörigkeit an die Abstammung zu knüpfen sei ein Prinzip, das in Deutschland bis 2000 gegolten habe. Es sei somit „ein weltweit anerkanntes, zulässiges Kriterium für das Staatsangehörigkeitsrecht“.
Was auch immer man von den verschiedenen Varianten des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts oder allgemein von der Partei AfD halten mag — es erscheint unwahrscheinlich, dass man sie durch ein Verbot grundgesetzkonform „loswerden“ könnte, es sei denn, die bisherige mehrheitliche Rechtsauffassung würde sich auf unerklärliche Weise drastisch ändern.
Wenn man von der These ausgeht, dass das bisher in Deutschland dominierende Parteien-Oligopol seine Herrschaft zu verewigen versucht, dann ist ein Bundesverfassungsgericht, das sich gegen das Verbot einer Konkurrenzpartei sperrt, aus deren Perspektive ein Problem — allerdings ein lösbares.
Gelingt es, das Gericht personell zu erneuern, indem man „eigene“ Leute einschleust, so könnte sich das Problem über kurz oder lang in Luft auflösen. Grundgesetz-Puristen würden zwar eifrig in den alternativen Medien nörgeln — die Fakten aber würden von den Hauptparteien und „ihrem“ Bundesverfassungsgericht geschaffen. Die Parteien würden mit immer neuen Vorstößen den Abbau von Grundrechten vorantreiben, während das Gericht zu allem stets zustimmend nickt und in seriös klingender Juristensprache versichert, dass das Grundgesetz damit in keiner Weise verletzt sei.
Demokratie auf dünnem Eis
Und genau hier kam Frauke Brosius-Gersdorf ins Spiel. Vielfach wurde argumentiert, ihr Fall werde von „rechts“ oder auch von „links“ zu sehr hochgespielt. Ich bin nicht dieser Ansicht. In früheren Zeiten, als das Vertrauen in die Institutionen noch weitgehend intakt war, hat sich kaum jemand um die Zusammensetzung des höchsten deutschen Gerichts Gedanken gemacht. Ich meine aber: Es wird eher noch zu wenig als zu viel über diese Dame nachgedacht. Und ebenso über Ann-Katrin Kaufhold und die anderen Richterinnen und Richter, die derzeit im Gericht sitzen beziehungsweise in den nächsten Jahren dort hineingelangen könnten.
Der Fall Brosius-Gersdorf machte schlagartig klar, an welch dünnem Faden unserer Demokratie, die wir für unangreifbar gehalten hatten, tatsächlich hängt.
Selbst wenn die Personalie Brosius-Gersdorf jetzt vom Tisch ist — das Bundesverfassungsgericht könnte auf Dauer ein Wackelkandidat in Sachen Grundrechtstreue bleiben, solange das Vorschlagsrecht für Richterposten bei einem Personenkreis liegt, der sich in den letzten Jahren mit Eifer dem Aushöhlen von Bürgerrechten gewidmet hat. Es ist als wäre die Demokratie eine Trapezkünstlerin, die unter der Zirkuskuppel gefährliche Kunststücke über einem äußerst löchrigen Auffangnetz vollführt. Der Sturz ins Bodenlose wäre dann nur noch eine Frage der Zeit.
Vielleicht hat vor allem die Debatte um Abtreibung uns vor einer Ära Brosius-Gersdorf am Bundesverfassungsgericht bewahrt. In dieser Frage nämlich war die Kandidatin bei Unions-Abgeordneten und in kirchlichen Kreisen umstritten, nicht so sehr wegen der Impfpflicht oder der AfD-Verbots-Debatte, bei denen auch viele in CDU und CSU mit ihr übereinstimmen. Die Abtreibungsfrage schien die öffentliche Diskussion zunächst eher auf einen Nebenschauplatz zu verlagern. Die meisten zugänglichen Informationen sprechen dafür, dass Frau Brosius-Gersdorf im Gegensatz zu den Vorwürfen von Beatrix von Stoch (AfD) nie Abtreibungen bis unmittelbar vor der Geburt befürwortet hat.
Ich verstehe ihre öffentlichen Äußerungen diesbezüglich eher so, dass sie ein „Drei-Stufen-Modell“ anbietet, das Abtreibung erleichtert oder erschwert, je nachdem, wie weit die Schwangerschaft fortgeschritten ist.
Die „abwägungsfähige“ Menschenwürde
Damit ist die Kandidatin aber noch nicht aus dem Schneider. Der wichtigste Satz, den man in diesem Zusammenhang anführen kann, stammt aus einem lesenswerten Artikel in „Communio“ den ich hier zitiere:
„Wenn man nämlich davon ausgehe, dass die Menschenwürde nicht abgewogen werden könne, [so Brosius-Gersdorf] wäre ein Schwangerschaftsabbruch unter keinen Umständen zulässig, auch nicht ein ‚Abbruch wegen medizinischer Indikation bei Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit der Frau‘. Die Lösung dieses Dilemmas könne nur lauten, ‚dass entweder die Menschenwürde doch abwägungsfähig ist oder für das ungeborene Leben nicht gilt.‘ Sie habe hier einen ‚notwendigen verfassungsdogmatischen Erörterungsbedarf‘ aufzeigen wollen.“
Viele Kritiker haben gerade den Satz Brosius-Gersdorfs über eine „abwägungsfähige Menschenwürde“ als gruselig empfunden. Wir erinnern uns, was das Grundgesetz ganz klar über die Menschenwürde sagt: Sie sei „unantastbar“. Dennoch kann man Brosius-Gersdorfs Ausführungen bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Denn es wäre schwierig, eine Abtreibung im ersten Schwangerschaftsmonat genauso einzustufen und zu bestrafen wie Mord. Trotz dieser Einschränkung stelle ich mir natürlich die Frage:
Braucht es jetzt dringend eine Debatte über den Geltungsbereich der Menschenwürde? Und braucht es diese Debatte von Seiten einer Person, die gleichzeitig für eine allgemeine Impfpflicht und für ein AfD-Verbot votiert hat?
Grundrechte: Kerzen im Wind des Zeitgeists
Brosius-Gersdorfs Position in der Impfpflicht-Debatte veranlasste die Berliner Zeitung berechtigterweise zu dem Vorwurf, sie habe sich „vom Zeitgeist treiben lassen“. Nämlich indem sie bei Markus Lanz sagte, „dass diese Stellungnahme zur Impfpflicht im Kontext der damaligen Zeit zu werten sei und sie heute vielleicht zu anderen Positionen käme“. Daraus könnte man schlussfolgern, die Kandidatin verfüge über kein Standing, wenn es darum gehe, am Kernbestand der Grundrechte unter allen Umständen festzuhalten. Wohin hätte sich eine Bundesverfassungsrichterin Brosius-Gersdorf noch gedreht, könnte man fragen, sollte sich der Zeitgeist weiter in eine freiheitsfeindliche Richtung entwickelt?
Spätestens seit dem Wendejahr 2020 zeigt sich ohnehin eine Tendenz zum Grundrechtsabbau. Im Zusammenhang mit den Vorkommnissen der Corona-Jahre und der Ära Faeser/Dobrindt lassen einige Äußerungen der Richter-Kandidatin bei mir sämtliche Alarmglocken läuten.
Ich fürchte, wir laufen auf eine Republik zu, in der eine politische, juristische und wissenschaftliche Elite sich selbst die Definitionshoheit über Grundrechte anmaßt — einschließlich des Rechts, diese „wegzudebattieren“.
Damit wäre der Naturrechtsbegriff ausgehebelt. Rechte wären nichts mehr, was Menschen „unveräußerlich“ zukommt, sondern vielmehr das, was Experten zu Recht erklären.
Menschliches Leben ohne Menschenwürde
Es gibt weitere fragwürdige Statements von Frauke Brosius-Gersdorf. Etwa die berühmt gewordene Aussage, wonach mit einem Verbot der AfD „natürlich nicht die Anhängerschaft beseitigt ist“. Vielleicht noch problematischer erscheint dieses Zitat: „Es gibt gute Gründe dafür, dass die Menschenwürdegarantie erst ab Geburt gilt.“ Oder, als absoluter Tiefpunkt: „Die Annahme, dass die Menschenwürde überall gelte, wo menschliches Leben existiert, ist ein biologistisch-naturalistischer Fehlschluss. Menschenwürde und Lebensschutz sind rechtlich entkoppelt“.
Welcher human empfindende Laie käme auf die Idee, dass die Menschenwürde nicht überall gelten könnte, wo menschliches Leben existiert?
Wie der Theologe Johannes Hartl in einem Video ausführt, wurde damit eine Grenze überschritten, die absolut gelten sollte. „Wenn es etwas gibt, über das wir nicht mehr diskutieren dürfen (…), dann ist es die Menschenwürde von jedem Menschen. Dieser Satz, dass die Menschenwürde nicht jedem menschlichen Leben zukommt, ist ein absolut negativer, böser Satz.“ Darauf könne man nur mit einem „Nein, so geht’s nicht!“ reagieren. Straffreiheit für Frauen in Gewissensnot und für ihre Ärzte ist das eine — diese Straffreiheit jedoch mit der Fiktion zu unterfüttern, ungeborenes Leben befände sich außerhalb des Gültigkeitsbereichs der Menschenwürde, hätte ein faktisch entkerntes Grundgesetz und eine dramatische Werteerosion in Deutschland zur Folge.
Tagespolitisch inspirierte Haltungs-Juristen
Es sind mir in der Summe einfach zu viele Fehler und missverständliche Äußerungen bei Frauke Brosius-Gersdorf, die auf ein fragwürdiges Verständnis von Würde und Freiheitsrechten hindeuten. Was soll ich von einer Kandidatin halten, die zwar in den mir bekannten Statements nicht behauptet hat, man könne den Fötus bis zur Geburt abtreiben, die jedoch sagt, dass diesem keine Menschenwürde zukomme? Da man die Menschenwürde des Fötus kaum auf andere Weise angreifen kann als durch Abtreibung — man muss das Ungeborene ja zum Beispiel nicht vor Demütigung und Beleidigungen schützen —, waren die Schlussfolgerungen der Brosius-Gersdorf-Kritiker naheliegend.
Ich sehne mich gewiss nicht danach, dass nach der „linken“ nun eine „rechtsextreme“ Verfassungsrichterin zum Zug käme. Vielmehr wünsche ich mir eine neutrale — wäre das nicht eine Idee? Überhaupt sollte sich jemand, der sich für so einen Job bewirbt, nicht derart weit mit Äußerungen zur Tagespolitik aus dem Fenster lehnen — schon gar nicht zu Grundrechtseinschränkungen.
Für mich stellt sich bei der ganzen „Affäre“ eher die Frage: Wenn Menschen wie Brosius-Gersdorf das Grundgesetz schützen wollen — wer schützt dann das Grundgesetz vor ihnen?
Macht-Oligopol weniger Parteien
Die linke Mitte hat aus dem Fall eine für die Zukunft „unserer“ Demokratie überlebenswichtige Grundsatzentscheidung gemacht. Käme Brosius-Gersdorf in einer nachgeholten Wahl nicht durch, so wäre dies ein fatales Signal dafür, was eine „rechte Hetzkampagne“ vermag. In Klammern steht dabei natürlich unausgesprochen die zentrale Denkfigur der heute dominierenden Parteien: Zu hassen und zu hetzen obliegt allein uns, denn wir sind die Guten. Die Güte unseres Zwecks heiligt selbst die perfidesten Mittel. Wenn dagegen eine andere politische Kraft eine emotionale Kampagne startet, schadet das nicht nur uns — es ist ein Anschlag auf die Demokratie als solche. Denn wir — also Union, SPD, Grüne und eventuell noch FDP und Linke — sind die Demokratie. Außerhalb dieser Umfriedung tut sich der Abgrund des Nicht-Demokratischen auf.
Diese Anmaßung sollten wir nicht einfach so hinnehmen, auch dann nicht, wenn wir keine AfD-Anhänger sind.
Warum konnte man sich bei der SPD nicht einfach mit der Ablehnung der Kandidatin im ersten Versuch zufriedengeben? Es ist ohnehin klar, dass an ihrer Stelle nun eine andere Person aufs Podest gehoben wird, auf die sich Union und SPD einigen können — sicherlich also wieder jemand, von dem die Herrschenden nichts zu befürchten hätten. Brosius-Gersdorf musste also über sehr spezielle Qualitäten verfügen, die nicht so leicht anderswo wiederzufinden sind. Die Altparteien erwecken deshalb den Eindruck: „Wenn die nicht Richterin wird, ist alles aus“. Aber womit genau wäre es dann vorbei?
Zyniker könnten nun sagen, das Bundesverfassungsgericht sei schon längst „gefallen“ und stehe ohnehin im Dienst der zunehmend freiheitsfeindlichen Agenda von Exekutive und Legislative, also der auf beiden Feldern vorherrschenden Parteien. Ist das Verhalten des Bundesverfassungsgerichts in der Corona-Krise überhaupt noch zu unterbieten?Jener dunkle Epoche, in der das oberste Gericht vielfach zu einer reinen Durchwink-Institution verkommen war? Wie im Fall des Richters Christian Dettmar, der eine Hausdurchsuchung erdulden musste und seine gesamte berufliche Existenz verloren hat, weil er eine richterliche Anordnung gegen Maskenzwang und Testpflicht an Schulen erließ — das Bundesverfassungsgericht segnete das harsche Vorgehen der unteren Gerichtsinstanzen ab.
Wie man sich der Konkurrenz entledigt
Das Kernthema zum Verständnis des politischen „Skandals“ um Frauke Brosius-Gersdorf ist meines Erachtens tatsächlich nicht die Abtreibungsfrage, sondern das geplante AfD-Verbot. Dabei interessieren mich nicht so sehr die Fragen „Wie finde ich persönlich die AfD?“ oder: „Wäre es für mich schlimm, wenn sie nicht mehr im Bundestag wäre?“ Die zentrale Frage ist für mich eher: „Was ist gut für die Demokratie und den Meinungspluralismus im Land? Was verlangen die demokratischen Spielregeln, die demokratische Fairness?“
Ich sehe Oppositionsverbote als eine Form des Foulspiels — eine Strategie, die eher zu Regimen passt, die ich nicht zu den demokratischen zählen würde.
Die AfD ist in den letzten Jahren auf derzeit in Umfragen zwischen 23 und 25 Prozent der Wählerstimmen angewachsen. Das ist besorgniserregend mit Blick auf ihr neoliberales Grundverständnis, völkische Tendenzen im rechten Flügel, die Zustimmung zur Wehrpflicht und zur gewalttätigen Politik der israelischen Regierung und weiteren Faktoren. Auf der anderen Seite sehe ich die Gefahr einer Schädigung der Demokratie unter dem Vorwand ihres „Schutzes“.
In den Tiefenschichten war der Verlauf der politischen Ereignisse für mich folgender: Die Parteien Union, SPD und Grüne sahen sich zunehmend einer starken Konkurrenz ausgesetzt. Diese bereitete ihnen nicht nur Sorgen wegen der politischen Folgen eines „Rechtsrucks“ für die Gesellschaft, sondern vor allem auch wegen ihrer eigenen Posten und Pfründe.
Als Reaktion auf den rasanten Bedeutungsverlust der Links-Mitte-Parteien hatten sie die Idee: „Es wäre doch schön, wenn dieser Konkurrent einfach aufhören würde zu existieren!“ Und siehe da — diejenigen, die von einem Verschwinden der AfD profitieren würden, haben zugleich unter bestimmten Umständen die Macht, dies selbst in die Wege zu leiten.
Richter nach dem Gusto der Exekutive
Diese Grundkonstellation ist potenziell gefährlich, weil sie zu Missbrauch einlädt. Nach meiner Auffassung sollten Verfassungsrichter keinesfalls von aktiven Politikern eingesetzt werden, zu deren Kontrolle sie bestellt sind. Es stellt ein grundlegendes Demokratieproblem dar, wenn dieselben Kräfte, welche Regierung, Bundestag und Bundesrat sowie die Parlamente und Regierungen der Länder dominieren, die in den Rundfunkräten und in allen Talkshows präsent sind, auch noch darüber zu entscheiden haben, wer Richter am Bundesverfassungsgericht wird. Das würde nur dann nicht zu Demokratieabbau führen, wenn wir naiverweise voraussetzten, dass bis in alle Ewigkeit nur sehr integre Persönlichkeiten dort sitzen. Faktisch kam es in den letzten Jahren aber zu einem Phänomen, das ich — in Abgrenzung zum Ideal der Gewaltenteilung — als Gewaltenzusammenführung bezeichnen würde.
Die Links-Mitte-Parteien suchten — und fanden dem Anschein nach — eine Lösung, die AfD dennoch zu verbieten, obwohl die verfassungsmäßigen Voraussetzungen hierfür wahrscheinlich gar nicht gegeben sind. So kamen Brosius-Gersdorf und Ann-Katrin Kaufhold ins Spiel, die beide ihre Sympathie für ein AfD-Verbot offen zeigten. Die Gefahr, die ich sehe, ist eine demokratiewidrige Verewigung der Herrschaft von Union, SPD, Grünen und eventuell noch der FDP. Taucht eine neue „lästige“ Konkurrenzpartei auf — das BSW, wenn es stärker wird, oder eine neue Partei, die wir noch gar nicht kennen — kann diese mit Hilfe dieser Richterinnen-Riege ebenfalls leicht verboten werden. Vielleicht träfe es dann auch einmal eine Partei, die die meisten von uns besser finden als die AfD.
Es gibt in einer lebendigen Demokratie aber keine Ewigkeitsgarantie für die Herrschaft einer Partei oder einer Gruppe von Parteien.
Alles ist in Bewegung, und Macht wird von „unten“ verliehen, was bedeuten kann, dass wir auch einmal von Kräften regiert werden, die uns nicht behagen.
Auch das Grundgesetz steht zur Disposition
Ich sehe hier eine ernsthafte Bedrohun: Fällt das Bundesverfassungsgericht — wird es also zu einer Institution, in der Freiheit nicht mehr zuhause ist —, dann fällt die ganze Demokratie. Das nämlich wäre dann wirklich „rechts“: ein autoritärer Staat, beherrscht von einer praktisch nicht abwählbaren Parteien-Gruppe, mit nur noch sehr eingeschränkten Möglichkeiten legaler Gegenwehr auf Seiten der Bürger.
Es bliebe als Zufluchtsort nur noch das Grundgesetz selbst — und auch dieses bliebe zahnlos, wenn jene Kräfte überhandnähmen, die es stets in einem freiheitsabgewandten Sinne auslegen. Auch das Grundgesetz ist übrigens veränderbar — und zwar erschreckend einfach: durch eine Zweidrittelmehrheit der Bundestagsabgeordneten.
In der Praxis bedeutet das: Union, SPD und Grüne können die rechtliche Grundlage unseres demokratischen Gemeinwesens ändern, sobald sie dies wollen und sich darin einig sind.
Im März 2025 wurde im Zuge der Debatte über die Aussetzung der Schuldenbremse und weil man damals „auf die Grünen zugehen“ wollte, die Klimaneutralität bis 2045 ins Grundgesetz geschrieben. Erstmals wurde damit ein Passus aufgenommen, der erstens durch tagespolitische Debatten geprägt war und somit nicht die zeitlose Gültigkeit des Grundgesetzes widerspiegelt, der zweitens politisch „Schlagseite“ hatte, weil er klar grüne Positionen zum Ausdruck brachte, und der drittens eine konkrete Jahreszahl in ein allgemein gültiges Gesetzeswerk hineinschrieb.
Nun können sich wohl die meisten auf den Schutz des Ökosystems als Ziel einigen. Wer garantiert uns aber, dass die Protagonisten dieses Coups nicht „Blut geleckt“ haben und weiteren schwarz-rot-grünen Lieblingsprojekten Verfassungsrang verleihen werden? Widerspruch gegen diese könnte dann künftig nicht mehr als legitime oppositionelle Arbeit, sondern als „verfassungswidrig“ abgekanzelt und bestraft werden. Wie wäre es zum Beispiel mit den Verfassungsziel, „rechts- und linksextreme“ Politiker bis 2030 aus allen Parlamenten zu entfernen?
Die Methode Jette Nietzard
Eine weitere Option für den Fall, dass zumindest regional doch einmal eine Regierung mit AfD-Beteiligung zustande käme, wäre verschärfter Straßenkampf, wie wir ihn im Januar und Februar 2025 im Zusammenhang mit einer „Aufweichung“ der Brandmauer durch Friedrich Merz schon erlebt haben. Eventuell käme dann auch die Methode Jette Nietzard ins Spiel: sich bewaffnen. Wie Jakob Augstein es in seinem Interview mit Nietzard richtig feststellte, wäre dies Waffengewalt gegen eine demokratisch gewählte Regierung.
Und dann gibt es da noch die „Ewigkeitsparagrafen“ des Grundgesetzes. Sie können nicht einmal durch eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag ausgehebelt werden. Dazu gehört Paragraf 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Aber niemand würde doch versuchen, an der Menschenwürde herumzudeuteln, oder? Nun ja, wie wir gesehen haben, hat Frauke Brosius-Gersdorf bereits damit begonnen, über abgestufte Menschenwürde zu sinnieren und Personengruppen zu benennen, denen diese vielleicht nicht im vollen Umfang zukommt. Wäre es da nicht denkbar, die Gruppe der nur eingeschränkt Würdeberechtigten noch ein bisschen zu erweitern? Also nicht mehr nur auf Ungeborene, sondern auch auf Straftäter, Ungeimpfte, Flüchtlinge, Staatsdelegitimierer, Deserteure …?
Ich unterstelle nicht, dass Brosius-Gersdorf oder irgendwelche anderen Akteure dergleichen konkret beabsichtigen.
Aber den Anfängen zu wehren bedeutet immer: die Dinge vom Ende her zu denken.
Frauke Brosius-Gersdorf hat am 7. August, mittags, ihre Kandidatur zurückgezogen — zu befürchten ist aber, dass das Projekt einer Instrumentalisierung des höchsten deutschen Gerichts zum Zweck des Machterhalts damit nicht aufgehoben ist, sondern nur aufgeschoben.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .