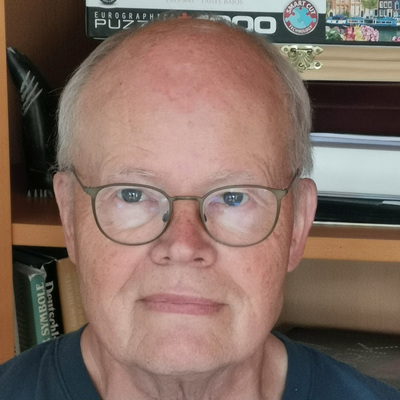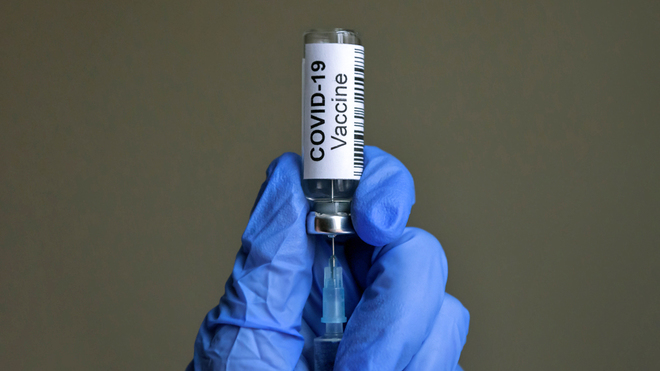Ist Trumps Zollpolitik die Laune eines „verrückten Königs“ (1) oder steckt ein Finanzierungsplan globaler US-Dominanz dahinter? Und warum spricht niemand darüber?
Die Empörung über Trumps launenhafte Zollpolitik ist grenzenlos. Die Mainstream-Journalisten sind sich weitgehend einig: Trump ist unberechenbar, erratisch, irrational oder zockt auf eigene Rechnung und versteht von Handel und Wirtschaft gar nichts, schadet aber mit seinen Zöllen allen, vor allem den USA selbst.
Der Zollhammer widerspreche allen Erkenntnissen der Wirtschaftswissenschaften, da er die Verbraucherpreise und die Inflation in den USA erhöhe und weltweit zu Handelseinbrüchen und Gegenzöllen führe. Wenn sich die deutschen Leitmedien dazu herablassen, genauer nach Trumps Absichten zu fragen, dann sind die Antworten eher simpel: Trump wolle das immense Handelsbilanzdefizit der USA reduzieren, das dadurch zustande kommt, dass die Amis mehr Handelsgüter importieren als exportieren, sodass sich immer mehr Handelsüberschüsse in Devisen bei den Handelspartnern ansammeln. Und in Folge der höheren Zölle sollen ausländische Firmen angelockt werden, zollfrei in den USA zu produzieren, was dort Arbeitsplätze schaffen werde. Außerdem will Trump durch die zu erwartenden Zolleinnahmen mehr Staatseinnahmen erhalten, mit denen er Steuererleichterungen für die heimischen Unternehmen finanzieren will. Aber das seien alles Milchmädchenrechnungen, schreiben die Wirtschaftsredakteure in den Zeitungen. Das ist nicht ganz falsch, aber zu kurz gegriffen. Tiefergehende Recherchen? Fehlanzeige!
Nur im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) und in Online-Magazinen für Finanzanleger steht mehr über die wirtschaftlichen Berater von Trump, die als konservative Ökonomen immerhin aus renommierten Universitäten und Thinktanks stammen und der in Europa verbreiteten neoklassischen Schule der Ökonomie in Teilen widersprechen. Ohnehin sollte man weniger auf die Person Trump schauen als auf die hinter ihm stehenden Netzwerke wie der Heritage Foundation und der America First Policy Institute, die im Interesse konservativer Milliardäre weitgehend Personal und Inhalte der zweiten Trump-Administration bestimmen. Dr. Stephen Miran, der Vorsitzende des wirtschaftlichen Beraterteams von Trump, hat in einer Rede vor dem konservativen Hudson-Institut die wirtschaftspolitische Strategie erläutert (2):
„Kern der Überlegung (…) ist, dass die Vereinigten Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg zwei öffentliche Güter für die Weltgemeinschaft bereitstellen: einen Sicherheitsschutzschirm und die Weltreserve- und Handelswährung Dollar, deren Rolle durch die amerikanischen Staatsanleihen als sichere Anlage gestützt werde“ (3).
Was hat das nun mit der Zollpolitik zu tun? Über Zölle sollen Einnahmen generiert werden, die helfen, das Haushaltsdefizit zu verringern. Begründung:
Erstens habe diese Politik des „Sicherheitsschutzschirms“, gemeint ist die militärische Präsenz der USA weltweit und in der NATO, enorm zur Staatsverschuldung der USA beigetragen, finanziert allein von den USA zum Nutzen seiner Verbündeten, die diese Militärkosten einsparen würden und darum wirtschaftliche Vorteile hätten. Darum müssen das Außenhandelsdefizit und die Schuldenlast dauerhaft reduziert werden. Zölle seien da eine mögliche Finanzierungsquelle.
Also im Klartext: Weil den USA die Unterhaltung ihrer circa 1000 Militärstützpunkte (4) zu teuer und die Kosten für die NATO-Sicherheitsgarantien zu hoch geworden sind, soll sich jetzt die ganze Welt finanziell daran beteiligen und höhere Zölle zahlen oder mehr US-Waren kaufen?
Amerikanische Hochrüstung finanziert durch die Handelspartner? Auch durch China? Was für ein selbstgerechter Machtanspruch!
Zweitens ist der Dollar die Leit- und Reservewährung der Welt, in die sich viele Anleger flüchten können, wenn es kriselt. Dies führt zu einer weltweiten strukturellen Nachfrage nach Dollar, was zu einer Überbewertung führt, der die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Güter verschlechtert: US-Exporte verteuern sich, Importe aus der EU und China werden billiger, das führte über die Jahre zum Exodus vieler US-Produzenten und kostete viele Arbeitsplätze. Andererseits profitierte die US-Wirtschaft von niedrigen Zinssätzen und der Staat von risikoloser Staatsverschuldung – bis jetzt.
Nun aber ist das Handelsdefizit so groß, die Staatsverschuldung so immens, dass eine neue Finanzkrise droht. Was also empfiehlt Trumps Beratergremium über Zollmaßnahmen hinaus? Die Handelspartnerländer könnten „unfaire Handelspraktiken beenden“, ihre Märkte öffnen, auf Gegenzölle verzichten und mehr von Amerika kaufen. Vor allem aber könnten sie ihre Verteidigungsausgaben erhöhen und mehr US-Rüstungsgüter kaufen oder Fracking-Gas: Das könnte Trumps Deal sein!
Könnte es also sein, dass die in Deutschland verantwortlichen Politiker die Bürger für dumm verkaufen, dass die gigantische Aufrüstung gar nicht einem überschätzten russischen Aggressor gilt, sondern dem amerikanischen Handelsdefizit?
Aber, so wenden Kritiker ein, mit höheren Zöllen und diesen Deals werde die US-Währung wieder aufgewertet, was wiederum die Importe billiger mache und die US-Waren teurer, also eine Inflationsgefahr bedeute. Ein Teufelskreis? Beim Blick auf den Dollarkurs seit Trumps Amtsantritt stellt man aber fest, dass er deutlich fällt.
Wie kann das sein? Der renommierte Ökonom Paul Krugman deutet dies so: „Sobald die Investoren die Politik von Trump in Aktion sahen, suchten sie das Weite.“
Hat Trumps erratischer Kurs — Zölle hoch — Zölle aussetzen — Zölle wieder hoch — die Absicht, genau dies zu erreichen, den Dollarkurs zu senken? Die Verunsicherung als währungspolitische Strategie oder als Motivation für Deals mit den Importländern?
Anders als erwartet, haben als Reaktion jedoch finanzstarke Anleger US-Staatsanleihen, eigentlich eine krisenfeste Geldanlage, in Massen abgestoßen. Vermutet wird, dass entweder Japan, China als Vergeltung für die Zölle oder große US-Investmentfirmen, Elon Musk und Co., diese Verkäufe gestartet haben mit der für den US-Haushalt schädlichen Folge von Zinserhöhungen: Werden Staatsanleihen massenhaft verkauft, steigt der Zinssatz, da nur bei höherer Rendite mit neuen Käufern zu rechnen ist. Nun müssen die US-Haushälter für die Staatsschulden plötzlich höhere Zinsen bezahlen. Aus der Traum von den zusätzlichen Staatseinnahmen durch Zölle? Bleibt abzuwarten, wie die Fed, die US-Zentralbank, darauf reagiert, mit Zinssenkungen?
Dennoch üben die Zollpolitik und die Unberechenbarkeit der Trump-Administration großen Druck auf die Handelspartner und die weltweiten Finanzmärkte aus, den währungs- und handelspolitischen Interessen der USA entgegenzukommen, zum Beispiel durch Kauf von mehr Fracking-Gas und Öl oder durch Rüstungsgüter. Dafür braucht es in der westlichen Welt ein Umdenken: Abschied vom ökologischen Umbau der Industriegesellschaft, dem „Green Deal“, und Abschied von einer Politik des Friedens und der Abrüstung. Ich habe den Eindruck, die Politiker der deutschen Regierung und die ihnen stets folgenden Leitmedien haben das längst in Angriff genommen, die Bevölkerung propagandistisch darauf vorzubereiten, wie es die Zeitungen seit einiger Zeit tun: Ihre großen Berichte über die mangelnde „Kriegstüchtigkeit“ der Krankenhäuser oder der privaten Wirtschaft (5) zeigen das ganz deutlich. Und dafür braucht man einen Feind…
In welchem Zustand die Pressefreiheit in Deutschland in Wirklichkeit ist, erkennt man daran, dass alle Leitmedien ins gleiche Horn stoßen und sich niemand traut, dieser Kampagne öffentlich zu widersprechen.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
(1) Die Bezeichnung stammt von dem amerikanischen Ökonom Paul Krugman
(2) Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8. April 2025, „So rechtfertigt Trumps Chefökonom die Zollpolitik“
(3) Ebenda
(4) Wikipedia, Zahl von 2004
(5) Vergleiche Braunschweiger Zeitung vom 16. April 2025 und andere Ausgaben