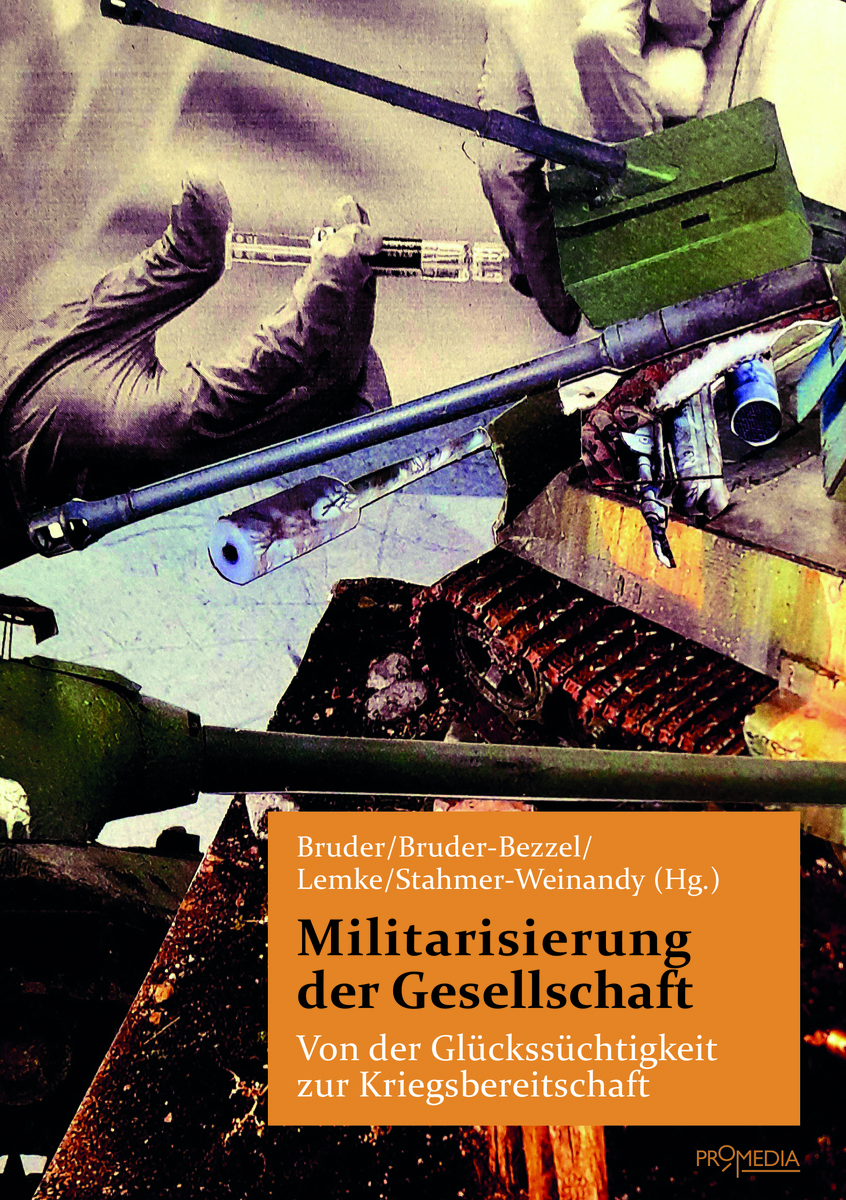In einer Zeit, in der die deutsche Regierung wieder den Krieg gegen Russland ins Auge fasst, in der Kriegstüchtigkeit zur Tugend erklärt wird und vor unseren Augen ein Völkermord in Gaza stattfindet, blicken Menschen, die für den Frieden eintreten, auf eine Geschichte des Widerstands gegen Propaganda und Kriegshetze.
Nun sollen wir zum dritten Mal auf einen Krieg gegen Russland vorbereitet werden, und wieder läuft die Kriegspropaganda auf Hochtouren.
Mental sei die Bevölkerung darauf noch nicht eingestellt. Die Gesellschaft müsse sich wieder an den Gedanken gewöhnen, dass ein Krieg drohe. Wir müssten kriegstüchtig werden, behauptet Verteidigungsminister Pistorius.
Carsten Mölling fordert deshalb einen Mentalitätswechsel, die kriegsentwöhnten Deutschen müssen einen tatsächlichen Krieg auch mittragen können.
Die EU-Kommissarin Hadja Lahbib spricht sogar von Kriegsvorbereitung als neuen „Way of Life“. Das heißt, schreibt der Journalist Helmut Scheben, „die Vorbereitung auf den Kriegsfall wird Lebensstil, so normal wie tägliches Zähneputzen oder Staubsaugen“, und er erinnert dabei an die legendäre Persiflage von Gerhard Polt „Ich habe einen Bunker für 6 Personen gebaut“. (Scheben, 2023)
Der geforderte Mentalitätswechsel wird eingebettet in ein gesamtgesellschaftliches Resilienz-Konzept. Zielte Resilienzforschung anfänglich darauf, vor allem in pädagogischen und psychotherapeutischen Prozessen, durch Stärkung der Fähigkeiten, Ressourcen und Wachstumspotenziale die Widerstandskraft der Menschen zu unterstützen, wurde Resilienz schnell zum Inbegriff individueller Selbstoptimierung und Anpassung an die gesellschaftlichen Bedingungen, zum Erfüllungsgehilfen neoliberaler Bildungspolitik.
Mittlerweile ist Resilienz zu einem strategischen Anliegen der Politik geworden und in sicherheitspolitischen Maßnahmen verankert. Gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit wird in den Dienst der Kriegsvorbereitung gestellt. Dazu gehören die militärische Aufrüstung, die Absicherung der Infrastruktur und die Bereitschaft der Bevölkerung, Notsituationen, Katastrophen und deren Folgen annehmen und bewältigen zu wollen.
Eine resiliente Gesellschaft gibt sich zudem nicht der Illusion eines 100%igen Schutzes hin. Sie akzeptiert Verluste und Vernichtung und verliert dabei nicht die Fähigkeit, einen Sinn in der Zukunft zu sehen. Aber die Akzeptanz von Tod, Vernichtung und Opferbereitschaft ist nicht leicht zu haben, für die mentale Mobilmachung reichen Appelle allein nicht aus. Die Regierung muss die Zügel anziehen, sie benötigt die Zustimmung der Bevölkerung, muss „Überzeugungsarbeit“ leisten, um ihre Kriegsinteressen durchzusetzen. Das immer gleiche Thema, gegen den Willen der Menschen.
Der unbefangene Mensch
Die Menschen wollen keinen Krieg, der unbefangene, sozial reife Mensch sei nicht bereit, zu töten, schreibt der Sozialpsychologe Peter Brückner in seinem Beitrag aus dem Jahr 1967: „Ist der Mensch zum Frieden reif?“ (Brückner 1967/2022). Ihm erscheint es „völlig unbegreiflich, dass er Menschen töten soll, die er gar nicht kennt und von denen er nicht gekannt wird.“ Und es sei undenkbar, es könne nicht sein Interesse sein, „die zu töten, denen er gleicht, mit denen er aber nichts zu schaffen hat.“ (ebd., S. 10)
Zum Krieg muss der Mensch erst erzogen werden, man muss seine Menschlichkeit, seine vitale Lebensenergie und Glückserwartung erst abschaffen, ihn seiner Lust und seinem Leben entfremden. Es ist die dem Kapitalismus immanente schrittweise Zerstörung der Sozialität, der Vorkrieg zum heißen Krieg, den Brückner in seinem Beitrag analysiert (vgl. Bruder, 2022).
Wie sieht diese Erziehung aus? Wie kann es gelingen, den „Abgrund zwischen der natürlichen Weltsicht des unbefangenen Individuums einerseits und der sozialen Rolle, die es uniformiert im Krieg zu erfüllen hat“ zu überwinden? (Brückner, 1967/2022) Brückner beschreibt mehrere Schritte, in denen sich diese Erziehung vollzieht. Die Beeinflussung beginnt bereits im Elternhaus und in der Schule, medial begleitet und propagandistisch aufgeladen. Ich werde im Folgenden einige Aspekte aufgreifen, die meines Erachtens die Kriegspropaganda maßgeblich mitbestimmen.
Abstraktion
Wer zum Krieg erziehen will, der muss dafür sorgen, dass der Mensch sich mit Abstrakta abspeisen lässt, statt auf ihrer Konkretisierung zu bestehen (ebd., S. 17).
Man muss ihn davon überzeugen, dass Abstrakta wie Freiheit, Vaterland, Demokratie, Sicherheit, Wertewesten realer sind als der konkrete Mensch. Sorgen, Ängste, Nöte, Befürchtungen werden aus dem gesellschaftlichen Diskurs entfernt und zum Verschwinden gebracht.
Man muss das unbefangen Menschliche erst abschaffen und ein Glaubensbekenntnis an seine Stelle setzen. Man muss an sein Gewissen appellieren, an seine Verantwortung fürs Vaterland und an die Solidarität mit den Mitmenschen.
Die Heroisierung des Tötens „lässt die glorifizierende Täuschung zu, man habe zu lernen, für Werte zu sterben“. (ebd., S. 17) Auch der Krieg bleibt abstrakt. Vom kriegerischen Angriff auf Menschen darf nie gesprochen werden, sondern nur von (Vorwärts-)Verteidigung, höchstens vom Ernstfall, selten vom Töten, lieber von Kampfkraft und Opfermut.
Mit verbrämten Begriffen wird in den Krieg gelockt. Martialische Bilder von Soldaten in Panzern untermalen kriegerische Kampfkraft. In Schulen, in Kitas, am besten hautnah in Kasernen, werden Kindern und Jugendlichen „Unsterblichkeit“ suggeriert. Krieg ist ein Abenteuer, eine eingeschworene Gemeinschaft entsteht, die es wert ist, nach Innen und nach Außen verteidigt zu werden. Das soll Krieg sein. Auch immer mehr Frauen wollen ihrem Vaterland dienen. Sie glauben, es sei Gleichberechtigung. Vom Töten wird nicht gesprochen.
Verharmlosung von Leiden
Keine Friedenssicherung ohne Verteidigungsbereitschaft, wird uns tagtäglich vorgelogen. Dafür bräuchte ein Land resiliente Menschen, die nicht vor jeder Gefahr zurückschrecken und über ihre Schmerzgrenze hinaus gehen können. Damit die Menschen dazu bereit sind, müsse Leiden verharmlost und herabgewürdigt werden, schreibt Brückner (ebd., S. 8).
Er sieht die Verharmlosung bereits in der kapitalistischen Leistungsgesellschaft angelegt (ebd., S. 9). Leistungsoptimierung und Härte gegen sich selbst habe man zu Idealen hochstilisiert.
Jede Hürde nehmen, jede Gefahr bewältigen zu können, seien ein Zeichen von Stärke und Mut. Wer diese Anforderung nicht erfüllen kann oder will, hat wenig Chancen auf ein gutes Leben. Kinder lernen deshalb frühzeitig, ihren Schmerz stumm zu ertragen und zu bagatellisieren, Verharmlosung wird zur Überlebensstrategie und belohnt.
In der Corona-Inszenierung hat der Kapitalismus wieder einmal seine Fratze unverblümt gezeigt. Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln wurden wir dazu gezwungen, das uns aufoktroyierte Leiden zu akzeptieren. Die permanenten Zumutungen seien alternativlos, ebenso die katastrophalen Folgen. Ganz nach Merkels Motto „Wir schaffen das“, auch wenn es wehtut. Mit einer schamlosen Eiseskälte wurde auf das Leiden der Kinder herabgeschaut, das bis heute sprachlos macht. Die verlogene Parole „Wir schützen euch“ ist bis heute die Legitimation für jeden Angriff auf die Bevölkerung, auch für die Kriegsvorbereitungen gegen Russland.
Es war ein Gehorsamkeits- und Leidenstest, in Vorbereitung auf den nächsten Krieg gegen die Bevölkerung. Ein großer Teil der Bevölkerung hat ihn bestanden, ihr Leiden verharmlost, ihrer vitalen Gefühle beraubt. Wie lange die Bevölkerung bereit ist, weiterhin den Angriff auf ihre Interessen und Bedürfnisse zu akzeptieren, ist nicht ausgemacht.
Vorurteile — Feindbild
Ein bedeutender Schritt zur Kriegsvorbereitung liegt für Brückner in der kontinuierlichen Pflege von Vorurteilen. Gemeint sind nationale und soziale Vorurteile, die sich gegen fremde Nationen, Kulturkreise und Sozialsysteme richten, immer verbunden mit der Abwertung des Fremden und der Aufwertung des Eigenen (ebd., S. 16).
Man muss Vorurteile schüren, Feindseligkeiten aggressiv zuspitzen, Feindbilder schaffen, auf das Töten der Feinde vorbereiten. Feindbilder zählen zu den bewährten Herrschaftsinstrumenten, Menschen mental auf einen Krieg einzustimmen. Durch Schüren von Bedrohungen, Ängsten und Aggression gegen den Feind sollen Kriege gerechtfertigt, die Identifikation und Loyalität mit dem Regierungshandeln aufgebaut werden, darin besteht ihre politische Funktion. Feindbilder übernehmen zugleich eine emotional stabilisierende Aufgabe. Als sozial vermittelte, stark vereinfachende Deutungsmuster, bieten sie dem Individuum Orientierung, Sicherheit (Brückner, 2008, S. 40). Das unbewusste Bedürfnis nach Orientierung wird seit jeher propagandistisch genutzt, um Feindbilder zu etablieren.
Relevante Hintergrundinformationen zu Konflikten, beispielsweise die Vorgeschichte von Kriegen, unerwünschte Informationen, werden außer Acht gelassen. Präsentiert wird der Bevölkerung eine reduzierte Weltsicht, heruntergebrochen auf Kategorien wie Gut und Böse. Das erlaubt die Dämonisierung des Feindes, eine einseitige Schuldzuweisung, das eigene Handeln als bloße Reaktion auf den Gegner, als Verteidigungskrieg darzustellen.
Wer sich illoyal zeigt, das Feindbild infrage stellt, oder gar seine Zustimmung verweigert, wird diffamiert und ausgegrenzt, wie wir es auch zurzeit erleben, wer den äußeren Feind Russland nicht anerkennt, der ist der Feind im Inneren.
„Diese Spaltung verschärft den Ausschluss und schweißt die Mehrheit in Loyalität noch fester zusammen.“ (Bruder-Bezzel/Bruder, 2025, S. 79)
Diese bittere Erfahrung haben Kritiker bereits in den Jahren der Corona-Inszenierung machen müssen, sie hat Spuren hinterlassen. In kurzer Zeit wurden Andersdenkende zu Feinden erklärt, herabgewürdigt und isoliert. Der Staat nutzte die Gunst der Stunde und verschärfte staatliche Repressionen, Inhaftierungen, Entlassungen, Kontensperrungen. Kontrolle und Überwachung gehören heute zur Tagesordnung. Es war vor allem die Angst vor Ausgrenzung, sozialem Abstieg und Zurückweisung, das Bedürfnis nach Wertschätzung und Zugehörigkeit, die durch die Spaltung mobilisiert wurden, und die viele Menschen dazu bewegt haben, sich den staatlichen Forderungen anzupassen.
Brückner schreibt zu den Hintergründen von Konformität, es ist „die Angst, dem gesellschaftlichen Verband bei nicht konformen Verhalten nicht mehr anzugehören“ (Brückner, 1966/1983, S. 23). Das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit ist zugleich auch das Bedürfnis, aus dem Feindbilder maßgeblich ihre manipulative Stärke beziehen: sie geben den Menschen „das sichere Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen und damit die Angst vor Ausschluss gebannt zu haben.“ (Bruder-Bezzel/Bruder, 2025, S. 78)
Die nachfolgende Feinderklärung Russlands fiel auf den fruchtbaren Boden „gut gepflegter“, tradierter, fest im westlichen kollektiven Bewusstsein verankerter Vorurteile und konnte deshalb schnell wiederbelebt werden. Und wieder werden Spaltungsprozesse in Gang gesetzt, Spaltung in die Anhänger der Kriegsvorbereitung und die Gegner, erneut Diffamierung derjenigen, die zweifeln; Putin-Versteher oder „Fünfte Kolonne Moskaus“ werden sie verächtlich genannt. Das Russland Feindbild wird stetig medial unterfüttert, damit die Bevölkerung weiterhin bereit ist, die steigenden ökonomischen und sozialen Belastungen mitzutragen.
Mit Hetze und Stimmungsmache agitieren Politik und öffentlich-rechtliche Medien Tag für Tag gegen Russland und Regierungskritiker und für einen Krieg, mit dem Militarisierung und Aufrüstung gerechtfertigt wird.
Man muss erst das unbefangen Menschliche zerstören, die Menschen gegeneinander aufhetzen, sie einschüchtern, voneinander trennen und bedrohen, sie dem Leistungsdruck aussetzen, ihre Gefühle verharmlosen und entsolidarisieren. Damals wie heute sollen wir uns an den Krieg, das Sterben und Töten gewöhnen, die Erziehung zum Krieg „setzt sich durch unser Leben hindurch ständig fort“ (Brückner, 1967/2022, S.18). Der alltägliche Krieg ist ein Spiegel unserer Gesellschaft.
Solange Herrschaft auf die Zustimmung der Bevölkerung, den gesellschaftlichen Konsens angewiesen ist, wird sie Steuerungstechniken einsetzen, das Verhalten, das Denken in ihrem Sinne beeinflussen zu wollen. Wer Frieden will, wird Herrschaftsverhältnisse und Techniken sozialer Steuerung einer kritischen Analyse unterziehen müssen.
Angst, Feinderklärung, sprachliche Regelungen sind Instrumente der Manipulation und Propaganda, Mittel zur Lenkung des Verhaltens und Denkens im Interesse der herrschenden Klassen. Wir sollen glauben, nicht wissen, schreibt Brückner. Die Machenschaften und Verbrechen der Mächtigen bleiben im Verborgenen, wie die Propaganda selbst.
Die bewusste Beherrschung sozialer Prozesse wird uns entzogen. Niemand ist verantwortlich, außer die Menschen selbst, ausgeliefert an die herrschenden Verhältnisse. Widersprüche existieren nur noch in der Realität, nicht mehr im Bewusstsein (Brückner 1972/1985).
Insbesondere in der Scheinrealität der Abstrakta sieht Brückner die Ursache für die Friedlosigkeit ganzer Generationen, weil sie zentrale Merkmale kapitalistischer Gesellschaftsordnungen außer Acht lässt, die zum Bedingungsgefüge der Menschheitsgeschichte und damit zu dem des Krieges gehören.
„Wer ist 'der' Mensch, gibt es ihn? Hat jemand den Menschen gesehen, der zum Töten erzogen wird, aber zum Frieden reif sein könnte? Was uns begegnet, sind konkret Herrschende oder Beherrschte, Arme oder Reiche, Unterdrückte und Unterdrücker; es sind Angestellte und Arbeiter mit oder ohne Bewusstsein von ihrer eigenen gesellschaftlichen Lage, also auch mit sehr unterschiedlicher Bereitschaft, sich ihre Situation anzueignen; es sind Personen, die Positionen besetzen, auf denen sie mit Lustprämien, mit Einfluss, mit Prestige rechnen dürfen, oder austauschbare Berufstätige, die bewusstlos funktionieren, und deren Leben ihnen oft wenig bietet, was es lebenswert machen könnte.“ (Brückner, 1967/2022, S. 25). Der unbefangene Mensch will keinen Krieg.
Es fällt mir nicht leicht „aufmunternde Worte“ zu finden in einer Zeit, in der die Macht sich der Kontrolle entzieht, die „alte“ Linke immer noch geschichtsvergessen und staatstreu die Corona Inszenierung mitträgt und die Intellektuellen sich mit Abstrakta schmücken. Es ist gut zu wissen, dass Bewusstsein hilft, und es immer noch und immer wieder Menschen gibt, die mit der Radikalität der Auflehnung einen Gegendiskurs entwickeln.
Hier können Sie das Buch bestellen: „Militarisierung der Gesellschaft“

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
Bruder, Klaus-Jürgen (2020). Keine „Krise“ — ein Krieg! Kein Krieg gegen das Virus, Krieg gegen die Bevölkerung, in: Bruder et al. (Hg.), Corona. Inszenierung einer Krise, Berlin, Sodenkamp & Lenz, S. 19-49
Bruder-Bezzel, Almuth, Bruder, Klaus-Jürgen (2025). Macht und Herrschaft. Wie mit politischer Psychologie und Propaganda unser Verhalten manipuliert wird, Berlin, Hintergrund
Brückner, Peter (1965/1983). Herr und Besitzer seiner eigenen Natur, In: ders., Zerstörung des Gehorsams, Aufsätze zur politischen Psychologie, Berlin, Wagenbach
Brückner, Peter (1967/2022). Das unbefangen Menschliche. Peter Brückner lesen, Ist der Mensch zum Frieden reif?, Berlin, Wagenbach
Brückner, Peter (2008). Ungehorsam als Tugend, Zivilcourage, Vorurteil und Mitläufer, Berlin, Wagenbach
Scheben, Helmut (2023): Analyse: Kriegsvorbereitung als „neuer Way of Life“, online unter: https://globalbridge.ch/kriegsvorbereitung-als-neuer-way-of-life/ (27.06. 2025)