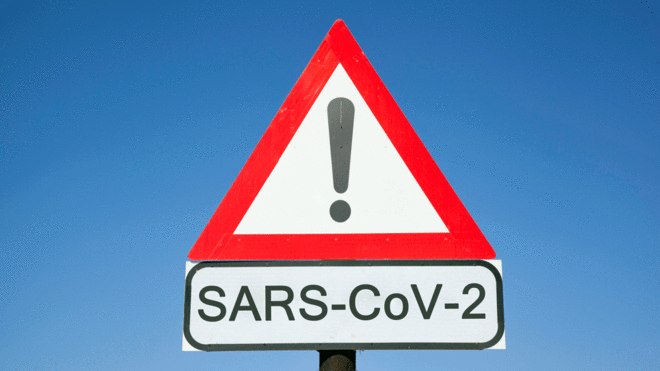Im Unterschied zu üblichen Krippen, in denen Kinder tagsüber betreut wurden, ging es bei den Wochenkinderheimen, auch Wochenkrippen genannt, darum, Kinder von Montag früh bis zum Samstagmittag oder länger in fremder Obhut zu halten, einschließlich nächtlicher Schlafzeiten (2). Eltern, insbesondere Mütter in Schichtarbeit, Alleinerziehende oder solche mit hohem Arbeitsaufwand, mussten ihre Kinder abgeben, oft mit wenig Wahlfreiheit (3). Diese Einrichtungen existierten vom Beginn der 1950er-Jahre bis in die Wendezeit hinein (4).
In ihrer ideologischen Ausrichtung wurden sie als Beitrag zur Kollektivierung der Erziehung, zur Entlastung der Familien und zur Frühsozialisation betrachtet. Doch hinter diesen ambitionierten Zielen verbargen sich oft emotionale Vernachlässigung, institutionelle Kälte und eine Entfremdung zwischen Kind und Eltern. Die Kinder, die Monate oder gar Jahre in solchen Einrichtungen verbrachten, lernten früh, dass Nähe, Zuwendung und Intimität kaum zu erwarten waren.
In diesem Essay möchte ich zunächst darlegen, wie diese Einrichtungen strukturell funktionierten und welche Zahlen und Statistiken wir kennen. Im Hauptteil werde ich mich mit den psychischen Folgen und Traumata befassen, die viele dieser Kinder ihr Leben lang begleiteten, unterlegt durch Fallbeispiele und Stimmen der Betroffenen, die oft lange nicht wussten, was ihnen widerfahren war; sie fühlten nur eine innere Leere, eine Sprachlosigkeit im eigenen Fühlen.
Abschließend werde ich eine moralische Reflexion ziehen, darauf hinweisen, welche Verantwortung die Gesellschaft trägt, und schließlich ein letztes persönliches Geständnis.
Struktur und Funktionsweise der Wochenkinderheime in der DDR
Institutionelle Grundlagen und Zweck
Die Wochenkinderheime, Wochenkrippen/Kinderwochenheime, waren Teil eines differenzierten Betreuungssystems in der DDR zwischen Tageskrippen, Dauerheimen für Säuglinge, Kinderheimen, Vorschulheimen und Jugendwerkhöfen (5). Während Tageskrippen nur tagsüber arbeiteten, boten Wochenkinderheime die Rund-um-die-Uhr-Betreuung über mehrere Tage hinweg an (6). Diese Einrichtungen standen meist unter kommunaler oder betrieblicher Trägerschaft, gelegentlich auch konfessionell (7). Ihr Ziel war es, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten und zugleich bereits früh eine sozialistische Erziehung im Kollektiv zu verankern (8). Offiziell wurde betont, dass die Kinder „fachgerecht“ durch Fachkräfte betreut würden, mit Hygienestandards, pädagogischen Programmen und Gesundheitsüberwachung (9).
Doch in der Praxis waren die Ressourcen knapp, das Personal oft überfordert und die individuellen Bedürfnisse der Kinder sekundär gegenüber dem betriebswirtschaftlichen oder politischen Ziel der Betreuung. Manche Kindergruppen wurden wie „Kollektivteile“ geführt, Urteilsfähigkeit und persönliche Bindungen blieben außen vor.
Zahlen und Statistiken
Ein Blick auf die verfügbaren Zahlen offenbart bereits Brutstätten der Ambivalenz:
• Im Jahr 1950 gab es etwa 2.550 Plätze in Wochenkrippen (10).
• 1966 stieg die Zahl auf rund 39.124 Plätze, ein Indiz für den Ausbau der Betreuung in industriellen Zentren (11).
• 1980 sank die Zahl jedoch auf 17.655, und 1989 waren es zuletzt nur noch 4.800 Plätze (12).
• Zwischen 1949 und 1990 durchliefen etwa 495.000 Minderjährige das Heimsystem der DDR, inklusive Spezialheimen, Kinderheimen, Jugendwerkhöfen et cetera (13).
• Davon entfielen etwa 135.000 Kinder auf Spezialheime (14).
• In einer Studie für Thüringen wurde beobachtet, dass ehemalige Heimkinder häufiger in prekären Lebenslagen, mit schlechterem Gesundheitsstatus und höherer psychischer Belastung lebten (15).
Zahlen zu reiner Wochenkinderheim-Erfahrung sind rar, denn viele Dokumente sind fragmentiert, archivalisch verstreut oder nicht explizit als „Wochenkinderheim“ klassifiziert. Die Forschung bewegt sich oft am Rand der Abschätzungen und Erfahrungsberichten.
Alltag und emotionale Bedingungen
Was bedeutete Alltag in solchen Einrichtungen? Kinder gingen oft ohne feste Bezugspersonen durch Tag und Nacht, wechselten Pflegerinnen, hatten kaum Gelegenheit zu intensiver, unvermittelter Zuwendung.
Die Schlafräume, Essensräume, Spielräume — alles war reglementiert, strukturiert, gefüllt mit Gruppenaktivitäten, Ritualen, Zeitplänen. Spontane Nähe, das individuelle Kuscheln, das unstrukturierte Verweilen, all das war selten. Die Kinder lernten, ihr Bedürfnis nach Nähe und Trost zu unterdrücken oder es teilnahmslos zu fragmentieren.
Diese Bedingungen entsprechen klassischen Kriterien für emotionale Deprivation aus der Bindungs- und Deprivationstheorie: fehlende Kontinuität, mangelnde mütterliche oder väterliche Präsenz, wenig Gelegenheiten zur responsiven Interaktion, wenig Berührung, wenig Trost. Forschungen der DDR-Pädagogik selbst, etwa von Eva Schmidt-Kolmer in den 1950er-Jahren, zeigten, dass Kinder in Wochenkrippen in der Regel langsamer in ihrer körperlichen und psychischen Entwicklung waren als Kinder in Tagesbetreuung mit regelmäßiger Rückkehr der Eltern (16). Doch diese Forschungen wurden politisch oft zurückgehalten oder umgedeutet: Die Ideologie wollte nicht eingestehen, dass das Modell selbst Schaden erzeugte.
Psychische Folgen und Traumata — eine zerstörte innere Landkarte
Emotionaler Entzug und Bindungsstörung
Ein Grundtrauma vieler ehemaliger Wochenkinder liegt in der Frühphase: der Entzug von konsistenter, verlässlicher Bindung. Kinder, die täglich ihre engsten Bezugspersonen nur in fragmentarischer Weise erleben oder gar nicht sehen, entwickeln ein Sicherheitsvakuum in der Psyche. Die Bindungstheorie zeigt, dass stabile, wiederkehrende Interaktionen mit feinfühlig reagierenden Bezugspersonen essenziell sind für emotionale Regulation, Selbstwert und Urvertrauen.
Fehlende oder brüchige Bindungserfahrungen können sich später ausprägen als:
• emotionale Taubheit oder Abgeschottetheit,
• Schwierigkeiten, Nähe zuzulassen,
• Furcht vor Verlassenheit oder ständiges „Hypervigilanz“-Verhalten,
• Bindungsängste, Bindungsabbruchängste,
• Ambivalenzen in Beziehungen: Nähe suchen und zugleich fliehen.
Viele ehemals Heimuntergebrachte berichten, sie fühlten sich „ziemlich leer“ im Inneren, als ob etwas grundlegend Wesentliches fehlte.
Depression, Angst und Affektstarre
Langzeitstudien und neuere Forschung zeigen gehäuft depressive Störungen, Angststörungen, psychosomatische Beschwerden und funktionale Störungen bei Menschen mit Heimerfahrung (17).
Beispiel: In einem Artikel des Tagesspiegel schildert Psychologin Eva Flemming, dass viele der früheren Wochenkrippenkinder später Depressionen und Angststörungen entwickelten (18). Die frühe Deprivation, gekoppelt mit sozialen und identitätspsychologischen Faktoren, schafft eine doppelte Belastung: die seelische Wunde plus mangelnde Unterstützungssysteme in der Gesellschaft nach der Wiedervereinigung. Anders gesagt: Wer früh kein emotionales Zuhause erlebt hat, tritt mit einer „leeren Leiste“ ins Leben, und dieser Mangel wirkt wie ein dunkler Nebel über Beziehungen, Karriere und Gesundheit.
Identitätsverlust, Entfremdung und innere Leere
Viele Betroffene berichten nicht nur von psychischen Diagnosen, sondern von einem undefinierbaren Gefühl: „Ich fühle mich anders“, „Ich vermisse etwas, kann’s aber nie greifen“.
Sie wuchsen mit Leere auf, ohne dass sie benennen konnten, worin diese bestand. Erst durch Gespräche, durch Spurenforschung in Archiven und durch Begegnungen mit anderen Betroffenen erkannten sie, dass ihre innere Leere kein persönliches Versagen war, sondern ein struktureller Bruch in ihrer Biografie.
Diese Entfremdung setzt sich in Beziehungen fort: Wer innerlich ständig auf Abstand programmiert ist, wer Nähe und Bindung misstraut, wer sein Gefühlsleben kaum spüren kann, wird zu einem Fremden, selbst für die Menschen, die ihn lieben möchten.
Traumafolgestörungen und Komplextrauma
In manchen Fällen gingen die Erfahrungen über emotionale Vernachlässigung hinaus: Gewalt, Missbrauch und institutionelle Erniedrigung spielten oft eine Rolle. Die Aufarbeitungskommission berichtete, dass 337 Personen sich bislang bei der Kommission gemeldet haben und sexuellen Missbrauch in Familien und Institutionen der DDR dokumentierten (Stand Juli 2024) (19). In den totalen Institutionen wie Spezialheimen, Jugendwerkhöfen, aber auch in Heimen für Kleinkinder war Macht asymmetrisch verteilt und Kontrolle allgegenwärtig (20). Die Gewalterfahrungen potenzierten traumatische Folgen: Dissoziation, Intrusionen, emotionale Gleichgültigkeit, Borderline-ähnliche Strukturen, Selbstverletzung, selbstbeschädigendes Verhalten. Für manche wurde die Kindheit zu einem Schattenreich, das das gesamte Erwachsenenleben unterminiert.
Fallbeispiele aus Betroffenenberichten
Da systematische qualitative Forschung teilweise noch in Entwicklung ist, holen wir uns exemplarische Fallfragmente aus Zeitzeugenportalen, Interviews und wissenschaftlichen Publikationen:
• Eine Betroffene berichtet: „Ich wusste nicht, wer ich bin, bis ich mit 40 begann, alte Heimalben zu durchsuchen und Briefe meiner Eltern zu lesen; da erst erkannte ich, dass sie mich jeden Freitag wieder abgeholt haben und ich sie nicht verraten darf.“
• Ein anderer schildert: „Als Kind war ich ruhig, angepasst, ich sprach kaum. Als Erwachsener war ich unaufhaltsam in Therapie, ich litt unter Panikattacken, ohne zu wissen warum.“
• Im Forschungsprojekt „TESTIMONY“ wurden mehrere Menschen befragt, die erst spät in Leben realisierten, dass ihr vermeintlicher „normaler Alltag“ eine Reihe traumatischer Deprivationserfahrungen verbarg (21).
• In Thüringen zeigt sich in der Sozialforschung, dass ehemalige Heimbewohner häufiger Altholzverletzungen (etwas, das schon lange zurückliegt), Haftstrafen oder soziale Exklusion erleben, als ob ihre brüchige emotionale Basis sich in einem instabilen Lebenslauf fortsetzte (22). Diese Beispiele sind keine Anekdoten, sondern Schnittpunkte eines kollektiven Traumas, das systematisch verdrängt wurde.
Warum so spät das Bewusstsein?
Warum wissen viele Betroffene erst im Erwachsenenalter, was ihnen widerfahren ist? Die Ursachen sind vielfältig:
• Erinnerungen werden gehalten in Bruchstücken, oft fragmentarisch, verdrängt aus dem Schutzmechanismus der kindlichen Psyche.
• Institutionelle Geheimhaltung, Aktenvernichtung, fehlende Dokumentation.
• Sozialer Schweigekonsens: In der DDR durfte über Gewalt, Zärtlichkeit, Individualität nicht frei gesprochen werden.
• Familiäre Strukturen, die Mitverschweigen oder Nichtwissen kultivierten.
• Scham, Schuldgefühle, Stigmatisierungsangst.
Wenn jemand dann Jahrzehnte später beginnt, Fragen zu stellen, entsteht oft eine Lawine von Gefühlen: Wut, Trauer, Fassungslosigkeit, Desillusionierung. Viele erleben, dass sie Lebensbiografien auf wackeligen Fundamenten gebaut haben.
Auswege, Verarbeitung und Verantwortung der Gesellschaft
Rehabilitation, Therapie, Erinnerung
Einige Betroffene fanden Heilung durch Therapie, durch Kreativität, durch Begegnung mit anderen Betroffenen. Der Weg ist mühsam, denn das Trauma sitzt tief. Gruppenarbeit, traumasensible Psychotherapie, Kunsttherapie, Narrationserzählung helfen, die bröckelnde innere Architektur neu zu stabilisieren.
Auch erinnerungspolitische Initiativen, Dokumentationszentren, öffentliche Diskussionen und Forschung sind unverzichtbar; nur, wenn die Gesellschaft sich erinnert, kann sie Verantwortung übernehmen.
Politische und gesellschaftliche Verantwortung
Die Republik — Ost und gesamtdeutsch — hat nur teils reagiert: Der Fonds „Heimerziehung in der DDR“ wurde eingerichtet, aber oft kritisiert für engen Zugang, geringe Mittel und bürokratische Hürden (23).
Notwendig wäre eine gezielte Förderung von psychosozialer Betreuung, Stipendien für betroffene Studierende, Anerkennung von Lebensleistungen und öffentlichen Raum für Zeugenschaft. Und eine Klarstellung des Unrechts — dass nicht die betroffenen Kinder schuld sind, sondern das System, das sie in eine frühe Entwurzelung zwang.
Wie mit der inneren Leere leben?
Viele ehemalige Wochenkinder lernen, mit der Leere zu leben: Sie bauen, oft mühsam, ihre eigene Brücke zur Selbstannahme. Sie erkennen, dass Leere nicht Schwäche ist, sondern Folge eines strukturellen Einbruchs. Im Schutz von Gemeinschaft, Therapie und Erinnerung können sie ihre zerrissenen Stücke langsam zusammensetzen.
Abschluss und Moral
Wenn wir zurücktreten und die Geschichte der Wochenkinderheime der DDR betrachten, erkennen wir mehr als eine historische Kuriosität oder ein sozialpädagogisches Experiment: Wir sehen ein System, das Familienbindung instrumentalisierte, Kinder als Objekt sozialer Planung behandelte und menschliche Verletzlichkeit preisgab. Die moralische Forderung lautet: Nie wieder darf ein Kind als Kollege des Staatshaushalts, als Produkt von Arbeitslohn oder sozialer Planung betrachtet werden, sondern immer als Subjekt mit unantastbaren Bedürfnissen, Würde und Stimme.
Die Lehren daraus gelten heute auch, nicht nur rückblickend. In modernen Betreuungsstrukturen, Kitas, Heimformen, Pflegefamilien, überall dort, wo Kinder betreut werden, dürfen wir niemals vergessen: Konsistente Bindung, empathische Zuwendung, individuelle Fürsorge sind keine Zusatzleistungen, sondern unverzichtbare humanitäre Mindeststandards.
Wenn wir Leere sehen, in Seelen, Städten, Strukturen, dann müssen wir sie benennen, teilen, entschärfen.
Für jene, die von früherem Unrecht betroffen sind: Ihr Leiden ist nicht isoliert, nicht „normales Leben“, es ist Teil einer kollektiven Wunde, die benannt, verstanden und mit Heilungsperspektive behandelt werden muss. Die Gesellschaft schuldet Ihnen Erinnerung, Fürsorge und Rehabilitation. Ich hoffe, dieses Essay trägt dazu bei, dass die Stimmen der Betroffenen sichtbarer werden, dass das Schweigen bricht und dass die Leere, die so viele Jahre unbenannt blieb, endlich einen Namen bekommt und einen Weg zur Heilung.
Liebe Leserin, lieber Leser,
ich danke Ihnen, dass Sie diesen schwierigen Weg mitgegangen sind, durch Statistik, Schmerz, Erinnerung und moralische Forderung. Wenn Sie heute mit anderen Menschen über Kindheit sprechen, denken Sie bitte daran: Manche tragen unsichtbare Leere in sich, als Echo einer frühen Isolation, das nie einfach verschwindet. Seien Sie sensibel, hören Sie zu, teilen Sie nicht zu schnell Urteile. Verantwortung beginnt in Kleinigkeiten: in Aufmerksamkeit, in Offensein, im Mut zum Infragestellen. Wenn Sie jemanden kennen, der „anders“ wirkt, fragen Sie, nicht nur nach Symptomen, sondern nach Geschichten. Nur gemeinsam können wir aus Leere Erinnerung, aus Schweigen Stimme, aus Verlorenem Hoffnung bauen.
In diesem Sinne ein letztes Geständnis: Auch ich, Alfred-Walter von Staufen, bin eines jener Kinder, die heute diese große Leere im Inneren spüren.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
Abbildungen: Alfred-Walter von Staufen
Hinweis: Einige Quellen verwenden Interviews, Zeitzeugenberichte oder Archive, die nicht vollständig laufend zitierfähig sind. Die angegebenen Werke dienen als Einstieg und Orientierung.
(1) https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/262920/wochenkrippen-und-kinderwochenheime-in-der-ddr/
(2) https://de.wikipedia.org/wiki/Wochenkrippe
(3) https://de.wikipedia.org/wiki/Wochenkrippe
(4) https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/262920/wochenkrippen-und-kinderwochenheime-in-der-ddr/
(5) https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/262920/wochenkrippen-und-kinderwochenheime-in-der-ddr/
(6) https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/262920/wochenkrippen-und-kinderwochenheime-in-der-ddr/
(7) https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/262920/wochenkrippen-und-kinderwochenheime-in-der-ddr/
(8) https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/262920/wochenkrippen-und-kinderwochenheime-in-der-ddr/
(9) https://www.agj.de/fileadmin/files/publikationen/Expertisen_web.pdf
(10) https://de.wikipedia.org/wiki/Wochenkrippe
(11) https://de.wikipedia.org/wiki/Wochenkrippe
(12) https://de.wikipedia.org/wiki/Wochenkrippe
(13) https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/251286/geraubte-kindheit-jugendhilfe-in-der-ddr
(14) https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/251286/geraubte-kindheit-jugendhilfe-in-der-ddr/
(15) https://bildung.thueringen.de/fileadmin/content/tmsfg/abteilung4/referat31/forschungsbericht_soziale_lage_ddr-heimkinder.pdf
(16) https://de.wikipedia.org/wiki/Wochenkrippe
(17) https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/das-krippensystem-der-ddr-viele-leiden-unter-depressionen-und-angststorungen-9905777.html
(18) https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/das-krippensystem-der-ddr-viele-leiden-unter-depressionen-und-angststorungen-9905777.html
(19) https://www.aufarbeitungskommission.de/themen-erkenntnisse/ddr/
(20) https://www.aufarbeitungskommission.de/themen-erkenntnisse/ddr/
(21) https://www.uni-leipzig.de/newsdetail/artikel/erfahrungen-in-ddr-kinderheimen-deren-bewaeltigung-und-aufarbeitung-2023-03-20
(22) https://bildung.thueringen.de/fileadmin/content/tmsfg/abteilung4/referat31/forschungsbericht_soziale_lage_ddr-heimkinder.pdf
(23) https://www.agj.de/fileadmin/files/publikationen/Expertisen_web.pdf