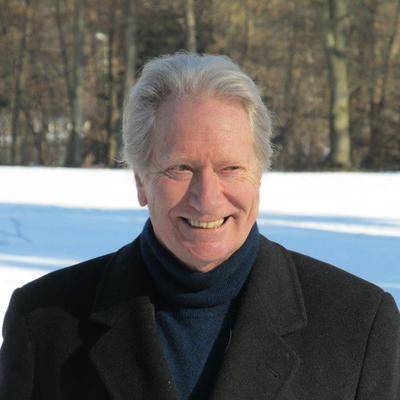Rauura wohnte als Einsiedler auf dem Pari. Als Maeva und Cording nach einstündigem Fußmarsch in seiner Berghütte ankamen, warteten dort zu ihrer Überraschung über dreißig Leute auf sie. Steve, Fara und die Anapa-Clique waren darunter, Musiker, Tänzerinnen, der Bürgermeister von Teahupoo und sogar der Umweltminister. Rauura war nicht dabei. Cording registrierte eine rote Decke auf dem Boden unter dem Pandanusdach, umrahmt von Schalen voller Früchte und Blumen. Die Folterbank!
„Rauura erwartet dich hinter dem Vorhang“, sagte Maeva.
Cording löste sich aus der ihm Mut zusprechenden Menge und schlug das Tuch zurück. Rauura war von den Haarwurzeln bis zu den Zehen tätowiert. Obwohl der Meister aufrecht und regungslos saß, hatte Cording den Eindruck, als winde er sich wie Zigarettenrauch. Das lag an den Tattoos, welche die Grenzen seines Körpers fließend erscheinen ließen.
„Bist du bereit, dein Tatau zu empfangen?“, fragte der Tahitianer.
Cording war irritiert von diesen Augen, von denen das Linke aus einem schwarzen tätowierten Quadrat schaute, während das Rechte unterhalb eines solchen im Licht lag.
„Ja“, hörte er sich sagen.
„Dann wird es gut“, antwortete Rauura und blickte begehrlich auf die weiße Haut seines Patienten.
Als Cording in die erwartungsfrohe Runde zurück kehrte, wurde er das Gefühl nicht los, dass man ihn wie ein Opfertier betrachtete, das gleich geschlachtet werden sollte. Eigentlich hätte er längst auf der roten Decke liegen sollen, aber durch einen überraschenden Antrag zur Geschäftsordnung verzögerte sich Omais Auftritt in Genf. Heißes und kaltes Wasser wurde herbeigeschafft, Maeva bastelte gar an einem Knebel. Wo war der Fernseher?
„Rauura hat keinen Fernseher“, sagte Maeva und wischte ihm den Schweiß von der Stirn. „Wir werden Omai im Radio zuhören.“
Anapa wechselte die Batterien an dem vorsintflutlichen Kofferradio, richtete die Antenne aus und versuchte, den richtigen Sender einzustellen, was ihm auch gelang. Radio Helvetia sendete auf französisch, das kam den Anwesenden natürlich entgegen. Man merkte dem Parlamentsreporter an, wie sehr er sich mühte, die unerwartete Pause zu überbrücken. Plötzlich öffnete sich der Vorhang und Rauura trat ein. Maeva nestelte an den Knöpfen von Cordings Hemd und begann ihn vor aller Augen zu entkleiden. Dann band sie ihm ein Tuch um die Hüften und bat ihn, sich hinzulegen. Die Tahitianer hockten sich im Kreis um ihn herum, während Rauura Knochenkamm, Tätowierstichel und Meißel zurecht legte. Das Gemisch aus Asche und Wasser, das der Meister ihm gleich unter die Haut treiben würde, befand sich in einer Schale am Kopfende.
„In diesem Moment betritt Omai die Bühne“, ließ sich der Radioreporter vernehmen. „Er ist in sein weißes Gewand gekleidet und hält den berühmten Schemel unterm Arm. Die Abgeordneten der Vollversammlung hält es nicht auf den Sitzen, sie begrüßen ihren charismatischen Gast mit tosendem Applaus ...“
Cording schloss die Augen. Rauura tunkte den Kamm in die Tinte, setzte ihn auf Cordings Schulter und drehte ihn auf der Stelle einmal um sich selbst. In dieser aufgemalten Zielscheibe würde das tatau entstehen, das man ihm zugedacht hatte. Die verschlungenen, symmetrischen Muster waren eine Sprache für sich, die Polynesier verfügten über ein ganzes Vokabular von Motiven und Symbolen. Früher war es für einen tahitianischen Mann undenkbar, sich nicht tätowieren zu lassen, ohne von der Gesellschaft verspottet zu werden.
„Anstatt hinter das Rednerpult zu treten, zieht es Omai vor, auf seinem Schemel Platz zu nehmen. Im Plenum herrscht jetzt absolute Ruhe. Unter den Delegierten hat sich eine geradezu feierliche Stimmung breit gemacht ...“
Rauura strich die zu bearbeitende Schulter mit Kokosnussöl ein und tunkte den Meißel in die Farbe. Cording bäumte sich auf, als ihn das Gerät das erste Mal traf. Das feste, rhythmische Klopfen des Stabes auf den Kamm nagelte ihn stöhnend am Boden fest. Maeva legte ihm ein kaltes Tuch auf die Stirn und drückte beschwichtigend seine Hand. Seltsam, dachte Cording, als ihm der Atem qualvoll durch die Lippen strich, die schnelle Reihenfolge der Einstiche webten einen so dichten Schmerzteppich, dass er zumindest nicht einbrach, nicht in Ohnmacht fiel, während ihn jene Stiche, die Rauura vereinzelt als Korrektur nachreichte, augenblicklich auf die Palme brachten.
„Haben Sie herzlichen Dank für den freundlichen Empfang“, scholl Omais Stimme aus dem Radio. „Ich werde heute nicht von dem Attentat sprechen, das auf mich verübt wurde, und auch nicht von dem, was vor Makatea passiert ist. Ich werde über das sprechen, was derartige Ereignisse in Zukunft verhindern soll. Über unseren gemeinsamen guten Willen werde ich sprechen und über die Möglichkeiten, die uns aus solidarischem Verständnis erwachsen. Ich verlasse diese Versammlung nicht eher, bis wir darüber Einigkeit erzielt haben.“
Die Tahitianer lachten, da unterschieden sie sich in nichts von den Delegierten der Vollversammlung. Als ihr Blick jedoch auf Cordings schmerzverzerrtes Gesicht fiel, stimmten sie einen sanften Gesang an, der eine beruhigende Wirkung auf ihn ausübte.
„Die wichtigste Frage, der wir uns noch zu stellen haben, heißt: kollektiver Selbstmord oder geistige Erneuerung. Ich vermute, dass ein überwiegender Teil der Menschheit die zweite Lösung bevorzugt. Dann lasst uns auch gemeinsam an ihr arbeiten!“
Cording warf einen Blick auf die blutgetränkten Tücher, mit denen Rauura seinen Rücken betupft hatte und die sich mittlerweile zu einem Haufen stapelten. Unterdessen bemühte Omai das Beispiel mit der Computersimulation, das Cording ihm gegenüber einmal erwähnt hatte:
„Stellen Sie sich vor, man beschleunigt die letzten hundertfünfzig Jahre im Zeitraffer, also die Epoche, in der das Industriezeitalter ökologisch voll zu Buche schlug. Wir verdichten diese Zeit zu einer Stunde. Angenommen, wir starten 1876 vor der amerikanischen Westküste in eine Umlaufbahn um die Erde. Pusteln bilden sich entlang der Pazifikküste, die an der Ostküste bereits zu bedenklichem Ausschlag herangewachsen sind. Nach der Atlantiküberquerung müssen wir feststellen, dass bereits ganz Europa befallen ist. Es sind die Städte, die wie Metastasen um sich greifen. Schmutzige Schlieren ergießen sich in Flüsse und Meere. Unterdessen schrumpfen die gigantischen Waldflächen zusammen und machen braunen Wüsten Platz. Ein immer dichter werdendes Netz von Straßen und Schienen legt sich um den Globus, ganze Kontinente verschwinden unter einem diffusen Grauschleier. Endlich an den Ausgangspunkt zurückgekehrt, stellen wir fest, dass die Erde zu einer Geschwulst verfault ist, die von den Rauchschwaden unserer Brandschatzungen vielerorts gnädig verdeckt wird.“
Interessant, dachte Cording, da wurde einer seiner wenigen gelungenen Einfälle vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen zitiert, und schon prallte der Tätowierungsschmerz von ihm ab, als würde Rauura ihm lediglich die Nägel feilen.
„Unser Verständnis vom Umweltschutz muss sich radikal ändern“, fuhr Omai fort. „Bisher reden die meisten Regierungen von Beständen, wenn sie von der Natur sprechen. Sie machen in allem eine Rechnung auf. Dieses Denken ist nicht dem Leben verpflichtet, sondern einer Haushaltsphilosophie. Unsere Forderung, der natürlichen Mitwelt Respekt zu erweisen und ihren Eigenwert anzuerkennen, ist das Kernstück einer Ethik, die zur Leitlinie der gesamten Menschheit werden muss. Wer könnte dabei behilflicher sein, als die indigenen Völker? Sie verfügen über wertvolle Erfahrungen und großartige Fachleute, wenn es um lebenswichtige Fragen geht.“
Cording war nicht fähig, Omais Worten die rechte Aufmerksamkeit zu schenken. Er kam sich vor wie Moses, der das gelobte Land sah, aber keinen Fuß hinein setzten konnte. Er entwickelte kein Gefühl für diesen historischen Augenblick — als sperrte ihn die Geschichte aus. Eingehüllt in Schmerzen war er nicht einmal willens, die Bedeutung dieser Zeremonie zu würdigen. Sein Herz raste, er blutete, er spürte Maeva kaum, die sich doch so reizend um ihn kümmerte. Er war in die Hölle der Folter geraten. Fast hätte er die Ehre aus den Augen verloren, die ihm heute und an dieser Stelle zuteil wurde. Dies hier war nämlich sein historischer Moment ...!
„Ich erwarte von der UNO, dass sie die indigenen Völker endlich anerkennt“, sagte Omai und erntete in Rauurus Hütte reichlich Beifall dafür. „Die indigenen Völker müssen die Möglichkeit erhalten, in ihren jeweiligen Gebieten und Regionen mit ihren eigenen Ressourcen und Visionen umzugehen.“
Rauura hielt in seiner Arbeit einen kurzen Moment inne. Vielleicht wollte er Cordings Gestöhne unterbrechen, um Omais Worten mehr Geltung zu verschaffen in der konzentrierten Runde.
„Wenn wir es nicht schaffen, unsere Gemeinden und Regionen autark zu machen, bauen wir auf dem Weg in eine bessere Welt nur Luftschlösser. Das Zauberwort für die Zukunft heißt Dezentralisierung. Wir müssen weg von den seelenlosen, aufgeblähten Staatsgebilden. Das Wissen der Ureinwohner ist die wichtigste Ressource der Menschheit. Nur wenn es gelingt, dieses Wissen mit der modernsten umweltschonenden Technik in Verbindung zu bringen, haben wir noch eine Chance, die fürchterlichen Entwicklungen umzukehren, die unseren göttlichen Lebensraum Erde in einen verrottenden Industrie- und Verkehrspark verwandelt haben. Die Zivilisation ist mit ihrem Latein am Ende. Sie gleicht einem Schiff, das ohne Kenntnis der Naturgesetze gebaut wurde und nun orientierungslos dahinschlingert. Es fehlt ihr an spiritueller Verbundenheit, mit deren Hilfe sie bewusst einen Kurs hätte wählen können, der eben nicht in die Katastrophe mündet.“
Cording biss in den Knebel, den Maeva ihm reichte. Omais Stimme war Teil des Gesangs geworden, den er um sich herum vernahm und in den auch sein kontinuierliches, kaum hörbares Stöhnen einging. Auf den Marquesas ließen sich die Männer sogar die Kopfhaut, die Zunge, die Augenlider und die Nasenlöcher tätowieren. Ihr Martyrium dauerte bis zu einer Woche. Dagegen war das, was er hier für einige Stunden an stechenden Schmerzen einzustecken hatte, das reinste Zuckerschlecken, ein flüchtiger Kuss aus den Tiefen der polynesischen Kultur. Die Gewissheit beschämte ihn, er riss sich zusammen und lauschte den melodischen Worten seines Freundes, die ein wenig befremdlich im Äther schwangen. Omai zitierte einige Beispiele, die verdeutlichen sollten, wie gefährdet die alten Kulturen waren, deren Beistand die Menschheit jetzt so bitter nötig hatte. Unter anderem nannte er den deutschen Arzt und Ethnologen Karl von den Steinen, der 1897 für einige Monate auf den Marquesas weilte, um der fast verschütteten Tradition des Tätowierens auf die Spur zu kommen.
„Ihm verdanken wir eine akribische Beschreibung aller ehemals so gebräuchlichen Muster und deren Bedeutung. Ohne seine Arbeit wäre die Sprache der Tataus für immer verloren gegangen und mit ihnen ein Großteil der polynesischen Identität. Häufig ist es der Initiative einzelner Personen zu verdanken, dass das alte Wissen wieder hervorbricht und jene Strahlkraft entwickelt, die nichts anderes als Frieden zulässt unter den Menschen. Je mehr solcher Friedensinseln wir auf diesem Planeten zulassen, desto harmonischer wird sich das Verhältnis unter den Menschen gestalten.“
Omai erwähnte zwei neunzig Jahre alte Zwillingsschwestern im afrikanischen Busch, die ihre zwanzigtausend Jahre alte Stammessprache gerettet hatten. Die Sprache war verboten worden, nachdem der Stamm von den Weißen entdeckt worden war. Die Menschen, die in der Folgezeit von ihrem Land vertrieben wurden und dabei ihre ursprüngliche Lebensweise verloren, vergaßen schnell. Vor fünfzig Jahren war die Sprache dieses Stammes offiziell für tot erklärt worden. Die beiden Frauen aber hatten sie im Geiste bewahrt und gaben sie nun in mühevoller Arbeit auf langen Spaziergängen an die Kinder des Dorfes weiter. Und diese gaben sie wiederum an ihre Kinder weiter. Inzwischen war sie zu den Buschmännern zurückgehrt.
„Die Möglichkeiten des Menschen sind unbegrenzt, wenn er sich in den Dienst der Gemeinschaft stellt“, sagte Omai. „Eine solche Gemeinschaft wurde vor zwei Jahren im Amazonasgebiet gegründet. Dort versucht eine kleine Gruppe von Ureinwohnern, ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Leben für sich und ihre Kinder aufzubauen. Sie bestimmen die Bäume und denken über ihre Verwendung nach. Sie beschäftigen sich mit den Seen und fragen sich, wie sie Wälder und Wasser schützen können. Sie sorgen dafür, dass sie sich vermehren und schaffen ihre eigene biogenetische Reserve, die es ihnen gestattet, sich unabhängig zu machen von den unerschwinglichen Medikamenten der westlichen Medizin. Wo diese Anstrengungen unterbleiben, sinkt die Selbstachtung der Menschen, erstickt das Leben in Melancholie und Depression. Wie in dem kleinen grönländischen Dorf, von dem ich gehört habe. Dort nimmt sich fast jede Woche ein Inuk das Leben. Diese Menschen finden sich nicht mehr zurecht in dem allgemeinen Chaos unserer Tage. Niemand sagt ihnen, wie wichtig und wertvoll sie sind.“
Cording hatte das Gefühl, im eigenen, von Tränen gesättigten Schweiß ertrinken zu müssen. Zum erstenmal entwickelte er ein gewisses Verständnis für das Tätowierungsverbot, das die Missionare der „London Missionary Society“ Anfang des neunzehnten Jahrhunderts auf Tahiti ausgesprochen hatten ...
Omai warnte die unterdrückten Völker der Welt davor, ihrer zum Teil erbärmlichen Situation mit Gewalt zu begegnen. Die Mechanismen, die dann griffen, waren vorhersehbar: die Regierungen würden ihre Militärmaschinerie mobilisieren und den Widerstand gewaltsam brechen.
„Unsere Art, Konflikte und Streitereien zu schlichten, ist eine andere“, sagte er. „Es geht nicht darum, wer Recht hat, wer gewinnt oder verliert. Es geht darum, dass entzweite Parteien wieder zueinander finden und Frieden schließen.
Es geht um das Vergnügen, Frieden zu schließen!
Sie gehört zu den vielen spirituellen Wegweisern, welche die indigenen Völker auf unserer bejammernswerten Erde aufstellen könnten. Nehmen wir diese Hinweise an. Und nutzen wir die technischen Errungenschaften im Geiste einer neuen Ökosophie. Es macht Spaß, die Welt zum Besseren zu wenden! Die Menschen werden die gemeinsame Anstrengung lieben, sie werden es lieben, auf ihrer beschmutzten Erde aufzuräumen und sich neu und gerecht einzurichten in der heiligen Schöpfung. Mauruuru roa ... Ich danke Ihnen.“
„Auu!!“, schrie Cording, als Rauura ihm just in diesem Augenblick den letzten Stich versetzte. Die Tahitianer klatschten begeistert Beifall, aber so vermessen, den stürmischen Applaus auf seine Tapferkeit zu beziehen, war er nun doch nicht. Er lag keuchend auf der Matte, das Blut troff ihm von der Haut, er war bedient, aber das schöne Gefühl, wenn der Schmerz nachlässt, wollte sich nicht einstellen.
Maeva streichelte ihm liebevoll über die verschwitzten Haare.
„Liebst du mich?“, fragte sie leise.
„Oia.“
„Liebst du mich wirklich?
„Oia.“
„Wirst du mich lieben, solange ich lebe?“
„Aita!“
Sie erschrak.
„Solange ich lebe!“, flüsterte Cording ihr ins Ohr.
„Gut!“, antwortete sie so laut, dass jeder es hören konnte. „Dann gehen wir morgen ins Tal des Papenoo. Du bist uns noch einen dicken schweren Stein schuldig!“
Cording hatte gar nicht gewusst, wie hämisch und gemein das Volk lachen konnte, dem er nun angehörte ...
Zwei Monate nach Omais Auftritt vor der UN-Vollversammlung trafen die Abgeordneten der vier neu gegründeten Parlamente für Politik, Wirtschaft, Kultur- und Grundwerte zu einem Festakt in Papeete zusammen. Die Volksvertreter trafen sich um sechs Uhr morgens auf Moto Uta, der vorgelagerten und mit der Stadt durch einen Damm verbundenen Insel, die in den letzten Jahren von einem gigantischen Rohöldepot in eine blühende Parklandschaft verwandelt worden war.
Als die ersten Sonnenstrahlen über dem Horizont aufblitzten, enthüllte Tahitis Präsident einen Gedenkstein, dessen Errichtung zuvor von allen vier Parlamenten gefordert und beschlossen worden war. „In Erinnerung an Professor Thorwald Rasmussen, einem großen Freund unseres Volkes. Die Menschen auf Tahiti und in ganz Polynesien danken dir“, lautete die Inschrift auf dem mannshohen schwarzen Lavabrocken, der Richtung Makatea ausgerichtet war.
Cording, der die Zeremonie an Maevas Seite aus dem Hintergrund beobachtete, bewunderte einmal mehr die Fähigkeit der Tahitianer, mit schwierigen Situationen angemessen umzugehen. Da es noch immer keine Informationen über den Verbleib des dänischen Wissenschaftlers gab, musste man dessen Tod zumindest in Betracht ziehen.
So bewegte sich die Veranstaltung auf dem schmalen Grat zwischen Euphorie und Trauer, zwischen Lob- und Abgesang. Genau aus diesem Grunde hatten sich die Parlamentarier darauf geeinigt, die obligate Ansprache und die üblichen Musik- und Tanzdarbietungen auszusparen. Man verzichtete an diesem Morgen sogar auf die Anwesenheit eines größeren Publikums. So wurde mit dem Gedenkstein auch ein Moment der Stille enthüllt, in dem sich die Dankbarkeit der Volksvertreter eindrucksvoll mit der Sorge um das Schicksal Thorwald Rasmussens verband.
Cording empfand die schlichte Ehrung, die von keiner Kamera dokumentiert wurde, als angemessen. Die Bewohner Tahitis, die Moto Uta längst zu ihrem bevorzugten Freizeitdomizil erkoren hatten, würden jeder für sich noch genügend Gelegenheiten haben, an dieser Stelle eines Mannes zu gedenken, dessen brisante Informationen den friedlichen polynesischen Widerstand erst ermöglicht hatten. Letztlich war es diesem mutigen und tragischem Kauz aus Kopenhagen zu verdanken, dachte Cording, dass dem Tahiti-Projekt heute ein weltweiter Bonus an Sympathie entgegen gebracht wurde ...
Nachdem sich die Versammlung der Abgeordneten aufgelöst hatte, schlug Maeva vor, die Insel barfuß am Strand zu umlaufen. Schweigend setzten sie ihre Füße in den schwarzen Sand, über deren Abdrücke sich ein Reinigungskommando aus schäumenden Wellen hermachte. Cording, der vor wenigen Wochen dem Rat Maevas gefolgt war, sich für einige Zeit dem Informationsfluss der Medien zu entziehen, um seinen Kopf „zu durchlüften“, wurde von Steve per E-Mail dennoch mit dem Nötigsten versorgt.
Der Junge war nach London zurückgekehrt, wo er eine Ausbildung zum Verlagskaufmann begonnen hatte, die ihn eines Tages ganz nach oben bringen könnte in der Matlock Media Corporation. Besonders bemerkenswert unter Steves gesammelten Nachrichten fand Cording einen Kommentar des guten alten John Knowles in der Washington Post, der Amerika schlicht dazu aufgefordert hatte, sich neu zu definieren. Eine Reaktion auf die Wahlniederlage von Ex-Präsident Brandon Selby, der im Rennen um den Gouverneursposten von Montana knapp unterlegen war.
Cording nahm Maeva in den Arm.
„Weißt du, was passiert ist?“, fragte er und sah sie grinsend von der Seite an. „Steve hat mir heute Nacht gemailt, dass der Präsident von Global Oil zurück getreten ist! Robert McEwen, du weißt schon, wen ich meine ...“
„Ich weiß“, antwortete Maeva lächelnd, „ich wollte es dir schon gestern sagen. Aber kennst du auch den Grund für seinen Rücktritt?“
„Der Grund liegt doch auf der Hand: illegaler Raubbau in fremden Hoheitsgewässern, Bestechung von Regierungsmitgliedern etc, etc.“
Maeva schüttelte den Kopf.
„Warum sollte der Mann wohl sonst zurücktreten sein?“, fragte Cording ein wenig irritiert.
„Aus dem einzigen Grund, der heute noch zählt“, gab Maeva zur Antwort: „weil die Börse nicht mehr mitspielt. Seit dem Desaster vor Makatea erlebte die Global Oil-Aktie einen dramatischen Kursverfall, inzwischen hat sie einen nicht für möglich gehaltenen Tiefstand erreicht.“
„Kaufen!“, schrie Cording.
„Kaufen, kaufen, kaufen!“, wiederholte Maeva kreischend.
Sie blieben stehen und blickten sich in die Augen, bis sie vor Lachen nicht mehr an sich halten konnten. Der Sand, in den sie sich eng umschlungen fallen ließen, war von der aufsteigenden Sonne bereits vorgewärmt worden ...
ENDE
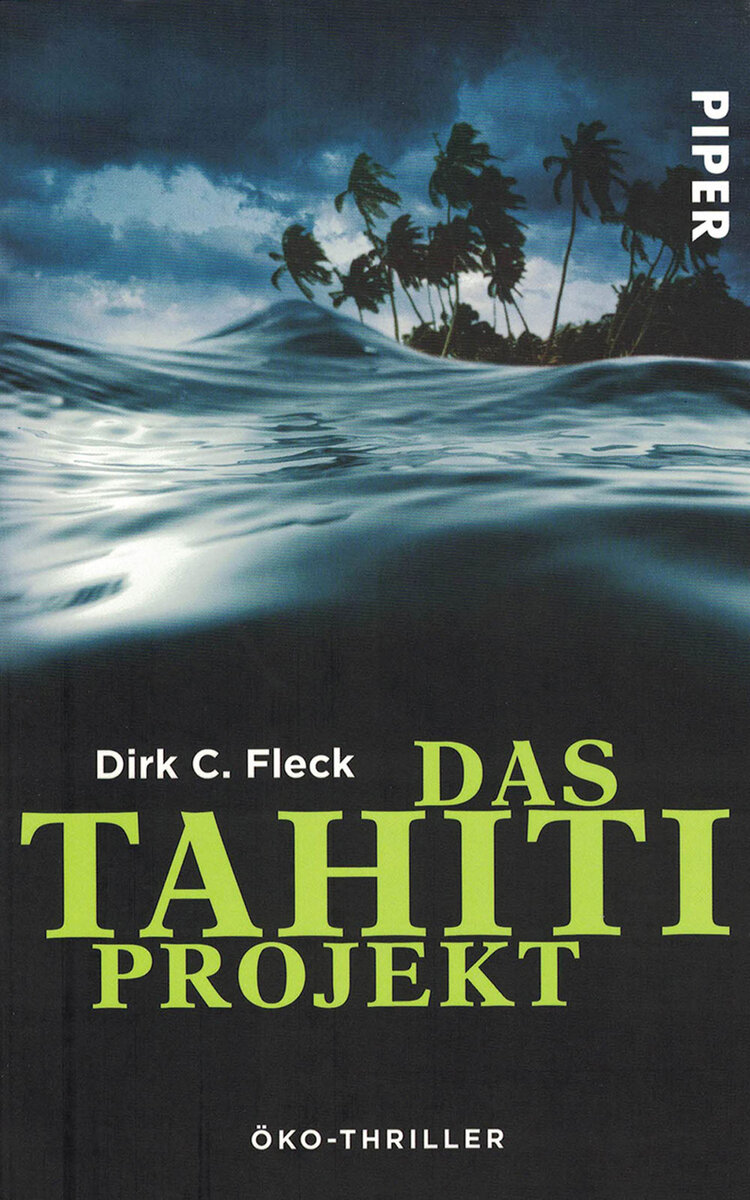
Hier können Sie das Buch bestellen: equilibrismus.org

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
*Die Erklärungen der im Roman verwendeten Fachbegriffe sowie Hinweise für interessierte Leser auf weiterführende Literatur oder Webseiten befinden sich im Buch. Obwohl das „Tahiti-Projekt“ ein Zukunftsroman ist, sind die in ihm dargestellten technischen Lösungen und sozioökologischen Modelle keine Fiktion: sie existieren bereits heute! Das einzig Fiktive ist die Annahme, dass irgendwo auf diesem Planeten tatsächlich mit konkreten Veränderungen in Richtung auf eine zukunftsfähige Lebensweise begonnen wurde.