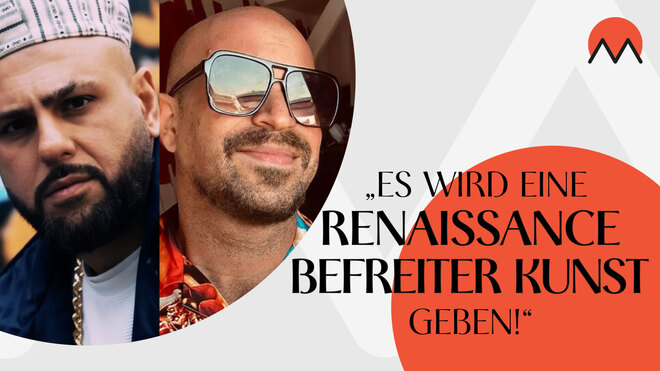Kinderarbeit — Die kleinen Hände der großen Weltwirtschaft
Weltweite Realität: Kinder schuften für unser Leben
Es beginnt in der Dunkelheit. Nicht mit einer metaphorischen, sondern ganz konkreten Finsternis: tief unten in der Erde, wohin kein Lichtstrahl mehr dringt. In den Minen des Kongo, wo Kinder mit bloßen Händen Gestein abtragen, auf der Suche nach Kobalt, dem blauen Gold der modernen Welt. Dieser Rohstoff steckt in den Akkus unserer Smartphones, Laptops und Elektroautos. Vielleicht ein Segen für die Energiewende, auf jeden Fall aber ein Fluch für die Kinder, die ihn unter Lebensgefahr fördern. Manche sind acht Jahre alt, andere jünger. Ihre Lungen füllen sich mit Staub, ihre Körper beugen sich unter dem Gewicht gefüllter Säcke, ihre Namen kennt niemand. Ihre Kindheit wird weggesprengt — im Takt des Fortschritts.
Kinderarbeit ist kein Unrecht der Vergangenheit. Sie ist globaler Alltag. Laut den Statistiken der Organisation des Statistischen Bundesamts „Internationale Arbeitsorganisation-Arbeitsmarktstatistik (ILO)“ arbeiten weltweit heute rund 160 Millionen Kinder — eines von zehn Kindern. Davon sind 79 Millionen in ausbeuterischen, gesundheitsgefährdenden oder versklavenden Verhältnissen tätig. Und während wir in Europa Bio-Avocados auf dem Wochenmarkt kaufen, arbeiten Kinder in Asien, Afrika und Lateinamerika bis zu zwölf Stunden täglich, um unsere Produkte billig und pünktlich verfügbar zu machen.
Die Realität ist grotesk: Während das westliche Bildungsbürgertum über Helikoptereltern und Schulstress diskutiert, erleben Millionen Kinder auf anderen Kontinenten, was es heißt, wirklich keine Kindheit zu haben: keine Schule, kein Spiel, keinen Schutz — dafür Zwang, Gewalt und Hoffnungslosigkeit.
Die Formen der Kinderarbeit sind vielfältig: Auf Plantagen ernten sie Kakao, Baumwolle oder Kaffee. In Werkstätten nähen sie Kleidung oder Teppiche. In Ziegeleien, Müllhalden und Goldminen arbeiten sie unter gefährlichsten Bedingungen. Sie tragen Baumaterial, bedienen Maschinen, sortieren Elektroschrott. Manche werden Opfer von Menschenhandel, müssen als Haushaltssklaven schuften oder enden in der Zwangsprostitution.
Die Ursachen sind komplex. Armut ist die zentrale Triebfeder. Wenn Eltern selbst keine Arbeit finden, wenn soziale Sicherungssysteme fehlen und Schulbesuch Geld kostet, bleibt oft nur der Griff nach der „helfenden Hand“ des eigenen Kindes. In vielen Ländern wird Kinderarbeit auch kulturell legitimiert: als Pflicht, als Normalität, als Notwendigkeit zum Überleben. Staatliche Kontrollen fehlen, Gesetze existieren nur auf dem Papier. Internationale Konzerne profitieren, indem sie entlang langer und undurchsichtiger Lieferketten Verantwortung abstreifen. Am Ende sehen wir: nichts. Wir kaufen, klicken, konsumieren — und bleiben sauber.
Unter Tage, unterbezahlt, unter aller Würde: Minenarbeit
Die Geschichte der Kinderarbeit beginnt oft unter Tage, in den staubigen Tiefen der Erde, wo Kinder als billige Rohstoffbeschaffer eingesetzt werden. Das bekannteste Beispiel ist die Demokratische Republik Kongo. In diesem krisengeschüttelten Land schuften täglich Tausende Kinder in Minen, die von mafiösen Strukturen kontrolliert werden. Der Rohstoff: Kobalt, essenziell für Lithium-Ionen-Akkus. Die Arbeitsbedingungen: katastrophal. Die Kinder kriechen in enge Stollen, tragen schwere Lasten, arbeiten unter der ständigen Gefahr von Einstürzen. Atemmasken, Helme oder Sicherheitsvorkehrungen? Fehlanzeige. Und doch läuft der globale Techmarkt wie geschmiert — mit ihrer Hilfe.
Ein ähnliches Bild zeigt sich in den Goldminen von Burkina Faso oder Tansania. Kinder zermalmen Gestein, waschen es mit Quecksilber, um das Gold zu extrahieren. Quecksilber, ein Nervengift, das bleibende Schäden verursacht, besonders bei Kindern. Und all das für ein paar Dollar, die oft nicht einmal ausgezahlt werden, weil Mittelsmänner die Löhne einbehalten. Wer sich wehrt, verliert die Arbeit. Wer krank wird, stirbt im Stillen.
Auch in Myanmar, Indonesien oder Bolivien sind Kinder unter Tage im Einsatz. Sie arbeiten in Zinnminen, in denen der Rohstoff für Lötverbindungen gewonnen wird, wiederum ein essenzieller Bestandteil moderner Elektronik. Die Ironie: Die Produkte, für deren Bestandteile sie ihr Leben riskieren, könnten ihnen Bildung bringen — wären sie auf der anderen Seite der Welt geboren.
Und auch in Kolumbien, Peru und Brasilien sieht man Kinder in dunklen Minen verschwinden. Viele dieser Regionen sind von paramilitärischen Gruppen kontrolliert, die Kinderarbeit nicht nur dulden, sondern vielmehr systematisch einsetzen.
Wer sich dem verweigert, wird zur Zielscheibe. Kinderarbeit ist dort kein Zufall, sondern Geschäftsmodell. Die globalen Käufer schweigen. Zu lang sind die Ketten, zu verschleiert die Wege, zu groß der Gewinn.
Gewebte Armut: Kinder in der Textil- und Kakaoindustrie
In Bangladesch und Indien beginnt der Arbeitstag vieler Kinder vor Sonnenaufgang. In stickigen Hallen ohne Fenster, zwischen Nähmaschinen, Fäden und Baumwollstaub. Sie arbeiten für Modeketten, die im Westen mit Nachhaltigkeit werben und trotzdem T-Shirts für fünf Euro anbieten. Die Wahrheit: Kinder nähen, sticken, schneiden, falten — für Centbeträge. Viele schlafen sogar in den Fabriken. Sie sind eingesperrt, werden kontrolliert, geschlagen, wenn sie zu langsam arbeiten oder Fehler machen.
Ein besonders perfides System ist das sogenannte „Sumangali-System“ in Südindien. Hier werden junge Mädchen aus armen Familien mit dem Versprechen auf Ausbildung und spätere Mitgift in Textilbetriebe gelockt. Die Realität: drei Jahre Zwangsarbeit, schlechte Ernährung, keine medizinische Versorgung und am Ende oft keine Auszahlung des Lohns. Die Mädchen gelten als „verbraucht“, bevor sie volljährig sind.
In Ghana und der Elfenbeinküste zeigt sich ein anderes Bild, aber mit ähnlichem Kern: Kinderarbeit auf Kakaoplantagen. Rund zwei Millionen Kinder arbeiten dort, viele barfuß, mit Macheten, unter Einsatz von Pestiziden. Sie schleppen schwere Säcke, schlafen auf dem Feld, haben keinen Zugang zu Bildung. Das Ziel: möglichst günstige Kakaopreise für internationale Konzerne. Unternehmen wie Nestlé, Mars oder Ferrero betonen ihre Nachhaltigkeitsprogramme, doch unabhängige Studien zeigen: Kinderarbeit ist immer noch tief in der Lieferkette verankert.
Der Widerspruch ist kaum zu fassen: Kinder der Welt verlieren ihre Zukunft, damit westliche Kinder bunte Schokolade in der Pausenbox haben.
Und obwohl es Gütesiegel gibt, fehlt es an glaubwürdiger Kontrolle. Viele Labels basieren auf freiwilliger Selbstverpflichtung. Die Kontrollen sind angekündigt, die Sanktionen schwach, die Transparenz mangelhaft. Der Eindruck: Die Labels dienen oft mehr dem Image als der Veränderung. Ein bequemes Alibi in einer unbequemen Realität.
Müllkinder und die Schattenseiten des Konsums
Während in Deutschland alte Handys in Schubladen verstauben, landen Millionen Tonnen Elektroschrott jährlich in Afrika und Asien. Offiziell ist der Export defekter Geräte verboten, doch in der Praxis wird er oft durch Schlupflöcher umgangen: als „gebrauchte Ware“, als „Spende“, als „Entwicklungshilfe“. In Wirklichkeit handelt es sich um toxischen Müll.
In Ghana, speziell in Agbogbloshie bei Accra, leben und arbeiten Kinder auf einer der größten Müllhalden der Welt. Sie zerschlagen Fernseher, zerlegen PCs, verbrennen Kabel, um an Kupfer und andere Metalle zu kommen. Die Folge: Schwermetallvergiftung, Lungenschäden, Verbrennungen, schwere chronische Krankheiten. Die Lebenserwartung ist drastisch reduziert. Die Kinder dort sterben für unseren Recyclingkomfort.
In Indien sieht es nicht besser aus. Dort arbeiten Kinder auf Müllbergen in Delhi, Mumbai oder Kalkutta, viele mit bloßen Händen, oft barfuß. Sie suchen nach verwertbarem Plastik, Metall oder Glas. Verletzungen sind an der Tagesordnung. Gleichzeitig atmen sie Gase aus faulendem Müll, atmen den Gestank von Weggeworfenem, von Dingen, die andere nicht mehr wollten und die tödlich sind.
Auch Länder wie Pakistan, Indonesien oder die Philippinen dienen als Endlager für unseren Wohlstandsmüll. Besonders tragisch: Manche dieser Kinder essen auf den Müllbergen, weil es dort manchmal Essensreste gibt.
Die Unsichtbarkeit dieser Kinder ist systemisch. Sie leben außerhalb jeder Statistik. Sie existieren nur, weil sie nützlich sind. Doch sobald sie krank oder verletzt sind, verschwinden sie aus dem System. Ersatz gibt es genug.
Verlorene Kindheit in der Landwirtschaft — vom Feld in den Exportcontainer
Nicht nur Minen, Fabriken oder Müllberge fordern den Tribut der Kindheit, auch auf zahllosen Feldern, wo unsere Nahrung wächst, schuften Millionen Kinder. In der Landwirtschaft ist Kinderarbeit besonders verbreitet, weil sie schwerer zu kontrollieren ist. Kein Produktionsband, keine Adresse, nur endlose Felder unter sengender Sonne, irgendwo im globalen Süden.
In Ländern wie Indien, Äthiopien, Pakistan, Nigeria oder Indonesien sind Millionen Kinder auf Reis-, Tee-, Zuckerrohr-, Kaffee- oder Baumwollfeldern beschäftigt. In Lateinamerika sieht man sie auf Bananenplantagen, in Südafrika beim Zitrusfrüchtepflücken. Die Arbeit beginnt oft mit Sonnenaufgang. Die Kinder tragen Wasser, setzen Pflanzensetzlinge, bedienen Spritzmittel, pflücken Früchte, viele davon giftig oder schwer zu handhaben.
Die Belastung ist physisch extrem: Kinder schleppen Körbe, tragen schwere Ernten, werden von Insekten gestochen oder durch Pestizide krank. Eine medizinische Versorgung ist meist nicht vorhanden. Arbeitsrechte? Ein Fremdwort. Die meisten dieser Kinder haben nie eine Schule besucht. Die Saison bestimmt ihr Leben und der Export ihre Zukunft.
Ein besonders erschütterndes Beispiel sind Baumwollfelder in Usbekistan. Noch bis vor wenigen Jahren war dort staatlich verordnete Zwangsarbeit von Kindern an der Tagesordnung. Schulklassen wurden geschlossen, um ganze Dörfer zur Ernte zu kommandieren. Kinder, Lehrer, Ärztinnen — alle mussten pflücken. Erst durch massiven internationalen Druck kam es zu Reformen, doch Berichte zeigen, dass Kinderarbeit in ländlichen Regionen weiter existiert — versteckt, unkontrolliert, normalisiert.
Auch in Mexiko arbeiten Kinder in der Ernte von Avocados, Chilis oder Tomaten, Lebensmitteln, die für die USA und Europa bestimmt sind. In Guatemala helfen Kinder beim Schneiden von Zuckerrohr, oft mit der Machete, oft mit Verletzungen. Und in Brasilien, dem größten Exporteur für Orangen, sind Kinder Teil der „orangen Kette“, die viele Jahre später als Orangensaft auf deutschen Frühstückstischen landet.
Die Landwirtschaft ist oft unsichtbar, aber brutal. Denn sie kombiniert Armut, familiären Druck und fehlende Alternativen.
Die Kinder arbeiten mit ihren Eltern — oder statt ihrer. Und jedes Kind, das auf einem Feld arbeitet, ist ein Kind, das nicht in der Schule sitzt. Es ist ein Kind, das in der globalen Nahrungskette verzehrt wird — bevor es selbst überhaupt eine Chance hatte, satt zu werden.
Kindersklaverei und systemische Gleichgültigkeit
Noch schlimmer als Ausbeutung durch Armut ist die systematische Versklavung von Kindern. In vielen Regionen, vor allem in Westafrika, Südasien und Teilen Südamerikas, sind Kinderhandel, Schuldknechtschaft und häusliche Zwangsarbeit bittere Realität.
Ein besonders erschütternder Fall ist die sogenannte „Restavèk“-Tradition in Haiti. Dort geben arme Familien ihre Kinder an wohlhabendere Haushalte in der Hoffnung, dass sie dort Bildung und Unterkunft erhalten. Doch in der Realität leben viele dieser Kinder als Haussklaven — ohne Rechte, ohne Schulbesuch, unter permanenter Kontrolle. Sie arbeiten, essen separat, werden geschlagen, häufig sexuell missbraucht. Niemand schützt sie. Denn es ist ein „offenes Geheimnis“, das als kulturell verankert gilt.
In Indien und Pakistan existiert noch immer die Praxis der „Bonded Labour“: Kinder werden als Schuldenpfand in Ziegeleien oder Werkstätten verkauft. Die Eltern erhalten eine kleine Summe — oft nur ein Darlehen —, und das Kind arbeitet den Betrag über Jahre ab. Die Schulden wachsen. Das Kind altert. Die Freiheit bleibt eine Illusion. Viele dieser Kinder werden nie entlassen. Es sei denn, sie fliehen — oder sterben.
Auch in Ghana und Benin existiert der sogenannte „Kinderfischfang“ am Volta-Stausee. Kinder werden auf Fischereiboote geschickt, müssen Netze werfen, Tauarbeiten durchführen und erleiden häufig schwere Verletzungen. Einige ertrinken. Die Fischer behaupten, die Kinder seien „freiwillig“ da, doch Recherchen zeigen: Viele wurden verkauft, verschenkt oder aus Verzweiflung abgegeben.
Sexuelle Ausbeutung ist ein weiteres Tabu. Laut UNICEF und ECPAT sind weltweit Hunderttausende Kinder in der Sexindustrie gefangen, viele davon in Thailand, auf den Philippinen, in Kolumbien oder Osteuropa. Es ist eine Industrie, die auf Menschenverachtung basiert — und auf Nachfrage aus dem Westen. Sextourismus, Online-Ausbeutung, Menschenhandel: Kinder werden zu Ware. Und während sich Gesetze verschärfen, bleiben viele Täter ungestraft oder fliehen in rechtliche Grauzonen.
Diese Formen der Kinderarbeit sind nicht nur illegal — sie sind ein moralischer Abgrund. Und sie existieren nicht im Verborgenen, sondern neben uns, digital vermittelt, ökonomisch gestützt und politisch geduldet.
Die Verantwortung der Weltgesellschaft
Es ist bequem, wegzusehen. Es ist einfach, sich auf Etiketten zu verlassen, auf Werbespots, auf CSR-Berichte. Doch Kinderarbeit existiert nicht trotz unserer Weltordnung — sie ist Teil von ihr. Die Weltwirtschaft verlangt niedrige Produktionskosten, kurze Lieferzeiten und maximale Flexibilität. In diesem System sind Kinder perfekte Arbeitskräfte: billig, fügsam, ersetzbar.
Doch sie sind keine Arbeiter — sie sind Kinder. Und wir müssen uns fragen: Was ist ein günstiges T-Shirt wert, wenn ein Kind dafür krank, verletzt oder gebrochen wurde? Was ist ein Smartphone wert, wenn es aus den Händen eines Jungen stammt, der nie zur Schule gehen durfte?
Politisch wird das Thema oft mit moralischer Empörung, aber wenig Konsequenz behandelt. Lieferkettengesetze sind zahnlos, wenn sie nicht global durchsetzbar sind. Sanktionen verlaufen im Sand.
Wirtschaftliche Interessen überwiegen. Und währenddessen wächst eine Generation von Kindern auf, deren Zukunft schon verbraucht ist, bevor sie eine Chance hatte.
Auch wir als Konsumenten tragen Verantwortung. Jeder Einkauf ist ein Stimmzettel. Jeder Klick ein Auftrag. Wer billig kauft, bezahlt mit der Zukunft anderer. Und wer schweigt, stimmt zu. Die Wahrheit ist unbequem, aber notwendig: Es gibt keine saubere Lieferkette ohne echte Transparenz, keine Verantwortung ohne Konsequenz, keine Kindheit ohne Schutz.
Was tun? Überfällige Lösungen in einer tauben Welt
Die Frage, die sich nach all dem Schrecken stellt: Was tun? Gibt es Hoffnung? Können wir etwas ändern? Die Antwort lautet: Ja — wenn der Wille da ist. Und wenn der Druck groß genug wird.
Politisch braucht es verpflichtende, globale Lieferkettengesetze mit unabhängigen Kontrollen, Sanktionen bei Verstößen und einer klaren Haftung für Konzerne — nicht nur auf dem Papier. Denn solange Unternehmen sich hinter Zwischenhändlern und Unterfirmen verstecken können, bleibt Verantwortung ein leeres Wort.
Wirtschaftlich braucht es faire Preise für Rohstoffe und landwirtschaftliche Produkte, damit Produzentenfamilien nicht mehr gezwungen sind, Kinder arbeiten zu lassen. Der Druck auf Unternehmen muss wachsen, echte Transparenz herzustellen — und nicht in CSR-Hochglanzbroschüren zu investieren, sondern in menschenwürdige Arbeitsbedingungen.
Gesellschaftlich müssen wir aufhören, das Thema zu tabuisieren. Kinderarbeit ist kein Problem der „anderen Welt“, sondern auch eine Folge unseres Konsums. Jeder von uns kann bewusster einkaufen, nachfragen, verweigern, aufklären. Das klingt klein — ist aber groß, wenn es viele tun.
Bildung ist der Schlüssel: Je mehr Kinder Zugang zu kostenfreier, hochwertiger Schulbildung haben, desto geringer ist das Risiko, dass sie arbeiten müssen. Hilfsorganisationen weltweit versuchen das, doch ihnen fehlt es oft an Unterstützung, während Banken und Konzerne Milliardengewinne machen.
Medial braucht es mehr Berichterstattung, mehr Filme, mehr Bücher, mehr Essays wie diesen. Denn was nicht sichtbar ist, existiert für viele nicht. Sichtbarkeit schafft Druck. Und Druck schafft Veränderung. Auch das Schreiben ist ein politischer Akt.
Moral
Kinderarbeit ist nicht nur ein soziales Problem, sie ist eine moralische Anklage, gerichtet gegen uns alle. Sie zeigt, dass die Weltgemeinschaft ihre Schwächsten im Stich lässt, während sie den Wohlstand der Starken mehrt. Millionen Kinder schuften in Minen, auf Feldern, in Fabriken und auf Müllbergen — nicht, weil sie wollen, sondern weil das System es verlangt. Sie arbeiten, damit wir konsumieren können. Sie zahlen mit ihrer Kindheit, damit wir mit Rabatten prahlen können.
Die Verantwortung liegt auf vielen Schultern. Auf korrupten Regierungen, die Gesetze ignorieren. Auf Konzernen, die Profit über Menschlichkeit stellen. Auf Konsumenten, die billig kaufen und teure Wahrheiten verdrängen. Kinderarbeit ist kein Unfall, sie ist eingeplant. Sie ist eine systemische Stütze der globalen Lieferketten, ein unsichtbarer Kostenfaktor, der aus Fleisch und Blut besteht.
Doch diese Erkenntnis darf nicht lähmen, sie muss handeln lassen. Es braucht politische Gesetze, die durchgreifen, ökonomische Regeln, die fair sind, gesellschaftliche Aufklärung, die nicht schweigt. Jeder kann Teil dieser Veränderung sein: durch bewussten Konsum, durch das Einfordern von Transparenz, durch Spenden, Engagement und vor allem durch das Hinschauen.
Die Moral ist klar: Eine Welt, die Kinder schuften lässt, verrät ihre Zukunft. Kindheit darf kein Rohstoff sein, den man verbrennt. Menschlichkeit beginnt mit dem Schutz der Schwächsten. Und sie endet dort, wo wir uns abwenden.
Wie viele billige T-Shirts, wie viele glänzende Smartphones, wie viele süße Schokoladentafeln sind uns die Tränen eines Kindes wert? Die Antwort liegt nicht in den Fabriken dieser Welt — sie liegt in uns.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
danke, dass Sie diesen langen und schweren Text gelesen haben. Vielleicht ist er unbequem, vielleicht schmerzt er — aber genau das sollte er. Kinderarbeit ist ein Verbrechen, das nur deshalb weiter existiert, weil wir es zulassen. Weil wir wegschauen, weil wir uns betäuben, weil wir glauben, nichts ändern zu können.
Doch das stimmt nicht. Jeder bewusste Kauf, jede Nachfrage, jedes Gespräch kann Teil einer Bewegung sein. Teil einer Welt, die Kindheit schützt, statt sie zu zerstören.
Bitte vergessen Sie nicht: Hinter jedem Produkt könnte ein Kind stehen, das heute nicht zur Schule durfte. Wir können das nicht ungeschehen machen — aber wir können verhindern, dass es morgen so weitergeht.
Bitte bleiben Sie aufmerksam!
Bitte bleiben Sie menschlich!
Kinder sind unsere Zukunft, heißt es so oft. Doch was, wenn diese Zukunft systematisch zerstört wird — durch Ausbeutung, Gewalt, Krieg, Flucht, Hunger oder Ignoranz? Unsere Beitragsreihe „Gestohlene Kindheit — Die Schattenseiten unserer Welt“ richtet den Blick auf jene Lebensrealitäten, die meist nur als Randnotiz erscheinen — wenn überhaupt. Die Reihe ist ein literarisch-journalistisches Projekt zwischen Recherche, Essayistik und moralischer Anklage. Sie behandelt Themen, die nicht bequem sind, nicht populär und oft nicht medienwirksam genug, um Schlagzeilen zu machen. Dabei berühren diese Themen das Fundament jeder Gesellschaft: den Umgang mit ihren jüngsten, schwächsten Mitgliedern.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
International Labour Organization (ILO):
„Child Labour — Global Estimates 2020: Trends and the Road Forward“
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_797515
UNICEF:
„Children in Hazardous Work — What we know, what we need to do“ (2021)
https://www.unicef.org/reports/children-hazardous-work
Amnesty International:
„This is what we die for: Human Rights Abuses in the Democratic Republic of the Congo Power the Global Trade in Cobalt“ (2016)
https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/3183/2016/en/
Human Rights Watch Reports (2018—2023):
Diverse Länderberichte zu Kinderarbeit in Ghana, Bangladesch, Elfenbeinküste, Indien
https://www.hrw.org/topic/childrens-rights/child-labor
Südwind-Institut:
„Kakao und Kinderarbeit — eine Bilanz“ (2020)
https://www.suedwind-institut.de
Clean Clothes Campaign:
Factsheets zur Kinderarbeit in der Textilproduktion
https://cleanclothes.org
World Vision Deutschland e. V.:
„Kinderarbeit weltweit — Ursachen, Formen, Perspektiven“ (2022)
https://www.worldvision.de/themen/kinderarbeit
Global March Against Child Labour:
Berichte und Kampagnen
https://globalmarch.org
The Guardian*:
Artikelserie zu Elektroschrott-Deponien und Kinderarbeit in Ghana (2019)
https://www.theguardian.com/global-development/2019/jan/15/ghana-toxic-electronic-waste-dump
FAIRTRADE International:
Selbstberichte und kritische Analysen zur Wirksamkeit der Standards im Bereich Kinderarbeit
https://www.fairtrade.net