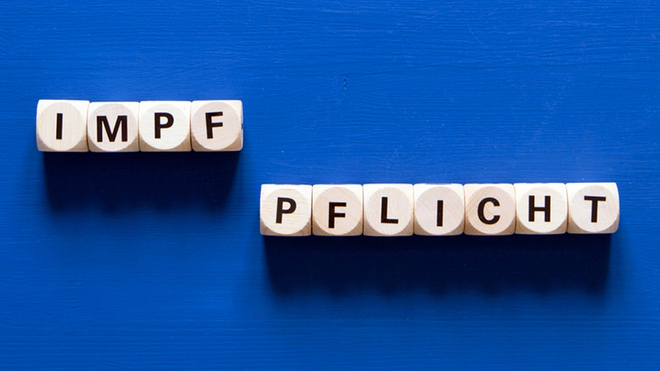Deutschland, jahrzehntelang Synonym für automobile Ingenieurskunst, steht am Abgrund eines Strukturbruchs, den die Politik mutwillig beschleunigt hat. Während China längst ganze Wertschöpfungsketten vom Rohstoff bis zur Batterie kontrolliert, diskutiert man hierzulande über Förderstopps, Ladepunkte und moralische Signale. Die Autoindustrie, die einmal stolz und eigenständig war, wird Stück für Stück in Abhängigkeiten gedrängt, die kaum noch rückgängig zu machen sind. Der verspätete Einstieg in die Elektromobilität, die kopflose Subventionspolitik und die planlose Bürokratie haben ein System geschaffen, das nach außen modern wirkt, aber im Inneren bröckelt.
Die Realität ist schlicht: China ist uns weit voraus. Die chinesische Regierung hat früh erkannt, dass Elektromobilität nicht nur eine ökologische, sondern eine geopolitische Frage ist. Subventionen, Rohstoffsicherung, Patente, Batterietechnologie — alles wurde strategisch aufeinander abgestimmt. BYD, NIO, XPeng oder SAIC produzieren inzwischen zu Preisen, bei denen deutsche Hersteller nur noch staunen können. Während in Deutschland eine halbe Milliarde Euro in Förderprogramme und Forschungsgelder fließt, rollen aus chinesischen Fabriken Autos, die technisch konkurrenzfähig sind und zum halben Preis verkauft werden. Und sie kommen auf die europäischen Märkte, in die deutschen Autohäuser, mit aggressivem Marketing und staatlichem Rückenwind.
Die EU versucht, mit Zöllen zu bremsen, doch das ist so, als würde man mit einem Eimer Wasser einen Waldbrand löschen wollen. Jeder Zoll ruft Gegenzölle hervor, und Deutschland, Exportnation Nummer eins, wird dabei am meisten verlieren. Es droht ein Handelskrieg, den Europa nicht gewinnen kann, weil die Wertschöpfung längst über die eigenen Grenzen hinaus diffundiert ist.
Dabei waren die Anzeichen alle da. Studien warnen seit Jahren, dass die Produktion von Elektroautos weniger Arbeitskräfte braucht, weniger Teile, weniger Komplexität, mehr Automatisierung. Die Umstellung auf Elektromotoren bedeutet das Ende ganzer Industriezweige: Kolben, Getriebe, Einspritzsysteme, Abgastechnik — alles über Jahrzehnte perfektioniert und jetzt über Nacht überflüssig. Laut dem Schweizer Wirtschaftsforschungs- und Beratungsunternehmen Prognos gehen bis 2035 fast 200.000 Arbeitsplätze in Deutschland verloren, Tendenz steigend. Bosch streicht 13.000 Stellen, Continental baut ab, Zulieferer aus Baden-Württemberg und Bayern schließen Standorte.
Offiziell nennt man das „Strukturwandel“, in Wahrheit ist es der Abbau einer der letzten industriellen Kernkompetenzen dieses Landes. Und während Politiker in Pressekonferenzen von neuen „Zukunftsarbeitsplätzen“ in der Batteriefertigung oder Softwareentwicklung schwärmen, wissen die Betroffenen längst: Das sind andere Jobs, mit anderen Anforderungen, an anderen Orten. Der 50-jährige Werkzeugmacher aus Sindelfingen wird kein Data-Scientist, nur weil man es ihm in einem Ministeriumspapier verspricht.
Besonders zynisch ist, dass dieser Umbau nicht nur Arbeitsplätze vernichtet, sondern auch noch von den Steuerzahlern finanziert wird. Die großen Hersteller lassen sich ihre Transformation mit Milliarden an Subventionen, Standortprämien und Forschungsgeldern vergolden. Jede neue Batteriefabrik wird als nationaler Triumph gefeiert, auch wenn die Technologie aus China stammt und die Rohstoffe aus Afrika. Es ist ein System, das Gewinne privatisiert und Risiken vergesellschaftet. Die Fördergelder stammen aus den Taschen jener Menschen, die am Ende entlassen werden, weil ihre Arbeit angeblich „nicht mehr gebraucht“ wird. Die Industrie nutzt den Umbruch als perfekte Gelegenheit, ihre Prozesse vollautomatisch umzubauen. Was früher 200 Arbeiter in drei Schichten erledigten, schafft heute ein Roboterpark im Dunkelbetrieb — effizient, billig, unbestechlich. Man nennt das „Industrie 4.0“, aber für viele Betroffene fühlt es sich eher nach „Existenz 0.0“ an.
Gleichzeitig hat der Staat mit seiner erratischen Förderpolitik zusätzliches Chaos angerichtet.
Der Umweltbonus wurde über Nacht gestrichen, gerade als der Markt Fahrt aufnahm. Die Folge: Neuzulassungen stürzten ein, Händler blieben auf Fahrzeugen sitzen, Verbraucher verloren das Vertrauen. Erst wurde mit Subventionen zum Kauf gedrängt, dann wurden sie zurückgezogen, als hätte man nie an das eigene Projekt geglaubt.
Diese Planlosigkeit hat nicht nur der Branche geschadet, sondern auch dem Image der E-Mobilität selbst. Viele Bürger sehen das Elektroauto längst nicht mehr als Fortschritt, sondern als Symbol politischer Bevormundung und ökonomischer Unvernunft.
Hinzu kommt die Frage, ob die ökologische Bilanz der E-Autos wirklich so makellos ist wie behauptet. Die Produktion der Batterien verschlingt enorme Mengen Energie und Rohstoffe, deren Förderung in Ländern wie Chile oder Kongo oft unter katastrophalen Bedingungen erfolgt. Recycling ist teuer, ineffizient und technisch nicht ausgereift. Und während man hierzulande stolz den CO₂-freien Stadtverkehr feiert, laufen die Kohlekraftwerke wieder auf Hochtouren, um die steigende Stromnachfrage zu decken. Eine ehrliche Klimabilanz würde viele Euphoriker schnell auf den Boden der Realität holen.
Auch ökonomisch bröckelt das Narrativ vom „E-Wirtschaftswunder“. Die Autos sind schlicht zu teuer. Selbst Mittelklasse-Modelle liegen deutlich über dem, was ein Durchschnittsverdiener zahlen kann. Ohne Subventionen und Steuererleichterungen wäre der Markt längst kollabiert. Die Ladeinfrastruktur hinkt dem Bedarf hinterher, Schnellladesäulen sind Mangelware, Strompreise schwanken, Abrechnungssysteme sind ein Flickenteppich. Das Stromnetz selbst ist vielerorts überlastet; Netzbetreiber warnen, dass der gleichzeitige Ausbau von Wärmepumpen, E-Autos und erneuerbaren Energien kaum zu stemmen ist. Und wieder zahlt der Bürger: über Netzentgelte, höhere Strompreise, neue Umlagen.
Währenddessen inszenieren sich die Konzerne als Klimaretter und Innovatoren. Doch hinter den Werbeslogans laufen knallharte Umstrukturierungen. Werke werden geschlossen, Zulieferer aussortiert, Belegschaften ausgedünnt. Selbst Traditionsmarken wie VW, BMW oder Mercedes lagern Softwareentwicklung und Teilefertigung ins Ausland aus.
Kooperationen mit chinesischen Technologiekonzernen sind längst Realität; aus „strategischer Partnerschaft“ wird schleichende Abhängigkeit. Die Entscheidung, Produktionslinien in Asien zu betreiben, ist betriebswirtschaftlich nachvollziehbar, volkswirtschaftlich aber fatal. Deutschland riskiert, vom Technologieführer zum bloßen Fertigungsstandort zu werden, der den technologischen Mehrwert importiert, statt ihn selbst zu schaffen. Der Ingenieursstandort, einst Garant für Innovation, droht zur verlängerten Werkbank zu verkommen.
Noch absurder wird es, wenn man sich den politischen Umgang ansieht. Lobbyisten sitzen in den Ausschüssen, in den Ministerien und auf den Panels der Automessen. Dieselbe Industrie, die jahrzehntelang gegen strengere Abgasnormen kämpfte, diktiert heute die Bedingungen der E-Strategie. Man könnte meinen, Deutschland sei kein Rechtsstaat, sondern ein Industriekonsortium mit angeschlossener Regierung. Jede Kritik an der E-Mobilität wird reflexhaft als „rückwärtsgewandt“ diffamiert, als würde Zweifel schon Ketzerei bedeuten. Dabei ist Skepsis in einer Demokratie keine Bedrohung, sondern Pflicht, vor allem, wenn Milliarden an öffentlichen Geldern verteilt werden.
Auch sozial ist die Entwicklung brandgefährlich. Die Regionen, die am meisten von der Autoindustrie abhängen, sind oft jene, die wirtschaftlich ohnehin kämpfen. Wenn in Niedersachsen, Bayern oder Thüringen Werke schließen, betrifft das nicht nur Monteure, sondern ganze Lieferketten, Familien, Gemeinden. Gleichzeitig entstehen neue Arbeitsplätze in Ballungsräumen — München, Berlin, Stuttgart —, wo die Lebenshaltungskosten explodieren.
So entsteht eine neue soziale Spaltung: Hier die Hochqualifizierten in den urbanen Innovationszentren, dort die Zurückgelassenen in den Industrieregionen. Die „Transformation“ wird damit auch zur Klassenfrage.
Man könnte das alles noch korrigieren, wenn es den politischen Willen gäbe. Statt hektischer Förderstopps bräuchte es endlich eine langfristige, verlässliche Industriepolitik. Statt moralischer Appelle eine nüchterne Kosten-Nutzen-Bilanz. Statt blinder Zölle eine echte technologische Strategie, die Wettbewerbsfähigkeit stärkt, statt sie zu simulieren. Deutschland müsste Energiepreise senken, Genehmigungsverfahren vereinfachen, Infrastruktur massiv ausbauen und Forschung konsequent in der eigenen Hand halten. Doch dazu fehlt der Mut und vielleicht auch die Kompetenz. Zu oft wird Politik als PR-Show betrieben, nicht als Steuerung einer Industriegesellschaft.
Es wäre auch Zeit, den Dogmatismus zu beenden. Elektromobilität ist kein Selbstzweck. Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe, Hybrid- oder Brennstoffzellenlösungen — all das könnte parallel existieren, wenn man technologisch offen denken würde. Stattdessen zementiert man ein Monopol, das weder marktwirtschaftlich noch ökologisch nachhaltig ist. Und man gefährdet damit, was Deutschland einst groß gemacht hat: Vielfalt, Ingenieursgeist, Erfinderkultur.
Am Ende dieser Entwicklung könnte ein Land stehen, das zwar grüne Schlagzeilen produziert, aber rote Zahlen schreibt. Ein Land, das seine Industrie verschenkt, seine Arbeitsplätze verliert und sich selbst als „Innovationsstandort“ feiert, während andere längst die Gewinne einfahren. Wenn das der Preis der E-Mobilität ist, dann sollte man sich ehrlich fragen, wer hier eigentlich von Zukunft spricht — und wer nur noch auf Zeit spielt.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
VDA/Prognos: Jobverluste in der deutschen Automobilindustrie
„Between 2019 and 2023, circa 46.000 Arbeitsplätze seien bereits verloren gegangen, und bis 2035 könnten weitere rund 140.000 — insgesamt etwa 186.000 Arbeitsplätze — wegfallen.“
VDA-Pressemitteilung: “Employment in the automotive industry: Prognos study”.
Link: https://www.vda.de/en/press/press-releases/2024/241029_Prognos_study_on_regarding_Employment_in_the_automotive_industry
Reuters: Studie sieht bis 2035 bis zu 186.000 Jobverluste
„The transformation of the German car industry could lead to 186,000 jobs losses by 2035, of which roughly a quarter have already occurred.“
Artikel von Reuters, 29. Oktober 2024
Link: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/german-car-industry-transformation-could-cost-186000-jobs-by-2035-study-finds-2024-10-29/
Reuters: EU verhängt Zölle auf chinesische Elektroautos
„EU imposes tariffs on China-made EVs (…) to counter what it says are unfair subsidies …“
Artikel von Reuters, 30. Oktober 2024
Link: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/eu-slaps-tariffs-chinese-evs-risking-beijing-payback-2024-10-29/
Reuters: Chinesische Hersteller klagen vor dem EU-Gericht gegen Zölle
„Chinese electric vehicle manufacturers BYD, Geely, and SAIC have contested the European Union's import tariffs at the Court of Justice of the European Union (CJEU).“
Artikel von Reuters, 23. Januar 2025
Link: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinese-ev-makers-file-challenges-tariffs-eu-court-2025-01-23
Reuters: China reagiert — Gegenuntersuchungen gegen EU-Importe
„China’s commerce ministry has imposed anti-dumping measures on imports from the European Union … in response to EU tariffs on China-made EVs.“
Artikel von Reuters, 5. September 2025
Link: https://www.reuters.com/business/chinas-probes-eu-products-following-ev-tariffs-2025-09-05/
Prognos/VDA — Studiendetails zur Beschäftigungsstruktur
„If the trend between 2019 and 2023 continues until 2035, employment in the automotive industry in Germany will be almost 190,000 people lower than in 2019.“
Projektseite von Prognos (im Auftrag des VDA)
Link: https://www.prognos.com/en/project/automotive-industry-employment-changing