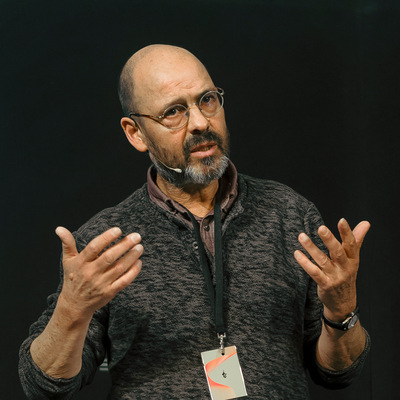„Liebe Betroffene, liebe Hinterbliebene von furchtbaren Anschlägen wie dem Breitscheidplatz-Anschlag in Berlin oder in der Arenabar in Hanau oder in der Synagoge in Halle!“
Als die Noch-Außenministerin Annalena Baerbock am 11. März 2025 im Auswärtigen Amt den Gedenktag der Bundesregierung für die Opfer terroristischer Gewalt eröffnete, galt das nicht für alle. Kurz zuvor war ein Opfer eben des Anschlags vom Breitscheidplatz an den Türen abgewiesen worden: Unerwünscht! Unerwünscht, weil der Mann, Andreas S., angeblich ein Sicherheitsrisiko darstelle. Worin das bestehen soll, hat ihm bis heute niemand erklärt. Sein Rauswurf zeigt stattdessen, dass es beim offiziellen Regierungsgedenktag nicht um die Opfer geht, sondern um den Exekutivapparat, der die Opfer von Anschlägen lediglich missbraucht, um seine Maßnahmen zu rechtfertigen.
Der 11. März ist der europäische Gedenktag für die Opfer des Terrorismus. Am 11. März 2004 wurden in Madrid auf mehrere Personenzüge Bombenanschläge verübt, die fast 200 Menschen das Leben kosteten. Seit ein paar Jahren führt die Bundesregierung am 11. März einen eigenen „Nationalen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt“ durch. So auch 2025. „Deutsche“ Terroropfer, das sind zum Beispiel die des NSU, der RAF, jene am 19. Februar 2020 in Hanau Ermordeten oder die vom Breitscheidplatz in Berlin. So wie Andreas S. oder Katharina P., die am 19. Dezember 2016 den Weihnachtsmarkt auf dem Platz an der Gedächtniskirche besuchten, als ein LKW in die Menschenmenge raste. Zwölf Menschen starben direkt, ein dreizehnter erlag Jahre später seinen Verletzungen.
Andreas S. wäre um ein Haar vom Tat-LKW erfasst worden. Er leistete anschließend Erste Hilfe bei Verletzten. Er selber wurde nur leicht verletzt, zumindest körperlich. Aber das Erlebte setzt dem Kopf und auch dem Körper unaufhörlich zu. Seit dem Anschlag ist er arbeitsunfähig. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich ständig. Andreas S. ist einer der Sprecher der Anschlagsbetroffenen vom Breitscheidplatz, hat die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse im Abgeordnetenhaus von Berlin und im Bundestag besucht, an Treffen der Opfer und Angehörigen mit Vertretern der Bundesregierung und von Sicherheitsbehörden teilgenommen, genauso wie an den jährlichen Gedenkfeiern am Anschlagstag sowie beim Gedenktag am 11. März. Bisher.
Am 11. März 2025 machte er sich auf den Weg zum Auswärtigen Amt, wo die „Gedenkstunde für die Opfer terroristischer Gewalt“ stattfinden sollte. Er hatte sich vorschriftsmäßig angemeldet und von der offiziellen Protokollstelle für die Veranstaltung auch eine Anmeldebestätigung erhalten. Ausrichter war das Bundesinnenministerium (BMI). Doch was dann geschah, hat ihn zutiefst erschüttert: Andreas S. wurde der Zutritt zur Opferveranstaltung verwehrt. Formal, weil er keine Einladung vorweisen konnte; die Anmeldebestätigung per Mail galt dafür nicht. Eine herbeigerufene Mitarbeiterin des BMI erklärte ihm dann, man habe ihm bereits vor Tagen per E-Mail eine Ausladung zukommen lassen. S. will keine bekommen haben, mehr bewegte ihn aber die Frage: Warum die Ausladung? Die Frage beantwortete ihm an den Türen des Ministeriums ein Beamter der Bundespolizei mit den knappen Worten, seine Personenüberprüfung habe ergeben, dass er ein „Sicherheitsrisiko“ darstelle. Worin das bestehen soll, erfuhr der Breitscheidplatz-Betroffene nicht. Stattdessen hieß es barsch: „Sie sind hier nicht erwünscht. Verlassen Sie das Gebäude!“
Drinnen sprach Außenministerin Baerbock in ihrer Eröffnungsrede pflichtschuldige Sätze wie diese: „Wir tendieren manchmal dazu, uns auf die Täter zu fokussieren. Doch das darf uns nicht und niemals den Blick verstellen, wofür wir Verantwortung tragen: Für die Opfer dieser Anschläge, für die Überlebenden, für die Hinterbliebenen und gerade auch für ihre Familien. (...) Und zwar nicht nur an Gedenktagen, wie dem heutigen Tag, sondern auch an all den anderen Tagen im Jahr.“
Offensichtlich gibt es Opfer erster und zweiter Klasse. Opfer, die es Wert sind, gewürdigt zu werden und welche, die einen Fußtritt bekommen. Die Politik spaltet sogar die Opfer.
Den Begriff „Spaltung“ hat die Außenministerin selbstverständlich auch im Repertoire:
„Wir können von ihnen lernen, wie es gelingen kann, sich in all der Trauer nicht spalten zu lassen. (...) Wenn das Ziel von Terrorismus die Spaltung der Gesellschaft ist, dann ist unsere stärkste Antwort das Miteinander.“
Nach dem ersten Schock hat sich der Ausgeladene bei mehreren Stellen beschwert: dem Auswärtigen Amt (AA) als Hausherr der Veranstaltung, dem Innenministerium als Veranstalter samt der Protokollabteilung für die Feierstunde am 11. März und auch beim Opferbeauftragten der Bundesregierung, der in Personalunion auch Opferbeauftragter für Berlin ist.
Das AA verwies Andreas S. an das BMI, und das BMI an das Landeskriminalamt (LKA), das für die Sicherheitsüberprüfungen zuständig sei. Beim LKA wiederum sagte man ihm am Telefon, zuständig sei das Bundesinnenministerium. Der Opferbeauftragte Roland Weber reagierte überhaupt nicht.
Dem nachfragenden Journalisten erging es nicht anders. Das BMI beantwortet keine einzige Frage: Warum wurden Betroffene des Breitscheidplatz-Anschlags von der Gedenkfeier am 11. März ausgeschlossen? In welcher Art sollen sie ein Sicherheitsrisiko gewesen sein? Wer hat das entschieden? Um wie viele Personen handelt es sich? Waren auch Personen darunter, die von anderen Terroranschlägen, als dem vom Breitscheidplatz, betroffen waren? Wenn ja, von welchen? Das Ministerium bestätigt aber, dass es bei der „routinemäßigen Sicherheitsabfrage“ Erkenntnisse gegeben habe, nach denen „im Einzelfall kein Zutritt“ zur Veranstaltung und zum AA-Dienstgebäude gewährt worden sei. Der Umstand an sich wird also eingeräumt, erläutert wird das nicht.
Der Opferbeauftragte, per E-Mail nach Kenntnis von dem Vorfall gefragt und um eine Stellungnahme gebeten, reagiert auf die journalistische Anfrage ebenfalls nicht. Auch ans Telefon geht er nicht. Stattdessen antwortet das Bundesjustizministerium, bei dem die Stelle des Opferbeauftragten angesiedelt ist und verweist erneut ans Bundesinnenministerium als für die Gedenkfeier Verantwortlicher. Reaktion BMI siehe oben.
Von der „Verantwortung“, zumal für die „Opfer“, von der die Außenministerin in der Gedenkfeier wiederholt sprach, ist nichts übrig geblieben. O-Ton Baerbock:
„Meine Damen und Herren, uns eint die schmerzhafte Trauer über das Geschehene. Für uns als Gesellschaft erwächst aus diesem Schmerz eine Verantwortung, eine Verantwortung, im Gespräch zu bleiben und daher herzlichen Dank an diejenigen, die seit Jahrzehnten mit diesem Schmerz leben müssen und ihre Erfahrung weitergeben.“
Tatsächlich ist Andreas S. kein Einzelfall. Auch Katharina P. erlebte am 19. Dezember 2016 den LKW-Anschlag zusammen mit Mann und einjährigem Kind aus nächster Nähe. Sie wurde wenige Tage vor dem 11. März per E-Mail von der Feier ausgeladen. Unter der Betreffzeile „Ihre Anmeldung zur Gedenkstunde“ hieß es wörtlich:
„Nach Durchführung der erforderlichen Personenüberprüfung müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Teilnahme nicht möglich ist.“
Auch sie bekam keine weiteren Erklärungen. Am 11. März blieb sie zuhause, aber auch ihr Mann, obwohl der eine Einladung erhalten hatte.
Andreas S. und Katharina P. sind unbequeme Opfer. Sie gehören zu denjenigen, die bei Treffen mit Ministern, Staatssekretären oder Vertretern der Sicherheitsbehörden immer wieder kritische und auch konfrontative Fragen stellen oder ihre Meinung sagen. Keine Opfer, wie sie eine Politik, die im Namen der Opfer Politik macht, gerne hätte: schweigsam und trauernd zuhause sitzend, vor allem nicht in die Öffentlichkeit gehend, damit sie die Politik nicht stören. Stattdessen entziehen sich diese der vorgesehenen passiven Opferrolle und treten auf wie fordernde Subjekte.
Doch Opfer, die für sich selber sprechen, sind für die Politik unbrauchbar.
Außenministerin Baerbock am 11. März:
„Wir geben den Opfern heute eine Stimme. Aber nicht nur heute, sondern jeden Tag des Jahres.“
Überhaupt sind Opfer das lästige Produkt von Anschlägen. Dazu zählen auch diejenigen, die unmittelbar nach der Tat als sogenannte Ersthelfer bei Verletzten knieten, minutenlang oder stundenlang, um sie am Leben zu erhalten, und die diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Und wenn sie dann Hilfe suchen oder Geld brauchen, wird ihnen von Opferbeauftragten und Behörden entgegengehalten, sie hätten ja nicht helfen müssen, das sei ja ihre Entscheidung gewesen. Solche Opfer fehlten auch am 11. März bei der Gedenkfeier.
Die Unruhe der Opfer hat ihre Gründe. Zum Anschlag vom Breitscheidplatz gibt es noch viele ungeklärte Fragen, etwa zur doppelbödigen Rolle des BKA bei den Ermittlungen. Da ist zum Beispiel die Pistole, mit der der polnische Speditionsfahrer getötet worden sein soll, und die der angebliche Attentäter Anis Amri bei sich hatte, als er in Italien erschossen wurde. Als die Waffe vom BKA zur kriminaltechnischen Untersuchung gebracht wurde, stellten die Forensiker fest, dass es keinerlei Spuren mehr auf und in ihr gab. Sie war offensichtlich vorher gründlich gesäubert worden. Fragen betreffen auch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), das dem Untersuchungsausschuss im Bundestag tausende Aktenseiten vorenthielt und erst Wochen nach Ende der Beweisaufnahme vorlegte. BKA und BfV unterstehen dem Bundesinnenministerium, das die Opfer-Gedenkfeier ausrichtete.
Katharina P. bezweifelt obendrein, dass der Tunesier Amri der LKW-Fahrer und Attentäter gewesen sein soll und fragt stattdessen, ob er nicht etwa ein V-Mann war? Auch an der angeblichen Tatmotivation hat sie Zweifel. Ihrer Überzeugung nach werden Muslime als Schuldige für den Anschlag vorgeschoben.
Sind in solchen Positionen die wahren Gründe für die Ausgrenzung von kritischen Opfern zu sehen? Haben die Regierenden Angst vor dem Auftreten dieser Opfer? Liegt darin das Sicherheitsrisiko?
Außenministerin Baerbock am 11. März 2025:
„Niemals leise zu sein und niemals zu vergessen, das ist die Antwort dagegen, dass das Drehbuch des Terrorismus ständig weitergeht.“
Doch wenn gar Sicherheitsstellen, Verfassungsschutz oder Staatsschutz, in Terroranschläge verwickelt sind, muss es zum Kurzschluss zwischen Opfern und Exekutive kommen. Dann organisieren nämlich die Mittäter den Gedenktag für die Opfer. Das kann keine Sicherung aushalten.
Bestes Beispiel ist die Terrormordserie des NSU (Nationalsozialistischer Untergrund“), in die Verfassungsschutzämter und Landeskriminalämter verwickelt sind. Das ist heute Allgemeingut. Der Begriff „NSU“, die „Opfergruppe NSU“ gar, sei am 11. März bei den Feierlichkeiten im Außenministerium nicht einmal vorgekommen, erzählt Barbara John, die Beauftragte für die NSU-Opfer. Die Angehörigen der Mordopfer mit türkischen, kurdischen und griechischen Wurzeln wollen nach ihren wiederholten negativen Erfahrungen im Münchner Prozess in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen sowie mit den tendenziösen Ermittlungen inzwischen nicht mehr am 11. März-Gedenktag teilnehmen. Einzig ein Verwandter der Polizeibeamtin Kiesewetter war anwesend, von den Angehörigen der anderen Mordopfer niemand. Kein Interesse mehr an einem Regierungsgedenktag.
Anwesend war, nächstes Beispiel, Michael Buback, der Sohn des ehemaligen Generalbundesanwaltes Siegfried Buback, der 1977 zusammen mit zwei Begleitern von der RAF erschossen wurde. Sohn Buback ist gleichfalls ein kritisches Opfer. Er entlarvte zahllose Mängel der damaligen Ermittlungen und erzwang dadurch den Prozess gegen Verena Becker in Stuttgart von 2010 bis 2012. Dabei kam es zum Zerwürfnis mit der Bundesanwaltschaft. Sohn Michael geht davon aus, dass Verena Becker beim Attentat in Karlsruhe die Mordschützin war und nicht nur Beihelferin und dass sie obendrein zugleich in Kontakt mit dem BfV stand, wofür es ernstzunehmende Hinweise gibt. Die Bundesanwaltschaft bestreitet das vehement.
Michael Bubacks Teilnahme an der 11. März-Opferveranstaltung war keine Selbstverständlichkeit. Er war bisher nie eingeladen worden. 2025 hat er auf seine Initiative hin, wie er sagt, eine Einladung bekommen und reiste nach Berlin. Auch er hat noch Fragen zum Mord an seinem Vater. Zum Beispiel zu einem schriftlichen Behördenzeugnis des Generalbundesanwalts Rebmann über Verena Becker. Darin sind zwölf Zeilen geschwärzt. Seit Jahren versucht Buback zu erreichen, dass diese Zeilen für ihn entschwärzt werden — ohne Erfolg. Auch in den Ampel-Regierungszeiten versuchte er es wieder und schrieb Justizminister Marco Buschmann an — Reaktion wie gehabt: keine. Dafür muss es Gründe geben. Und Opfer, die darin herumstochern, kann man nicht dulden.
Stattdessen missbraucht man sie. Dazu gehört auch der letzte Satz der ehemaligen Außenministerin, gesprochen am Opfergedenktag, dem 11. März 2025:
„Viele von Ihnen sind unfreiwillige Experten, und daher danken wir Ihnen umso mehr, dass sie nicht nur heute hier sind, sondern dass Sie als Hinterbliebene uns Ihr unfreiwilliges Wissen weitergeben und uns als Gesellschaft stärken.“

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .