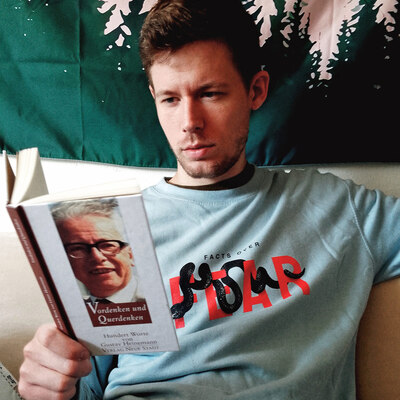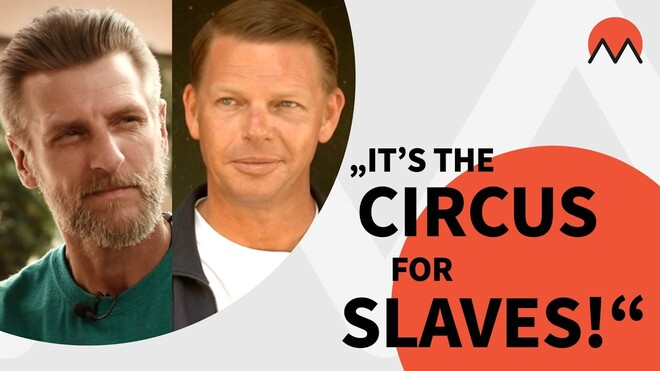Die Handlung der drei Filme „28 Days / Weeks / Years Later“, nachfolgend „28 (…) Later“ genannt, ist rasch erzählt, doch beschränken wir uns zunächst auf den ersten Teil. Die Handlung beginnt im England um die Jahrtausendwende. Umweltaktivisten brechen in ein Tierversuchslabor der Universität Cambridge ein, um mehrere Schimpansen zu befreien. Die Affen werden in einem Hochsicherheitstrakt zu experimentellen Zwecken festgehalten. Teil des Versuchs ist, dass ihnen über Stunden hinweg auf mehreren Bildschirmen in Dauerschleife gewalttätige Szenen und Videoaufzeichnungen gezeigt werden. Die Methode ist vergleichbar mit der Ludovico-Technik aus Stanley Kubricks „Clockwork Orange“, bei der der im Kinosessel fixierte Protagonist mit Klammern die Augenlider gewaltsam offen gehalten bekommt und gezwungen ist, stundenlang brutale Szenen anzusehen, ohne den Blick abwenden zu können.
Ein sogenanntes Wut-Virus wird in den Primaten experimentell erzeugt — mit dem Ziel, ein entsprechendes Anti-Aggressions-Mittel zu entwickeln. Die gutgläubigen, doch ahnungslosen Aktivsten befreien die Affen aus ihren Glaskäfigen und werden prompt von den Tieren angefallen, gebissen und infiziert. Das Wut-Virus bricht in ganz Großbritannien aus.
28 Tage später erwacht im Londoner St.-Thomas-Hospital der Fahrradkurier Jim aus dem Koma, der am Tag des Ausbruchs in einen Fahrradunfall verwickelt worden war. Nach seinem Erwachen findet er sich in einem menschenleeren London wieder. Nachdem er lange durch die verwaiste Metropole gewandert ist, stößt er in einer Kirche auf eine Horde Infizierter, die ihm unmittelbar nachjagen. Zwei weitere Nicht-Infizierte, Selena und Mark, eilen ihm rettend zur Hilfe. In einem sicheren Versteck wird Jim darüber aufgeklärt, was sich in den vergangen 28 Tagen zugetragen hat: Das Wut-Virus, das die Menschen nach einer Übertragung durch Körperflüssigkeiten binnen Sekunden rasend und besinnungslos macht, habe sich wie ein Lauffeuer über den gesamten britischen Inseln verbreitet. Großbritannien als Staat habe aufgehört zu existieren, die gesamte Insel sei von der übrigen Welt isoliert worden.
Auf der Suche nach weiteren Überlebenden wird Mark von einem Infizierten gebissen und daraufhin unmittelbar von Selina innerhalb der kurzen Inkubationszeit getötet. Die beiden Überlebenden treffen kurz darauf auf den Witwer Frank und dessen Tochter Hannah. Zu viert folgen sie einem Militärfunkspruch, der Schutz und Hilfe verspricht, in Richtung Manchester. Kurz vor dem Ziel infiziert sich Frank unachtsamerweise und wird infolgedessen von den hinzustoßenden Soldaten, die den Funkspruch abgesetzt haben, erschossen.
Jim, Selena und Hannah werden von den Soldaten zu einem alten Landherrenhaus gebracht — dem Ort, an dem der eigentliche Horror erst beginnt. Es stellt sich nämlich heraus, dass die sich dort verbarrikadierende Soldaten-Truppe kein gutes Ansinnen verfolgt. Der Funkspruch diente dazu, Frauen anzulocken — zur Triebabfuhr und zur Erzeugung von Nachwuchs. Es kristallisiert sich heraus, dass die Menschen gar nicht erst vom Wut-Virus infiziert werden müssen, um zu Bestien zu werden.
Der Anführer der Truppe, Major West, ist Anhänger der Hobbes’schen Lehre. In der Wut-Virus-Epidemie sieht er eine Rückkehr zu einem „normalen“ Naturzustand. „Menschen töten Menschen“, erklärt er Jim. Darauf läuft das Finale schließlich hinaus: Im Showdown, in welchem Jim — ohne selbst infiziert zu sein — , immer mehr einem blutrünstigen Infizierten ähnelt, tötet er mit Hilfe eines infizierten Gefangenen die übrigen Soldaten und kann mit Selena und Hannah fliehen.
Außer-sich-selbst-Sein
Bereits aus dem ersten Teil lässt sich viel über das menschliche Verhalten und Menschlichkeit als solche in der Corona-Fake-Pandemie lernen. Heute lässt sich auf Google Trends im schicksalhaften März 2020 ein klarer Ausschlag bei der weltweiten Begriffssuche nach „28 Days Later“ erkennen. In den YouTube-Kommentaren unter dem Trailer schrieben etliche User: „Who’s also here, because of that creepy covid stuff?“. Und im Londoner Lockdown stellte ein YouTuber die ikonische Szene des einsamen Jim auf der menschenleeren Westminster Bridge nach.
Leitmedial überschlugen sich die angesichts des anlaufenden „28 Years Later“ die Jubelmeldungen, es würde nun endlich ein Streifen in die Kinos kommen, der die Lehren aus Corona auf der Leinwand verhandelt. Unverändert liegt in den leitmedialen Schreibstuben die als Lüge in die Geschichte eingegangene Narration einer echten Pandemie zugrunde.
Mit dieser grundfalsch eingestellten Brille kann man diese Filme in einer Weise sehen, die die eigene Rolle als Schreibtischtäter im Dunklen lässt. Sieht man jedoch die Fake-Pandemie als das, was sie war, dann kommt man bei selbstehrlicher Reflexion nicht umhin, anzuerkennen, dass man als Corona-Kultist, Blockwart, Denunziant und Pharma-Apologet den Infizierten aus „28 (…) Later“ nicht unähnlich war.
Nun mag man sich hier berechtigterweise die Frage stellen, ob es nicht zu weit geht oder unangemessen ist, Corona-Mitläufer und/oder Täter mit bissigen und blutspuckenden Tollwütigen zu vergleichen? Wie es sich im gesamten coronakritischen Diskurs immer schon mit Vergleichen gehalten hat, so gilt auch hier, dass der Vergleich angemessen ist, nicht jedoch die Gleichsetzung. Natürlich wurden Corona-Anhänger nicht zu Monstern — sie haben sich „nur“ wie solche verhalten: von dezent unsozial bis hin zu wahrlich unmenschlich.
Was beide — Corona-Kultisten und die Wut-Infizierten — eint, ist genau das: die Wut. Das etymologische Wörterbuch beschreibt den Begriff der Wut unter anderem als ein „Außer-sich-sein“. Und nichts anderes waren und sind die Wut-Infizierten und eben auch die Corona-Kultisten: Außer sich — außer sich vor … Wut.
Um diesen Aspekt dreht sich dieser Beitrag im Kern: Können „wir“ als Nonkonformisten den Corona-Mitläufern überhaupt auf ewig böse sein für das, was sie taten? Waren sie doch offensichtlich — wie wir gleich sehen werden — größtenteils gar nicht sie selbst, sondern eben außer-sich, in einer hypnotisiert und besessen erscheinenden Verfasstheit, die unter gewöhnlichen Umständen nicht die ihre ist. Hierfür eignen sich die Wut-Infizierten aus „28 (…) Later“ ideal als extrem überzeichnete Vergleichsreferenz.
In der Wahrnehmung der Nicht-Erfassten und Nicht-Infizierten stellten sich die Wütenden dar, als nicht-mehr-wiederzuerkennen. Bei Corona-Kultisten waren es unsoziale bis infame Verhaltensweisen, die man diesen Menschen vorher nie zugetraut hätte.
Dennoch blieben sie, von der Maskierung abgesehen, als Menschen erkennbar. Die Infizierten sind hingegen ihrer kognitiven Fähigkeiten beraubt, ihre Körper machen permanent spastische Zuckungen, sie spucken Blut und jagen jedem hinterher, der noch nicht infiziert ist.
Dabei sind hier keine Trennlinien zu machen zwischen Immunen und Anfälligen. Das Wut-Virus verwandelt jeden Gebissenen – bis auf drei immune Ausnahmen in „28 Weeks Later“ — binnen Sekunden in einen ebenfalls Wütenden. Und auch bei der Corona-Erzählung gab es kein klar erkennbares Profil jener rund 20 Prozent, die in der Manier Gunnar Kaisers „nicht mitmachten.“
In „Die Psychologie des Totalitarismus“ schrieb der Psychologe Mattias Desmet sehr treffend:
„Zu Beginn der Krise zeichneten sich im Eiltempo neue ‚Lager‘ in der Gesellschaft ab, die alle früheren Lager durchzogen — man folgte der Viruserzählung oder man folgte ihr nicht. Links oder rechts im politischen Spektrum, Hautfarbe und sozialer Status, Beruf oder Hobby: All diese Grenzen verwischten — was zählte, war, was man über das Virus dachte.“ (1)
Der letzte Halbsatz dieses Zitats ist stichwortgebend: „was man über das Virus (nicht) dachte“. Man denke hierbei an die Worte des Protagonisten aus „Inception“: „Ein Gedanke ist wie ein Virus, resistent, hochansteckend und die kleinste Saat eines Gedankens kann wachsen. Er kann Dich aufbauen oder zerstören.“ Wir haben es folglich in beiden Fällen mit einer Virus-Infektion zu tun. Im Falle der „28 (…) Later“-Filme ist es ein viraler Infekt — und „bei Corona“, das es als Virus in unzähligen Varianten natürlich ebenso gibt, war es in erster Linie ein gedanklicher Infekt. Die „Gegenseite“, genau genommen die Technokraten und kognitiven Kriegsführer, sprechen hier ganz offen davon, dass Menschen gegen falsche Gedanken „geimpft“ werden müssten, ganz so, als seien falsche Gedanken ein Virus, gegen das eine Immunisierung notwendig sei.
Bemerkenswert ist bei beiden Virusvarianten, dass sie auf Gleichmachung durch Assimilation abzielen. Beim Wut-Virus könnte man schließlich annehmen, dass dieses sich bereits am Ground Zero, dem Versuchslabortrakt der Uni Cambridge, am Tag eins selbst hätte ausrotten müssen. Wenn die infizierten Menschen nach der Infektion wutrasend auf andere Menschen losgehen, wäre der Schluss naheliegend, dass sich die wenigen Gebissenen kurz nach der Infektion gegenseitig töten. Doch erstaunlicherweise hat dieses Wut-Virus scheinbar eine übergeordnete Intelligenz, die es seinen Wirten ermöglicht, sich zu vermehren, anstatt sich — und damit auch das Virus — rasch selbst zu töten. So lassen die Infizierten voneinander ab, sobald der eine den anderen durch einen Biss infiziert hat.
Dieser wird dann ebenfalls Teil der infizierten Masse — einer Masse, die der zurecht umstrittene Psychologe Gustav Le Bon begreift als eine „Vereinigung irgendwelcher einzelner von beliebiger Nationalität, beliebigem Beruf und Geschlecht“ (2), in der „(d)ie bewusste Persönlichkeit verschwindet, die Gedanken und Gefühle aller Individuen bewegen sich in dieselbe Richtung. Es bildet sich eine Gemeinschaftsseele, die wohl veränderlich, aber von ganz bestimmter Art ist.“ (3) Le Bons Beschreibung des Individuums in der Masse kommt der des Infizierten aus „28 (…) Later“ relativ nah: „Der Einzelne ist nicht mehr er selbst, er ist ein Automat geworden, dessen Betrieb sein Wille nicht mehr in der Gewalt hat.“ (4)
Der oben bereits zitierte Mattias Desmet beschreibt in seiner gegenwartsbezogenen Totalitarismus-Analyse, dass sich der Einzelne in der Masse geradezu transzendiert, in ihr aufgeht. Wenn sich etwas dieser Masse entgegenstellt, sie infrage stellt oder gar delegitimiert, so wird das von dem Subjekt, das sich symbiotisch mit der Masse identifiziert, als existenzieller Angriff wahrgenommen.
„Die Masse ist radikal intolerant gegenüber anderen Meinungen und hat einen starken Hang zu Autoritarismus. Dissidente Stimmen erscheinen der Masse (…) asozial und unsolidarisch, (…) vollkommen unbegründet, (…) äußerst aversiv, (…) außerordentlich frustrierend, (…). All dies sorgt dafür, dass die Masse überzeugt ist von ihren überlegenen ethischen und moralischen Ansichten und von der Verwerflichkeit eines jeden, der ihr widersteht. Wer nicht mitmacht, ist ein Verräter des Kollektivs. (…) (M)it dem vierten Faktor — der Möglichkeit, die Massenbildung bietet, Frustration und Aggression grenzenlos abzureagieren — führt das zu einem bekannten Phänomen: Die Masse neigt zu Grausamkeiten gegen jene, die ihr widerstehen, und verübt diese typischerweise, als wäre es eine ethische, heilige Pflicht. (…) Auch diese Merkmale können wir in der Coronagesellschaft in immer stärkerem Maße beobachten. Je mehr sich die Coronakrise entrollt, desto autoritärer drängt sich der dominante Diskurs der Gesellschaft auf (…).“ (5)
Ebenso zeigen sich hier Parallelen in der Verhaltensdynamik zwischen der Masse der Wut- beziehungsweise Gedanken-Infizierten und den einzelnen oder vereinzelten Nicht-Infizierten.
Im Falle von „28 (…) Later“ reagieren die Wut-Infizierten mit einem Jagdtrieb, der darauf abzielt, die noch nicht Infizierten durch einen Biss ebenfalls zu infizieren und dem Virus auszuliefern.
Wer in den Jahren der Fake-Pandemie ohne Maske ein öffentliches Gebäude oder den ÖPNV betrat, bekam es ebenfalls mit aggressiven Reaktionen der gedanklich infizierten Masse zu tun: „Maske auf!“, hieß es dann im Befehlston. Worauf zielt der Befehl ab? Eben auch auf Assimilation. Der — noch — unmaskierte Mensch soll sich durch das Maskieren dem Einheitserscheinungsbild der Masse angleichen. Wer seine Individualität behält, nicht in der Maskenmasse aufgeht, ist ein Feind, ein noch nicht Infizierter. Den naheliegenden Vergleich mit der Entität der Borg aus „Star Trek“ stellte Roland Rottenfußer in seinem Werk „Strategien der Macht“ an:
„Es (die Borg) sind Cyborgs mit Technik-Implantaten, mental unauflöslich miteinander verbunden durch das sogenannte Hive-Bewusstsein. (…) Das Borg-Kollektiv hat die Tendenz, immer weiter zu wachsen, indem es sich ein Individuum (…) nach dem (…) anderen einverleibt. Jeder Individualismus ist in der Borg-Welt ausgetilgt. (…) Solange weiterhin eine einzige freie Kreatur im Kosmos existiert, besteht für die Assimilationswünsche der Borg noch Wachstumspotenzial. Gemessen an den Borg sind (…) unsere Corona-Meinungswächter, die jede abweichende Position zu diffamieren, zu deckeln und zu canceln versuchen, eigentlich nur Amateure.“ (6)
Die Massen der gedanklich Infizierten unterscheiden sich natürlich dahingehend, dass die Wut-Infizierten die Nähe zu und die Berührung mit Nicht-Infizierten suchen, während Corona-Kultisten selbiges tunlichst vermeiden — derart, wie Elias Canetti die Massenbildung in Epidemie-Zeiten trefflich umschrieb:
„Das Element der Ansteckung, das in der Epidemie von solcher Wichtigkeit ist, hat die Wirkung, dass die Menschen sich voneinander absondern. Das Sicherste ist, niemandem zu nahe zu kommen, denn er könnte die Ansteckung schon in sich haben. Manche fliehen aus der Stadt und zerstreuen sich auf ihre Güter. Andere schließen sich in ihre Häuser ein und lassen niemanden zu. Einer vermeidet den anderen. Das Einhalten von Distanz wird zur letzten Hoffnung. Die Aussicht auf Leben, das Leben selbst drückt sich sozusagen in der Distanz zu den Kranken aus. Die Verseuchten formen sich allmählich zu toter Masse um — die Unverseuchten halten sich von jedermann, oft auch ihren nächsten Angehörigen (…) fern. Es ist merkwürdig, wie die Hoffnung, zu überleben, den Menschen hier zu einem Einzelnen macht, ihm gegenüber steht die Masse der Opfer.“ (7)
In „28 (…) Later“ sind es die Nicht-Infizierten, die stets auf Distanz bedacht sind und während „unserer“ Fake-Pandemie verhielt es sich genau umgekehrt: die gedanklich nicht Infizierten strebten nach Nähe, trugen auf den Demonstrationen teils Buttons mit der Aufschrift: „umarmbar“. Die Einzelnen in der Masse der Mitläufer und Mittäter ordneten ihrer — als bedroht empfundenen — Selbsterhaltung die vitalsten Bedürfnisse unter: Atmen, Nähe, Mitmenschen, Berührung. Die von der Corona-Erzählung gedanklich infizierten trachteten nach der Bildung einer in Distanz geeinten, gemeinsam einsamen Masse, um nicht Teil der Masse aus „Corona-Toten“ (sic!) zu werden.
Aus der Sicht dieser stellten die Corona-Oppositionellen, die Maßnahmenkritiker und „Querdenker“ das dar, was in „28 (…) Later“ die Infizierten sind: Sie sahen in den genannten Menschengruppen die Gefährder, die durch ihre Massenbildung und Nähe die Kollektivgesundheit gefährdeten, vermeintlich Intensivbetten verknappten und das Gesundheitssystem an den Rand des Kollapses trieben. Deretwegen würde die Masse der „Corona-Toten“ (sic!) ansteigen. Es galt fortan nur noch, den gesamten Gesellschaftskörper aufrechtzuerhalten, während die einzelnen Zellen — also das Individuum, das Ich — nichts mehr galt.
Ich-Losigkeit
In seinem wegweisenden Werk „Das indoktrinierte Gehirn“ geht der Molekulargenetiker Michael Nehls der These nach, dass die Vereinheitlichung des Denkens durch die Corona-Maßnahmen von Technokraten und Social Engineers gezielt beabsichtigt und herbeigeführt worden war — und immer noch vollzogen wird.
Würde man eine Gleichschaltung des Denkens herbeiführen wollen, dann würde man, so Nehls, es genau so machen. (8) In der Undurchdringlichkeit sowie dem dilettantisch erscheinenden Veranlassen der Corona-Regeln sieht er eine Absicht auf der Meta-Ebene, insofern, als dass dieses scheinbar beabsichtigte Chaos bestens dazu geeignet sei, die Menschen im Dauerstress zu halten. (9) Dies führe dazu, so Nehls weiter, dass die für das biografische Gedächtnis zuständigen Index-Neuronen im Hippocampus überschrieben würden.
Dies geschehe wiederum mit dem von Nehls vermuteten Ziel, das Gehirn wie eine Festplatte zu defragmentieren, um final ein neues geistiges Betriebssystem kollektiv in den Köpfen zu installieren. Dieses nähme sich derart aus, dass die Menschen letztlich ihrer Individualität, ihres Ichs beraubt und zu gehorsam dressierten Wesen degradiert wären, die ihre Knechtschaft gar nicht mehr als solche wahrnehmen und sich auch den gegenteiligen, wünschenswerten Zustand weder vorstellen noch wünschen können — ganz zu schweigen davon, aktiv zu werden, um selbigen zu erringen. (10)
So abenteuerlich die These klingen mag, so fundiert unterfüttert sie Nehls mit unzähligen, guten Quellen und kongruenten Argumentationen.
In ihrer siebenteiligen Essay-Reihe „Wege aus der Ichlosigkeit“ unterfüttert Lilly Gebert die Feststellung einer pandemischen Ichlosigkeit mit der Forschung von Michael Nehls, sowie den Arbeiten von Rudolf Steiner. Im dritten Teil schreibt sie, mit Verweis auf Steiner, über die anthroposophisch-kosmischen Kräfte, die es auf das Ich abgesehen haben:
„Zunächst beschreibt Steiner in ‚Die Apokalypse des Johannes‘, wie die Asuras in einer noch ferneren Zukunft aufträten und direkt auf das Ich des Menschen zielten, während zuvor Luzifer auf die Emotionen und Ahriman auf den Intellekt und Verstand des Menschen wirken werden. Während Luzifer den Menschen durch Stolz, Illusionen und spirituelle Überhöhung beeinflusse und Ahriman ihn in Materialismus, Skeptizismus und reine Verstandesorientierung verstricken werde, beschreibt Steiner die Asuras in seiner anthroposophischen Kosmologie als geistige Wesenheiten, die er für noch gefährlicher hält als Luzifer und Ahriman. Sie stünden für die tiefste Form des Bösen, das in der Zukunft das ebenfalls tiefste Zentrum des Menschseins selbst angreifen würde: das Ich und die individuelle geistige Freiheit. Insofern der Mensch dem Bösen folglich über Luzifer und Ahriman Einhalt gewährt und sein Ich von ihnen fehlleiten und demoralisieren lässt, seien es Sorat und die Asuras, die nach dessen finaler Entwurzelung dazu übergingen, dieses ‚Ich‘ (...) vollends zu zerstören. Die Asuras rauben (...) dem Menschen seine Fähigkeit zur freien moralischen Entscheidung und führen gleichsam dazu, dass das ‚Ich‘ nicht mehr eigenständig handeln kann, sondern von äußeren Kräften ‚besetzt‘ oder zerlegt wird.“
Daraus lässt sich schließen, dass beide Viren — der Gedanken- und das Wut-Virus — , etwas Asurisches haben, insofern sie das Ich vernichten oder zumindest narkotisieren. Hier stellt sich nun die Frage, wo die Scheidelinie verläuft, ab der das Ich dauerhaft oder vorübergehend in den Zustand der Ichlosigkeit abgleitet.
Im neuesten Teil der Reihe, „28 Years Later“, wird der 12-jährige Protagonist Spike von seinem Vater Jamie aufgefordert, einen von der Decke baumelnden Infizierten per Pfeilschuss zu erlegen. Sie, die Infizierten, hätten keinerlei Verstand und Seele mehr, man könne sie bedenkenlos töten — so der Vater. Der junge Spike hat jedoch Bedenken. Denn seine sterbenskranke Mutter ist krankheitsbedingt ähnlichermaßen nicht mehr vollständig Herrin ihres Verstandes, dissoziiert immer wiederkehrend und ist daher selbst nicht ganz … sie selbst. Sie ist ebenfalls durch eine Krankheit, wenn auch nicht das Wut-Virus, außer sich. Wo verläuft nun die Grenze zwischen einem „normal“ erkrankten Menschen und einem zombieähnlichen Wut-Infizierten?
Ein wiederkehrendes Motiv in den „28 (…) Later“-Filmen ist, dass die frisch Infizierten sich in den letzten geistesgegenwärtigen Augenblicken der kurzen Inkubationszeit des unmittelbar nahenden Ich-Verlustes bewusst sind, und ebenso der von ihnen ausgehenden Gefahr für ihre — liebsten — Mitmenschen. Als in „28 Days Later“ Hannahs Vater Frank sich unachtsamerweise durch einen herabfallenden Bluttropfen infiziert, sagt er ihr in dem letzten Moment seines Bewusst-Seins, dass er sie liebe. Als sie ihn daraufhin umarmen möchte, brüllt er sie, Sekunden vor der Verwandlung, an, sie solle von ihm fernbleiben. Kurz darauf beginnen die Wut-Symptome und Frank ist nicht mehr länger Frank. Oder doch?
Nachdem in der ersten Filmhälfte Selena den frisch infizierten Mark innerhalb der Inkubationszeit mit einer Machete tötet, ehe Mark dann — scheinbar — nicht mehr Mark ist, verdeutlicht sie Jim, dass sie das bei ihm genauso tun würde, sollte er sich durch einen Biss infizieren. „Keine Sekunde werde ich zögern!“, droht sie Jim unmissverständlich. Als unwahr herausstellen wird sich diese Drohung im Laufe des Films, als Jim — uninfiziert, aber den Infizierten ähnelnd — die Soldaten umbringt und Selena im Zwielicht des Kerzenscheins nicht zweifelsfrei erkennen kann, ob er nun mit Wut infiziert ist oder nicht. Sie hält die Machete angriffsbereit im Anschlag und als Jim aus dem Schatten heraustritt, zögert sie dennoch. „Das war aber länger als eine Sekunde“, trietzt Jim sie, ehe sie sich küssend in die Arme fallen.
In diesen wenigen Sekunden eröffnete sich der Raum, der, laut dem persischen Mystiker Rumi, zwischen Reiz und Reaktion liegt, ein Ort, wo dort, und nur dort, Begegnung stattfinden kann. Bei den Wut-Infizierten und Corona-Kultisten gibt es diesen Raum nicht mehr. Es gibt nur noch den Reiz; — das Erblicken von Nicht-Infizierten und „Masken-Muffeln“ — und die unmittelbar darauf folgende Reaktion: (verbaler) Angriff.
Der Grad zwischen Ich-Sein und Außer-Sich-Sein, respektive die Ichlosigkeit, verläuft analog zum (Nicht-)Vorhandensein des Raums zwischen Reiz und Reaktion. Sind die Wut-Infizierten damit vollständig ichlos? Die Filme geben hier keine eindeutigen Antworten, sondern lassen Platz für Ambiguität. In einer weiteren Szene im Showdown des ersten Films gibt es einen Moment, in welchem sich Hannah vor einem Infizierten versteckt … hinter einem Spiegel. Statt Hannah erblickt der infizierte Soldat sein eigenes Spiegelbild. Wäre er ichlos, so müsste er, mangels Fähigkeit zur Selbsterkennung, sein eigenes Spiegelbild angreifen — tut er aber nicht. Anscheinend kann der Infizierte doch noch unterscheiden zwischen seinem Ich und den anderen. Er ist kein rein instinktgetriebenes Raubtier, welches sich selbst im Spiegel nicht erkennen kann. Dass er sich auf der Spiegelfläche selbst erkennen kann, mag daher rühren, dass das Wut-Virus auf den Menschen übertragen wurde von Affen — die wiederum den tierischen Spiegeltest bestehen.
Im Außer-sich-Sein der Wut-Infizierten scheint es eine Art Yin und Yang zu geben — will heißen, es existiert selbst im ichlosen Infizierten noch ein potenzieller Ich-Anteil — und umgekehrt scheint es auch möglich, dass in einem Bei-sich-Seienden das pandemische Ichlose vorhanden ist, ohne dass es sich Bahn bricht. Das ist für den Vergleich und das Verstehen der Corona-Kultisten hilfreich. Das Yin-und-Yang-Prinzip sei hier an zwei konkreten Beispielen aus den „28 (…) Later“-Filmen skizziert. In „28 Weeks Later“ steht im Handlungsvordergrund eine Familie, bei der die Mutter, die Tochter Tami und der kleine Sohn Andy gegen das Wut-Virus immun sind. Nachdem Andy von seinem infizierten Vater gebissen wird, ähnelt sein Äußeres zwar einem Infizierten — die Augen färben sich rot — doch er verliert nicht sein Ich, er verhält sich weiterhin wie ein gesunder Mensch. Und umgekehrt gibt es in „28 Years Later“ eine infizierte Frau, die — wie auch immer — in ihrem zombieähnlichen Zustand schwanger geworden ist und mithilfe (!) der nicht infizierten Mutter von Spike ein Kind gebärt … ein gesundes, nicht infiziertes und wohl auch immunes Kind.
In diesem Film-Canon gibt es also sowohl asymptomatisch Infizierte — Andy — als auch Infizierte, die das Nicht-Infizierte, das Gesunde in sich tragen.
Was können wir daraus für unsere Situation ab 2020 ableiten? Dass in jedem Menschen — situativ — die Potenzialität für beides angelegt ist.
Mit „beides“ ist nicht „gut und böse“ gemeint — das wäre zu plump —, sondern die — vorübergehende — Anfälligkeit für gedankliche beziehungsweise propagandistische Infekte, die das eigene Ich — temporär — ausschalten können. Dieser Punkt verdient eine Konkretisierung: Ab Februar 2022 und erst ab recht ab Oktober 2023 mussten viele Corona-Oppositionelle den Verlust liebgewonnener Mitstreiter beklagen, die nach Geistesgeschwisterlichkeit in der Corona-Zeit anderen Erzählungen anheimfielen und auf einmal für die NATO-Aufrüstung eintraten oder im Gaza-Völkermord eine Form von Selbstverteidigung sahen. Umgekehrt fanden sich manche wieder Schulter an Schulter mit Menschen, die sie in der Corona-Zeit als „kultisch Infizierte“ abschrieben hatten, die angesichts der grassierenden Kriegsbesoffenheit nun wieder Verbündete im Sinne des Friedens sind. Je nach Agenda, kann die jeweils eine Gruppe, für eine andere Gruppe die „Infizierten“ darstellen.
Offenlegung
Es gibt eine weitere Lesart der Filme, die das Wut-Virus als die Offenlegung und Sichtbar-Machung von Konflikten deutet, die bereits unter der Oberfläche schwel(t)en. Sowohl deuten der ideologiekritische Filmanalyst Wolfgang M. Schmitt als auch seinerzeit der Kulturwissenschaftler Dietrich Diederichsen den Film als zeitgenössische Neoliberalismuskritik. Dass der erste Teil im Post-Thatcheristisch geprägten England der Jahrtausendwende spielt, unterstreicht diese Analogie. Den Ausspruch „there is no such thing as society“ sieht man in diesem Film in vollendeter Form. Die Atomisierung der Gesellschaft, als auch die Entwurzelung des Ichs, wenn man so möchte, die marktkonforme Ichlosigkeit, bilden zusammen zwei Kernbestandteile der neoliberalen DNA. In seinem Beitrag für die ZEIT mit dem Titel „Jeder kann der Zombie sein“ schrieb Diederichsen 2003:
„Liest man diesen Film politisch, dann bietet er dem jugendlichen Eskapismus an, sich (...) mit einer barbarisch und ganz frei gewordenen Marktkonkurrenz zu identifizieren. Die Logik des Präventiven und der Dauerverdacht der Seuche sind die sehr aktuellen Codes, in die sich das Konkurrenzverhältnis naturgesetzartig einschreibt. Es wird übersetzt in einen Kampf aller gegen alle, bei dem es vor allem darauf ankommt, schnell den Infizierten zu finden und ihn ebenso schnell zu töten.“
Die Fake-Pandemie hat genau diesen neoliberalen Kampf aller gegen alle auf die vorläufige Spitze getrieben. Das Individuum fürchtete nun nicht mehr allein, dass der andere — das heißt, der besser Qualifizierte, der Wohlhabendere oder „der Flüchtling“ — einem den Job, den Wohnraum oder den Partner wegnimmt, sondern, dass andere, und damit sind dann alle gemeint, einem gleich die die gesamte physische Existenz durch eine tödliche Ansteckung rauben.
Der weiter oben schon zitierte Mattias Desmet und andere haben bereits detailliert herausgearbeitet, dass die Corona-Massenpsychose keinem luftleeren Raum entsprang, sondern aus einem kollektiv-mentalen Humus empor sproß, der durch Jahrzehnte des Neoliberalismus sowie dem entseelten und mechanistisch-materiellen Lebensstils gedieh.
2020 wurden schlicht verborgene Konfliktlinien zu unübersehbaren Gräben. Vermeintliche Freundschaften, die teils seit dem Kalten Krieg bestanden, zerschellten an Corona, wodurch sich im Rückblick die Frage aufdrängte, ob es überhaupt jemals echte Freundschaften gewesen waren. Und wenn nicht, dann hat das gedankliche Virus die Unechtheit dieser Beziehungen sichtbar gemacht. Genauso, wie das Wut-Virus in „28 Weeks Later“ einen familiären Konflikt an die Oberfläche spülte, der hingegen schon vor dieser Epidemie untergründig brodelte.
Insofern können diese beiden Viren in manchen Fällen auch anders begriffen werden, nämlich so, dass die Träger der Viren nicht etwa außer sich sind, sondern im Gegenteil, dass das wahre Selbst, welches zuvor durch Affektkontrolle, Sittentreue und sozialer Maskerade verborgen blieb, mit der Infektion zum Vorschein trat. Statt außer-sich zu sein, sind sie vielmehr bei sich, bei ihrem wahren, bislang verborgenen Kern. Viele Corona-Oppositionelle erkannten während und nach dieser Zeit langjährige Wegbegleiter nicht mehr. Die Frage, wie sich diese einst so vertrauten Menschen derart verwandeln konnten, wich irgendwann dem drängenden Verdacht, dass diese Menschen nie anders gewesen waren — man es aber selbst in all den Jahren und Jahrzehnten nicht erkannte und man erst „28 Years Later“ merkte, dass man einer Illusion aufgesessen war.
Affekt(kontrolle) und (Un)wahrheit
Die enthemmten Affekte, die sowohl mit dem gedanklichen als auch mit dem Wut-Virus einhergehen, legen — wie oben dargelegt — Wahrheiten offen: Den mal uneingestandenen, mal offen verbalisierten Kampf aller gegen alle, falsche Freundschaften und andere Illusionen. Insofern können wir aus den Filmen nicht nur von den Wut-Infizierten etwas über die Zeit ab 2020 lernen, sondern auch von dem Wut-Virus selbst. Dazu müssen wir uns noch einmal vergegenwärtigen, wie diese Wut-Virus überhaupt herangezüchtet wird: Schimpansen wird eine geradezu endlose Videokompilation an Gewaltszenen vorgespielt. Sie erhalten damit audiovisuell in komprimierter Form das, worauf die gesamte Zivilisation, insbesondere Großbritannien fußt: Gewalt und Ausbeutung. Die gesamte Filmreihe „28 (…) Later“ ist insofern ein historischer Treppenwitz, da das — ehemalige? — britische Imperium an seiner eigenen Medizin zugrunde geht und im Inneren selbst von der Gewalt zerfressen wird, mit der es einst die Welt überzogen hat.
Das Wut-Virus fungiert hier also als Spiegel der Zivilisation, genauer ihrer Wurzeln. Als Spiegel begriff auch der Politologe und Psychologe Wilfried Nelles das Corona-Virus und dessen Umgang damit in seinem lesenswerten Buch „Also sprach Corona: Die Psychologie einer geistigen Pandemie“. (11) Ab 2020 wurde so ziemlich alles hochgeschwemmt, was bis dahin unter der Decke brodelte — das Morsche, Verdorbene und Verkommene in geradezu allen gesellschaftlichen Institutionen.
Und obwohl in dieser Zeit so viel offenbart wurde, führte es in der Breite der Gesellschaft nicht zu einem wünschenswerten Umschwung in Richtung Machtbegrenzung, egalitärer Verhältnisse sowie Bewusstwerdung über Herrschaftsstrukturen. Die größte PsyOp in der Geschichte der Menschheit war ein Paradebeispiel für die Affekt-Kanalisierung: Die potenzielle Widerstandsenergie der eingepreisten Widerständler wurde ins Leere, auf Ablenkziele umgeleitet und die Wut der übrigen, die dem Narrativ treu ergeben waren, wurde auf eben jene Gruppe der einkalkulierten Protestler gerichtet. Wut und Hass wurden gefördert, wo es der Herrschaft dienlich war, und umgekehrt Apathie erzeugt, wo Widerstandsenergie die Herrschaftszentren hätte gefährden können.
Hierzu passt, was der weiter oben bereits erwähnte Filmanalyst Wolfgang M. Schmitt in seiner Analyse des ersten Teils anmerkt:
„Es (ist) ein Film (…), der durchaus eine Moral hat. (Wir) sollten (...) noch einmal ganz zum Anfang zurückkehren, nämlich zu den Affen, die dort von den Aktivisten befreit werden. Der Wissenschaftler sagt den Aktivisten: ‚Bitte nicht! Diese Tiere sind hoch ansteckend‘. Er wird gefragt, womit sie denn infiziert seien und er antwortet: ‚Mit Wut‘. Er schwärmt davon, dass er eigentlich doch hier ein Programm aufgelegt habe um zu heilen und dazu musste man erst einmal verstehen, wie die Wut funktioniert. Er sagt: ‚Stellen Sie sich vor, Macht zu haben, Macht über all die Dinge zu haben ,die wir glauben nicht kontrollieren zu können, die Wut, die Gewalt.‘ Die Wissenschaftler suchen nach einem Mittel zur totalen Affektkontrolle, doch durch die Aktivisten wird eben jetzt der Effekt freigesetzt. Die reine Wut. Man könnte das sehr schnell auch in Verbindung bringen mit viralen Affekten, eine Vorwegnahme des heutigen Internets, wenn man so möchte. Die Wissenschaftler arbeiteten dann (...) an einem gehorsamen Subjekt, einem Subjekt, das sich völlig unter Kontrolle hat, beziehungsweise, das man völlig unter Kontrolle bringen kann.“
Hier schließt sich der Kreis mit der von Lilly Gebert skizzierten „Pandemie der Ichlosigkeit“ sowie Michael Nehls beschriebenen Ich-Verlust im „indoktrinierten Gehirn“. Es muss hier wohl zwischen zwei Arten der Wut unterschieden werden. Sowohl in den „28 (…) Later“-Filmen als auch während der Corona-PsyOp gab es nicht nur die Wut bei den Infizierten und den Kultisten, sondern ebenso bei den Nicht-Infizierten, wie auch bei den Maßnahmenkritikern. Beiden Gruppen war gemeinsam, dass sie „außer sich“ waren.
Doch während sich dieses Außer-sich-Sein bei den Erstgenannten unkontrolliert und dauerhaft äußerte, war es bei den Zweitgenannten situativ begrenzt und zielgerichtet: Man war außer-sich … für sich und andere. Man setzte sich etwa wütend für sich und seine Kinder ein – dafür, nicht zum Tragen einer Maske gezwungen zu werden, und für das Recht auf körperliche Unversehrtheit angesichts der giftigen modRNA-Spritze. Diese Form der — nennen wir sie — „heiligen Wut“ war keine blinde Raserei, sondern eine verteidigende, schützende Kraft. Sie diente nicht dazu, in einem permanenten Zustand der Jagd, Abweichler zu verfolgen, wie es die Blockwarte und Denunzianten taten, sondern zielte darauf ab, konkrete, akute Angriffe abzuwehren..
Und auch bezüglich der Figuren in „28 Days Later“ führt Schmitt weiter aus:
„Es ist ja (...) das Herz, das Jim anleitet, wieder zurückzugehen, die Frauen zu befreien, es ist das Herz, das ihn zu nahezu übermenschlicher Wut bringt und diese Wut bringt ihn dann dazu, gegen die Soldaten zu kämpfen. Ähnlich wird Wut freigesetzt bei Selina und Hannah. Ohne diese Wut hätten die drei nicht überlebt. 28 Days Later zeigt hier nicht nur das bindungslose, über alles cool surfende Subjekt des Neoliberalismus, sondern dieser Film zeigt Subjekte des Neoliberalismus, die aber zugleich gegen diesen kämpfen.“
Halten wir fest: Die hier ausführlich skizzierte Wut ist nicht per se etwas Schlechtes. Vielmehr lässt sie sich differenzieren – in „heilige Wut“ und „unkontrollierte Wut“. Letztere wiederum ist mindestens in zwei weitere Kategorien unterteilbar: Eine von außen induzierte Wut — ein durch Angst und Propaganda erzeugter Zustand des „Außer-sich-Seins“, ein Verlust des Selbst durch Manipulation. Eine aus dem Inneren kommende Wut — das Offenlegen einer verdeckten, bislang diszipliniert gehaltenen Charakterstruktur, die erst im Ausnahmezustand zum Vorschein tritt.
Was am Ende bleibt
Wenngleich die „28 Days, Weeks, Years Later“-Filme nicht als fundamental systemkritische Filme zu verstehen sind, was bei den großen Studios ohnehin utopisch wäre, so sind sie doch sehr lehrreich, wenn es darum geht, sich selbst und seine Mitmenschen in der Zeit der Corona-PsyOp und danach besser zu verstehen.
Das Bild der durch eine Infektion tollwütig gewordenen Menschen, die im Rudel versuchen, sich die abweichenden Menschen in das Kollektiv einzuverleiben, ist ein überzeichnetes Sinnbild für die Gesellschaftsdynamik ab 2020.
Für Nonkonformisten und Widerständler bietet diese Metapher eine versöhnliche Perspektive.
Sie ebnet zumindest innerlich den Weg, um Frieden mit dieser Zeit zu schließen — und auch mit den Menschen, die einem in dieser Phase Leid zugefügt haben. So schwer es auch fällt: Sich bewusst zu machen, dass viele in diesen Jahren nicht sie selbst waren, eröffnet die Möglichkeit, die Taten zu verurteilen — nicht jedoch den ganzen Menschen, der sie in einem Zustand äußerster Wut begangen hat.
Wer von den Widerständlern kann von sich mit Gewissheit behaupten, unter anderen Umständen, in anderen Lebenslagen und mit einem anderen Wissens- oder Bewusstseinsstand gegen dieses geistige Virus des Corona-Narrativs immun gewesen zu sein? Nicht selten finden sich in der Corona-Opposition Menschen, die am Anfang — teils sogar bis 2021 — an das offizielle Narrativ glaubten, ehe sie damit begannen, es zu hinterfragen. Will heißen, dass die Grenzen fließend verlaufen können.
Und des Weiteren gab es dann jene Menschen, deren Außer-sich-Sein mehr eine Rückkehr zu ihrem wahren Ich darstellte, ein Aus-sich-Heraustreten aus einer freundlich erscheinenden Rolle. Die Enttäuschung über diese Menschen kann oder muss dann begriffen werden als das Ende einer Täuschung, der Abschied von dem Trugbild, welches man Jahre oder Jahrzehnte von einem Menschen hatte.
Man könnte die Metaphorik dieser Filme noch weiter analytisch ausschlachten. Allein die Handlung des jüngst angelaufenen „28 Years Later“ ist eine anschauliche Metapher für die Brandmauer: Teile der Überlebenden haben sich auf die Gezeiteninsel „Holy Island“ zurückgezogen, die nur über einen schmalen Damm mit dem britischen Festland verbunden ist. Dieses wiederum wird von Kriegsschiffen der NATO-Marine von der übrigen Welt quarantänisert.
Das alles würde an dieser Stelle zu weit führen. Auf eine letzte Metapher, die diese Betrachtung abrundet, sei am Ende noch hingwiesen: Auf dem britischen Festland lebt in eremitischer Einsamkeit der Arzt Dr. Kelson. Sein Lebenswerk besteht darin, die Leichen sowohl der Nicht-Infizierten als auch der Infizierten einzusammeln, zu verbrennen und aus den Knochen und Schädeln eine Art Vanitas-Stillleben in Form eines riesigen Knochentempels zu errichten. Was zunächst klingt, wie das makabere Hobby eines Nekrophilen, offenbart bei näherer Betrachtung einen humanistischen Hintergedanken. Dr. Kelson tut dies — seinen eigenen Aussagen nach — zur Würdigung all der Menschen, zur Würdigung der individuellen Gedanken und Gefühle, die durch diese Köpfe und Leiber gingen. Er gibt damit den unwürdig am Wut-Virus verstorbenen Menschen ihre Würde zurück. Auf der Pyramide aus Totenschädeln ist nicht mehr erkennbar, wer mit Wut infiziert war und wer nicht.
Und so verhält es sich schließlich auch in „unserer Welt“, wenn wir selbige verlassen. An unserem Skelett wird man nicht mehr erkennen können, ob wir links, rechts oder irgendwo dazwischen standen, ob wir geimpft oder ungeimpft waren, für oder gegen Kriegspartei XY, welche Partei wir gewählt oder welchem Fußballverein wir zugejubelt haben — am Ende sind und waren alle das, was sie sind und waren: Menschen!

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
(1) Siehe Desmet, Mattias: „Die Psychologie des Totalitarismus“, München, 2022, Europa Verlag, Seite 134.
(2) Siehe, le Bon, Gustav: „Psychologie der Massen“, Hamburg, 2021, Nikol, Seite 29
(3) Siehe Ebenda
(4) Siehe Ebenda, Seite 37
(5) Siehe Desmet, Mattias, am angegebenen Ort, Seite 139 Fortfolgende
(6) Siehe Rottenfußer, Roland: „Strategien der Macht“, München, 2023, Seite 128.
(7) Siehe Canetti, Elias: „Masse und Macht“, Frankfurt am Main, Fischer Verlag, Seite 325
(8) Siehe Nehls, Michael „Das indoktrinierte Gehirn“, Vörsstetten, 2023, Seite 137 Fortfolgende
(9) Siehe Ebenda Seite 201
(10) Siehe Ebenda Seite 143
(11) Vergleiche Nelles, Wilfried, „Also sprach Corona: Die Psychologie einer geistigen Pandemie“, München, 2021, Scorpio.