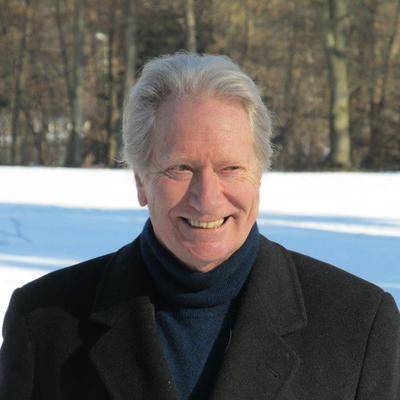Cording informierte sich über Point Venus, bevor er dort auf Maeva traf. Es handelte sich um den nördlichsten Punkt Tahitis. Im November 1767 hatte die britische Royal Society ein Komitee berufen, das Vorbereitungen für eine Pazifikreise unter dem Kommando von Kapitän James Cook treffen sollte. In London war man nämlich nervös geworden, seitdem sich Bougainvilles Vormarsch in den Südpazifik herumgesprochen hatte. Auch die Berichte des zurückgekehrten Samuel Wallis, dessen Begleiter südlich von Tahiti mächtige Gebirge ausgemacht haben wollten, sorgten für erhebliche Unruhe. Lag dort vielleicht die ‚ Terra australis’, der Traumkontinent mit künftigen Flottenbasen, Bergwerken, Plantagen und Millionen arbeitsamer, kauflustiger, steuerzahlender Untertanen?
Offizielles Ziel des Unternehmens war es, den für den 3. Juni 1769 erwarteten Venustransit — eine seltene Gestirnskonstellation, bei der die Venus in das unmittelbare Blickfeld zwischen Erde und Sonne gerät — von einer klimatisch begünstigten Südseeinsel aus zu beobachten. Maß man die Zeitdauer dieses Phänomens, ließen sich daraus verschiedene kosmische Entfernungen berechnen, von denen die Engländer sich eine hervorragende Navigationshilfe versprachen.
Die Cook-Mission wurde ein Flop. Die Atmosphäre der Venus verschleierte Beginn und Ende des Transits, die gesammelten Daten wichen extrem voneinander ab. Aber etwas Gutes hatte die Mission dennoch: es war James Cook, der Tahiti den ursprünglichen Namen ‘Otaheite’ zurückgab, nachdem Wallis aus Loyalität zu seinem König die nicht sehr originelle Bezeichnung „Georg III.-Insel“ erfunden hatte. Der Name ‘Otaheite’ beruhte auf einem Missverständnis des Kapitäns, der den Satz „das ist Tahiti“ für den Namen der Insel gehalten hatte.
Cording wartete wie verabredet an dem viereckigen Leuchtturm auf Maeva. Er las auf einer etwas abseits stehenden Tafel, dass es der tahitianische König Pomare II. gewesen war, der 1815 die Bibel in die Maori-Sprache übersetzt hatte. Er war es auch, der auf Veranlassung der Missionare die Gesetze geändert hatte. Plötzlich standen Dinge unter Strafe, die seine Untertanen für selbstverständlich hielten. Vielweiberei zum Beispiel. Wer sich eines solchen Vergehens schuldig machte, musste nun vierzig Klafter Weg anlegen, und wer sich betrank, sollte zwei Matten flechten, eine für den König und eine für den Bezirkshäuptling.
Selbstverständlich war Pomare II. über das Gesetz erhaben. Sonst wäre sein Leben sicherlich unter Wegearbeiten und Mattenflechten dahin gegangen. Noch heute erzählten die Tahitianer davon, wie sich dieser charakterschwache Herrscher allmorgendlich in seinen Strandpavillon begab, die Bibel unter dem einen, eine Flasche Rum unter dem anderen Arm. Sobald er merkte, dass sich seine Sinne umnebelten, pflegte er vorwurfsvoll zu sich selbst zu sagen, was seitdem zum geflügelten Wort auf Tahiti geworden war: „Pomare, Pomare! Jetzt ist selbst dein Schwein klüger als du!“
„Iaorana“, hauchte ihm Maeva von hinten ins Ohr. Sie hatte sich unbemerkt genähert und hakte sich nun bei ihm unter, was sie zuvor noch nie getan hatte. Dann führte sie ihn über eine kleine Holzbrücke an den weiten Strand. Unterhalb der Kokospalmen, die an der äußersten Landzunge einen kleinen Hain bildeten, setzten sie sich in den Sand. Er hatte erwartet, dass Maeva nun zu einer Erklärung über das Geheimnis dieses Platzes ansetzen würde, stattdessen verharrte sie wortlos in ihrer Hinano-Haltung und schaute versonnen aufs Meer hinaus. An den Ufern der mächtigen Matavai-Bucht saßen ganze Familien in der Dünung. Nicht weit von ihnen entfernt lag eine korpulente Frau auf dem Bauch, ihre Fersen blitzten in den plätschernden Wellen auf wie rosa Perlen. Der Mann hielt ein Baby in den Armen und schaufelte ihm beständig Wasser über die Schultern. Ein junges Liebespaar stolzierte Hand in Hand in den flachen Ozean, als wollten es den unterseeischen Göttern einen Besuch abstatten. Als das Wasser ihre Hüften umspielte, löste das Mädchen ihr Haar und fiel dem Liebsten um den Hals. Die beiden wiegten sich in der Brandung wie eine sturmerprobte Schlingpflanze.
Cording musste an Immanuel Kant denken, der seine Leser ironisch gefragt hatte, ob „die glücklichen Einwohner von Otaheite eine befriedigende Antwort auf die Frage geben könnten, warum sie denn gar existierten, und ob es nicht eben so gut gewesen wäre, dass diese Insel mit glücklichen Schafen und Rindern als mit dem bloßem Genusse zugeneigten Menschen besetzt gewesen wäre.“ Unglaublich, dieser Königsberger Klops. Im Gegensatz zum Meister des kategorischen Imperativs wurde Cording auf Tahiti wieder großer Gefühle fähig. Gelegentlich sah er sich von ihnen überfordert, weil seine innere Statik noch nicht stimmte, aber der kleinste Anflug eines Duftes, eine simple Geste, Geräusche, Farben — alles hier war geeignet, seinen allein dem Verstand gehorchenden Kopf kräftig zu durchlüften.
Maeva schien genau zu spüren, wenn ihr Begleiter wieder einmal aus der vordergründigen Betrachtung in die hintergründige Reflexion geraten war.
„Dort draußen leben die Rosen von Matavai“, bemerkte sie scheinbar beiläufig. „So nennen wir die rosa Korallen, die sich in einer Tiefe von zwanzig bis dreißig Metern flächenartig über dem Boden ausbreiten. Wenn ein Mann dort hinabtauchte, um seiner Angebeteten die Rose von Matavai zu pflücken, zeigte er, dass er sie verdient hatte, dass er mutig genug war, um sie zu beschützen. Aber heutzutage lassen wir die Korallen in Ruhe, jetzt gehen wir der Rose nur noch symbolisch entgegen.“ Sie erhob sich und strich ihren Wickelrock glatt, den die Tahitianer Pareu nannten. „Ich muss in die Uni. Sehen wir uns morgen?“
„In die Uni?“
„Oia.“
„Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich Sie gerne begleiten“, antwortete Cording und folgte ihr zu der Dockstation, an der man sich ein Auto nehmen konnte. Auf dem Weg dahin entdeckte er Dutzende junger Liebespaare am rückwärtigen Ufer, viele von ihnen machten sich andächtig auf, den Ozean zu Fuß zu erobern. Dies war in der Tat ein magischer Ort.
Als sie den Hügel zum Universitätsgelände hinauffuhren, erwartete er jene weitläufige Aluminiumkonstruktion vorzufinden, die seit Beginn des neuen Millenniums über Faaa thronte. In damaligen Regierungskreisen war man mächtig stolz auf das Bauwerk gewesen, doch Cording hatte bei seinem Besuch vor neun Jahren eher den Eindruck gehabt, als hätte die Postmoderne Tahiti im Vorüberfliegen auf den Kopf geschissen. Die Architekten hatten keinerlei Bezug zur Landschaft hergestellt, sie ignorierten sogar die besonderen klimatischen Umstände.
Maeva stellte den Wagen unterhalb des Uni-Geländes ab, dort wo die Straße endete. Die Fahrt wurde nach Kilometern berechnet und per Chipkarte beglichen. Auf der fußballfeldgroßen Fläche waren außer ihrem Gefährt noch sieben andere Solarfahrzeuge an der Aufladestation geparkt, umgeben von mindestens dreihundert Fahrrädern.
Cording stieg aus und traute seinen Augen nicht. Über den Wipfeln des ansteigenden Parks erhoben sich drei mächtige halbrunde Holzkonstruktionen, die nach hinten hin offen waren. Es sah aus, als lägen drei Riesen auf der Lauer, die ihren bombastischen Federschmuck im Gebüsch nur spärlich zu verbergen wussten. Die Türme hatte die Form einer Bischofsmütze, sie waren jedoch nach oben hin offen. Welche Eleganz, welche Leichtigkeit diese Architektur doch verströmte! Als sie auf dem Gipfel angekommen waren, stellte Cording fest, dass es noch zwei weitere solcher Gebäude gab. Hinter ihnen befanden sich die einstöckigen Hörsäle, der Verwaltungstrakt und die Mensa. Die tiefblauen Solarpanels auf den Dächern und Fassaden sahen aus, als hätten sie sich mit dem Licht Tahitis vollgesogen.
„Wo ist das Aluminiummonster geblieben?“, fragte er sichtlich perplex.
Maeva hob die Hände wie eine Magierin, die man gerade gefragt hatte, wie ihr bester Trick funktioniert. Dann eilte sie ins Gebäude und verschwand im Hörsaal 4. Cording schlenderte den endlos langen Flur hinunter und studierte die Zettelwirtschaft an den Schwarzen Brettern, die er nicht entziffern konnte, da die Botschaften durchgängig in einheimischer Sprache verfasst waren. Die Studenten, die ihm auf seinem Weg begegneten, waren auffallend jung, einige fast noch Kinder.
An der Tür zum Sekretariat hielt er kurz inne, bevor er eintrat. Er stellte sich den beiden anwesenden Frauen als einer der Journalisten vor, die zur Zeit auf der Insel recherchierten, und wurde äußerst zuvorkommend begrüßt. Leider sei die Direktorin erst morgen wieder zu sprechen, teilten die Damen ihm mit. Als er fragte, ob es irgendwelche Unterlagen zu der Architektur und den Lehrplänen der Universität gäbe, blickten sich die Frauen irritiert an.
„Das müsste sich alles in deiner Pressemappe befinden“, sagte die Ältere der beiden.
„Tut mir leid“, log er peinlich berührt, „ich habe nichts dergleichen bekommen.“
„Oh.“
Die Sekretärinnen sprangen auf und machten sich mit Eifer an den Aktenschränken zu schaffen. Nach wenigen Minuten hielt er einen stattlichen Stapel Papiere in Händen, vermutlich die gleichen, die seit Wochen unbesehen im Hotelzimmer herumlagen. Er dankte und suchte sich draußen am Hang ein stilles Plätzchen für das Studium.
Da stand es: die alte Universität war vor drei Jahren durch einen Sturm beschädigt und danach vollständig abgetragen worden. Die Pläne für den Neubau stammten aus der Schmiede des italienischen Architektenbüros Renzo Piano. Es handelte sich um dasselbe Büro, das auch für das Jean-Marie Tjibaou-Kulturzentrum auf Neu-Kaledonien verantwortlich zeichnete, welches 1998 weltweit für Aufsehen gesorgt hatte. Wie das kaledonische Kulturzentrum war auch Tahitis „Freie Umweltuniversität“, so der offizielle Name, ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen errichtet. Holz, Bambus, Hanfbeton und Lehm — das waren die Materialien, aus denen das fantastische Gebilde zu seinen Füßen bestand. 196 Bambusstützen, so belastbar wie Stahl, gaben dem Gebäude seinen Halt.
Cording verzichtete darauf, sich die Vorzüge natürlicher Baustoffe im Detail erklären zu lassen, damit konnte er schon mal zwei Drittel der Papiere beiseite legen. Viel interessanter war für ihn im Augenblick die inhaltliche Ausrichtung der Universität. Er wollte schließlich gewappnet sein, wenn er wieder auf Maeva traf.
„Tahitis Freie Umweltuniversität“, las er, „organisiert Kurse, Seminare, Technikertreffen, Veröffentlichungen und Veranstaltungen, die helfen sollen, durch die Verbreitung ökologischer Prinzipien und sozialethischer Grundsätze und Wertvorstellungen das Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung zu entwickeln. Gleichzeitig fasst die Universität die im Umweltmanagement gewonnenen Erkenntnisse systematisch zusammen und stellt sie als Datenbank weltweit zur Verfügung.“ Verstanden. Er fragte sich nur, warum es nicht einmal auf Tahiti gelang, den offiziellen Statements so etwas wie sprachliche Geschmeidigkeit zu verleihen.
Soweit er den Unterlagen entnehmen konnte, gab es vier Studienzweige, auf die besonderes Gewicht gelegt wurde. Zum Ersten das „Umweltprogramm für die Jugend“. Durch Freizeitaktivitäten in den Bereichen Gemüse- und Obstanbau, Gartenbau, Kompostierung, Ernährung und Handwerk sollten die Kinder erkennen, wie man die Umweltbedingungen auf der Insel verbessern konnte. Die Aktivitäten wurden mit den Gemeinden koordiniert, die Produkte der eigenen Arbeit verkauft. Als zweites wurde ein „Umweltarbeitsprogramm“ genannt, das vor allem für 14- bis 17-Jährige vorgesehen war. Parallel zum verpflichtenden Schulbesuch bildete die Universität Jugendliche zu Gärtnern oder Fischern aus. Der dritte Schwerpunkt hieß „Lehrerausbildungsprogramm“.
Es ging vor allem darum, neue pädagogische Methoden zu entwickeln, mit denen das Interesse der Jugend an Umweltfragen geweckt und aufrecht erhalten werden konnte. Schließlich war da noch der Kurs „Praxisorientierte Umwelterziehung“, aus dessen Beschreibung Cording nicht recht schlau wurde. Offenbar wurde er in enger Kooperation mit dem Umweltministerium organisiert, das den Studenten Einblicke in die Landschaftsplanungen der Regierung gewährte und Exkursionen in die Natur anbot, auf denen über die heimische Flora und Fauna aufgeklärt wurde.
Cording überlegte, wo er den gigantischen Papierstapel unbemerkt entsorgen konnte, aber dann besann er sich. Das Risiko, von irgendeinem Kind entdeckt und bei der Direktion denunziert zu werden, war ihm zu hoch. Wer weiß, was für aufmerksame kleine Ökokrieger sie sich inzwischen herangezüchtet hatten. Er nahm den Stapel unter den Arm und marschierte schnurstracks in den Hörsaal Nummer 4, der allerdings verwaist war.
„Die Professorin ist schon weg“, bemerkte ein etwa zwölfjähriger Knabe, der sich ihm unbemerkt genähert hatte. „Woher kommst du?“, fragte er, als Cording nicht antwortete.
„Ich komme aus Deutschland.“
„Ist das in Frankreich?“
„So ungefähr.“
Der Junge knöpfte sich zögernd das bunte Hemd auf und deutete stolz auf sein T-Shirt. Cording blickte verwundert auf ein verblasstes adidas-Logo.
„Darfst du das überhaupt tragen?“, fragte er augenzwinkernd.
Der Junge rannte davon.
„He, warte, wo ist die Professorin denn hin?“, rief ihm Cording hinterher.
„Die sind Fischen gegangen!“, rief der Junge zurück.
„Und wo?“
Weg war er. Maeva unterrichtete also hier, interessant.
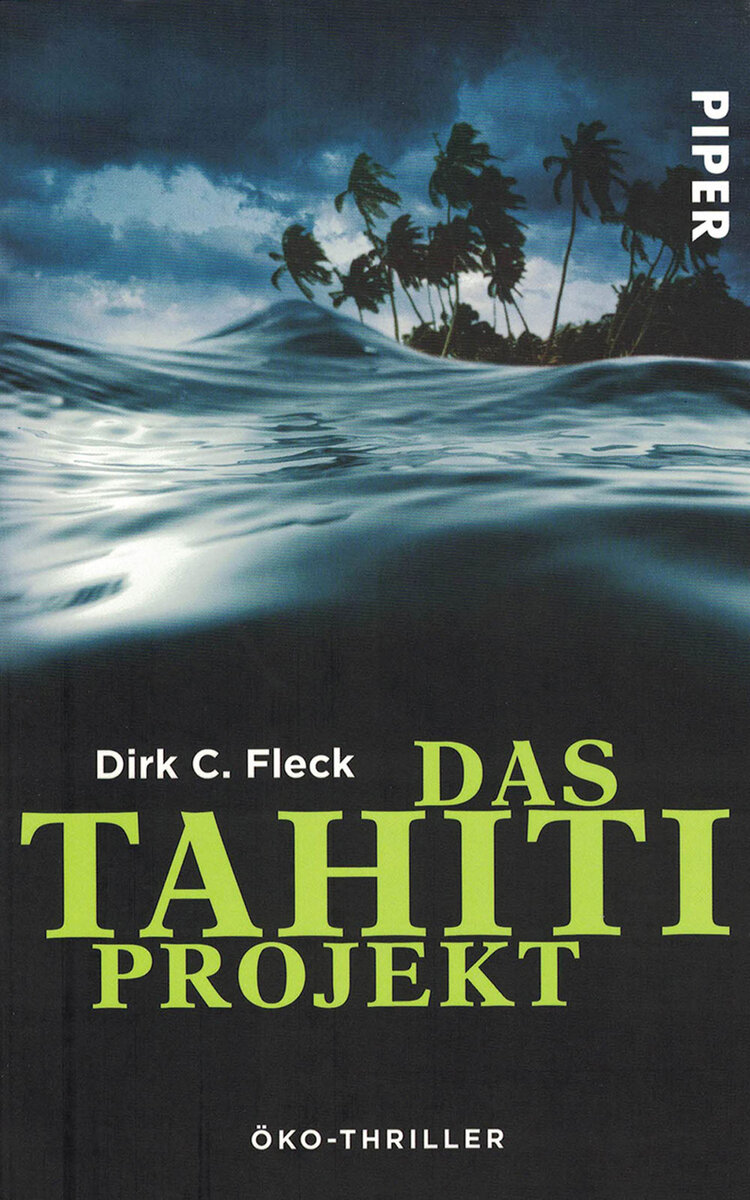
Hier können Sie das Buch bestellen: equilibrismus.org

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
*Die Erklärungen der im Roman verwendeten Fachbegriffe sowie Hinweise für interessierte Leser auf weiterführende Literatur oder Webseiten befinden sich im Buch. Obwohl das „Tahiti-Projekt“ ein Zukunftsroman ist, sind die in ihm dargestellten technischen Lösungen und sozioökologischen Modelle keine Fiktion: sie existieren bereits heute! Das einzig Fiktive ist die Annahme, dass irgendwo auf diesem Planeten tatsächlich mit konkreten Veränderungen in Richtung auf eine zukunftsfähige Lebensweise begonnen wurde.