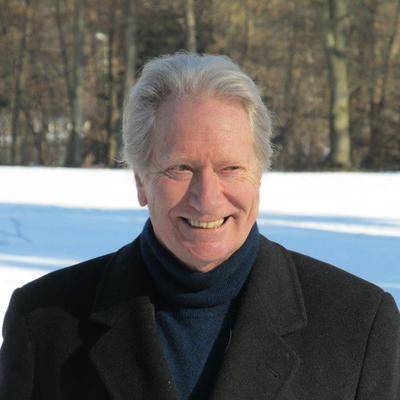Der Widerstand
Shocking Turner öffnete die Studiotür mit dem Ellbogen.
„Na endlich!“, rief sein Tontechniker Mavis, „die Leute spielen verrückt, sie wollen dich hören, Mann!“
„Das ist gut“, antwortete Turner, „das ist sehr gut!“
Sie klatschten ab. Turner stülpte sich den Kopfhörer über das schwarze Lederkäppi, setzte sich ans Mikrofon und gab Mavis ein Zeichen.
„Guten Morgen, Freunde! Hier ist Shok-Shok-Shocking Turner! Euer Shocking hat heute besonders gute Laune und er hofft, dass es euch Flaschen genau so geht! Also lüftet gefälligst die fetten Ärsche und steigt aus euren Pappkartons! Ich habe euch nämlich etwas zu sagen, Freunde, ich habe euch etwas zu sagen ... Here comes the sun!“
Während die längst vergessene Hippie-Hymne der Beatles vom Band lief, machte sich der Moderator daran, sich willkürlich einige Nummern aus dem elektronischen Telefonbuch von Queens, der Bronx und Harlem zu notieren.
„Was soll das, Mann?“, fragte Mavis.
„Keine Fragen, Honey, keine Fragen! Ruf diese Leute an und stell sie mir durch. Okay?“
Turner hörte mit geschlossenen Augen in eine LP, die auf dem zweiten Plattenteller rotierte. Sie kratzte gewaltig, aber dies war der Sender des Vinyls, sie lebten von solchen Kultkratzern.
„Ich hoffe, Leute, ihr habt euch inzwischen den Schorf von den Wunden gekratzt und seid frisch und munter. Shocking will, das ihr munter seid. Wir haben lange genug gepennt, damit muss Schluss sein! Eine neue Zeit ist angebrochen und ihr Prophet heißt Omai! Es ist Krieg, Freunde, Omais Krieg! Gewaltlos und zauberhaft. Und wir sind seine gottverdammte Armee! Unsere Farben sind black, white, yellow and red und dies ist unsere Hymne: ‚Brothers in Arms!‘“
„Scheißjob“, hörte er Mavis sagen, „keiner von den Leuten, die du angekreuzt hast, hat jemals von dem Tahiti-Projekt gehört.“
Er signalisierte dem Moderator, dass ein Anruf in der Leitung sei. Turner kümmerte sich nicht darum, er legte den Kopf zurück und schloss die Augen. Das Geheimnis seiner Moderation bestand darin, sich keine voreiligen Gedanken zu machen. Seine Stärke war die Improvisation.
„Vergesst die Motherfucker aus den anderen Sendern, sie haben euch nichts zu sagen! Dies hier ist die Welle der Sympathie! WNYC auf Ultrakurzwelle einundneunzigkommadrei! Mein Name ist shocking: ich heiße Turner! Ich wende das Blatt! Am Telefon ist Chrissie Burnett, zu Gast aus Chicago. Lass mal hören wie alt du bist, Chrissie?“
„Siebzehn.“
„Süße siebzehn. So alt werde ich nie. Bevor du sagst, was du auf dem Herzen hast, möchte ich dir erzählen, was heute Nacht passiert ist. Wir haben eine E-Mail aus Tahiti bekommen. Von Steve, er wird jeden Moment anrufen. Steve ist viel älter als du, achtzehn, um genau zu sein. Er hat mir versichert, dass er es ist, der den Widerstand im Internet organisiert. Die Home-Page heißt ‚www.tahiti-project.org.‘ Merkt euch das. Ich wiederhole das jetzt jede Stunde. ‚www.tahiti-project.org.‘ Was wolltest du uns sagen, Chrissie?“
„Naja, ich finde das schon endgeil, was du machst, aber manchmal denk ich, man sollte auch mal was tun und nicht nur quatschen.“
„Ich bin Moderator, Chrissie, ich quatsche gern. Aber sag: Was können wir deiner Meinung nach tun?“
„Die Brooklyn-Bridge besetzen zum Beispiel. Jeden Abend zur Rushhour. Klar, sie werden uns einsperren, aber so viele Gefängniszellen gibt es im ganzen Land nicht, wie sie brauchen werden. Ich meine, wenn man so etwas erst einmal angestoßen hat, ist es nicht mehr zu bremsen.“
„Da sprach die Weisheit des Alters aus dir. Danke, Chrissie. Was immer du vorhast, wir geben dir ein Forum. Okay, Leute, hier ist Mr. David Bowie und ‚Heroes‘. Just for one day ...“
Turner bat Mavis, ihn eine Viertelstunde in Ruhe zu lassen. Er rief das Tahiti-Projekt auf den Schirm. Gute Arbeit. Nicht nur, dass die ökologischen Errungenschaften in allen Einzelheiten vorgestellt wurden, dass man Tänze downloaden konnte und mit der Geschichte Polynesiens vertraut gemacht wurde — die Links führten auch zu den Rasmussen-Papieren sowie zu den Fotos der „South Pacific“. Darüber hinaus wurde jeder weitere Schritt, den Steve im Internet zu unternehmen gedachte, angekündigt. Ab morgen würde dort jeden Tag ein neuer Spruch des Propheten Omai veröffentlicht werden.
Mavis klopfte wie verrückt an die Scheibe.
„Tahiti!“, brüllte er.
Turner nahm das Gespräch an.
„Hi, Steve!“, begrüßte er den Anrufer. „Bist du bereit, mit uns auf Sendung zu gehen?“
„Kein Problem.“
„Okay, zwanzig Sekunden ... Ich bin froh, Mann, dass du angerufen hast. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins! Hi, Leute! Ich bin jetzt mit Steve Parker verbunden, dem Mann, der von Tahiti aus den Internetauftritt des Tahiti-Projekts organisiert. Wie läuft es denn so, Mann?“
„Fantastisch. Wir verzeichnen täglich mehr als eine Million Zugriffe auf unsere Website, Tendenz stark steigend. Aber bevor wir weiter reden, möchte ich dir danken, Shocking. Was du für uns machst, ist großartig. Wir bräuchten viel mehr von deiner Sorte.“
„Keine Angst, Mann, ich hab schon mit einigen Kollegen in L.A., in Boston und Seattle gesprochen, die wollen ebenfalls voll einsteigen. Wir hören nicht eher auf, bis die Schweinebande von Global Oil die Segel streicht, verlass dich drauf. Hier ist WNYC, ich bin verbunden mit Steve Parker, Omais wichtigstem Ökokrieger. Gleich wird uns Steve erzählen, wie es sich so lebt im sonnigen Ökoparadies. Aber zunächst hören wir Lou Reed mit ‚Last Great American Whale‘. Man beachte die feinsinnige Lyrik, mit der Lou unsere Landsleute beschreibt: ‚Steck ihnen eine Mistgabel in den Arsch und dreh sie um, sie sind fertig ...‘“
Cording verbrachte eine geschlagene Woche damit, die Journalisten, die mit ihm vor Ort über das Tahiti-Projekt recherchiert hatten, mit allen Informationen zu versorgen, die notwendig waren, um die Geschichte dramatisch fortzuschreiben. Fünfunddreißig der mühsam kontaktierten Kollegen teilten ihm umgehend mit, dass ihre Redaktionen zur Zeit kein Interesse an dem Mangan-Thema hätten. Vier hatten versprochen, sich an höchster Stelle für einen Bericht einzusetzen, zehn von ihnen waren nicht erreichbar, unter ihnen die einzigen Personen, mit denen er näher bekannt geworden war: Meredith Rose, John Knowles und Jorge Luis Sabato. So etwas nannte man wohl einen Schlag ins Kontor. Dass es mühsam werden würde, die großen Medienhäuser für diesen Politskandal zu interessieren, war Cording schon vorher klar gewesen. Sie gehörten Verlagsgruppen an, deren Mehrheitsgesellschafter in der Wirtschaft angesiedelt waren. Keiner von den zwölf größten international agierenden Konzernen hatte es versäumt, sich seine journalistische Hausmacht zu sichern. Heute hielt man sich Printmedien und Fernsehsender anstatt Fußballvereine. Der Kampf David gegen Goliath war nur mit Unterstützung der Unerschrockenen im Gewerbe zu führen und davon gab es wenige.
Nur gut, dass Omai zu keiner Zeit wissen wollte, wie die Pressearbeit voranging. Er war wie geblendet von den fast täglich eintreffenden Berichten und Reportagen über das Tahiti-Projekt. Dass der ökologische Umbau in der Regel mit leicht bekleideten, betörend lächelnden Südseenymphen illustriert wurde, war vorauszusehen. Besonders beliebt: der Reva-Tae. Die Fotos von sich lasziv in den gläsernen Kabinen rekelnden Südseeschönheiten, erinnerte eher an einen anzüglichen Urlaubsprospekt, als an eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Tahitis neuem Weg.
Bis auf EMERGENCY und zwei, drei andere Magazine hatten alle eingeladenen Publikationen ihre Pflicht erfüllt. Cording fragte sich, warum Mike die Veröffentlichung seiner Reportage bisher zurückgehalten hatte. Bald wäre das Thema Tahiti verbrannt, dann würde kein Hahn mehr danach krähen.
Cording ging ans Fenster seines Büros und schaute dem Platzregen zu, der die Palmen im Innenhof ohrfeigte. Er war wieder einmal an jenem Punkt angelangt, an dem der Überdruss zur Person wird, zur verkörperten Fiktion seines Zusammenlebens mit sich selbst. Es gibt eine Müdigkeit der abstrakten Intelligenz, hatte Fernando Pessoa gesagt. Sie lastet nicht auf einem wie die Müdigkeit des Körpers, beruhigt auch nicht, wie die Müdigkeit nach einer Anstrengung. Es ist die Last des Weltbewusstseins, ein Nicht-mit-der Seele-atmen können.
„Iaorana ...“ flüsterte Maeva.
Ihr warmer Atem kitzelte sein Ohr. Cording umarmte sie wie eine Heilsbringerin. Während er sich eben noch darüber Gedanken gemacht hatte, ob er ihr seine Stimmungsschwankungen überhaupt noch zumuten durfte, benahm er sich plötzlich wie ein streunender Hund, dem man sich unversehens angenommen hatte. Er wollte diesen geschmeidigen Körper, gar nicht mehr loslassen. Das musste er aber, denn Maeva war gekommen, um ihn abzuholen.
Omai hatte sie beide eingeladen, mit ihm nach Raiatea zu fliegen. Er wollte den dortigen Bürgermeister um Hilfe bitten — wofür genau, das behielt der Präsident für sich. Er glaubte, dass man einer Idee nur schadete, wenn man sie vor der Zeit benannte. Dass er nicht einmal Cording einweihte, wertete dieser nicht etwa als Vertrauensverlust, sondern als Beleg dafür, dass sich etwas Großes ankündigte, was ihrem Kampf sicher mehr Impulse verleihen würde, als seine bisher von wenig Erfolg gekrönten Bemühungen, die Weltpresse an ihre Seite zu holen, um das zarte Pflänzchen eines so überaus attraktiven Bewusstseinswandels nicht wieder von den Interessen des Kapitals ignorant in den Staub getreten zu sehen.
Sie landeten im Norden der Insel, bei Uturoa. Vor der Revolution hatten die Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Uturoa Zwischenstopps eingelegt, das Städtchen hatte sich infolgedessen zu einem veritablen Handelszentrum entwickelt. Mittlerweile war es wieder auf Normalgröße geschrumpft. Von der Steilküste bot sich Cording ein herrlicher Blick über die Lagune zur Nachbarinsel Tahaa. Die Tahitianer behaupteten, dass die beiden Inseln einst zusammengehörten, bis sie durch einen vom Geist einer Prinzessin besessenen Aal getrennt worden waren.
Während Omai in Begleitung des Clanchefs das Verwaltungszentrum in Uturoa aufsuchte, machten sich Maeva und Cording an der Ostküste Richtung Süden nach Opoa auf, der spirituellen Hauptstadt Polynesiens. Der Avera-Bezirk, den sie durchquerten, war Ende des 19. Jahrhunderts das letzte Schlachtfeld des französisch-tahitianischen Krieges gewesen.
„Dass die Franzosen uns bis hierher verfolgten, nehmen wir ihnen heute noch übel“, sagte Maeva. „Dies ist Raiatea, die Wiege der polynesischen Kultur!“
Auf Raiatea waren vor über tausend Jahren die ersten Maori gelandet, auf riesigen Bambusflößen. Von hier aus brachen sie später zu ihren großen polynesischen Entdeckungsfahrten auf. Sie nannten die Insel „Hawaiki“ — „Die Heilige“. Und als heilige Insel galt Raiatea — „Himmel mit sanftem Licht“ — noch heute.
Während sie auf ihren Fahrrädern der sich windenden Uferstraße durch Felder und Vanillepflanzungen folgten, lauschte Cording wieder einmal einem Exkurs in tahitianischer Geschichte. Auf dem Berg Oropira war die Lanze gelandet, mit der Halbgott Pai das Gebirge von Moorea durchlöchert hatte. Wenn Maeva ihre Welt erklärte, hatte er jedes Mal das Gefühl, an einer sinnlichen Speisung teilzunehmen. Als sie auf die heilige Riffpassage Avamo’a aufmerksam machte, durch die seit Jahrhunderten die Pirogen des Pazifiks ihren Weg zu der königlichen Kultstätte Taputapuatea gefunden hatten, glaubte sich Cording zum ersten Mal in den zeitlosen Mittelpunkt der Geschichte versetzt, während er im sogenannten Abendland vor ihr hergetreten wurde und die Rückschau immer nur bis Auschwitz reichte.
Der Marae Taputapuatea war bis heute erhalten. Sie stellten die Fahrräder ab und spazierten ins Innere der imposanten Anlage, die aus wuchtigen, in geraden Reihen aufgerichteter Korallenplatten bestand. Cording legte sich auf den Rücken und empfing Maeva mit ausgebreiteten Armen. Sie genoss die Massage, die er ihrer Kopfhaut angedeihen ließ. Als er aufhörte, stupste sie unwirsch mit dem Kopf.
„Erzähl mir mehr von Raiatea“, sagte er, „solange du sprichst, bekommst du meine Zauberfinger zu spüren ...“
Maeva boxte ihn. Wenn das die Schläge waren, die jemand für ungebührliches Verhalten einzustecken hatte, wünschte er sich sein Leben als einen einzigen Boxkampf.
„Na, was ist?“, hakte er lachend nach.
Sie erzählte ihm von den Navigationskünsten der Maori, die die Besiedelung Polynesiens ermöglicht hatten. Maeva hatte sicher recht, wenn sie dies als eine der großen Kulturleistungen der Menschheit bezeichnete. Die Flöße aus Melanesien und Mikronesien legten schon vor Christi Geburt Tausende von Seemeilen zurück, bevor die Entdecker auf die winzigen Eilande des Südpazifiks trafen. Das Gebiet, das sie unter primitivsten Bedingungen zwischen Neuseeland, den Osterinseln und Hawaii erschlossen, war größer als die Oberfläche des Mondes. Navigiert wurde nach der Beobachtung von Sonne und Sternen, nach den Winden, anhand von Wolkenformationen, der Dünung und der Strömung sowie nach dem Zug der Vögel. Eigentlich sollte man der ‚South Pacific‘ das GPS ausbauen und das Radar zerschmettern, bevor man den Tanker davonjagte. Wäre interessant zu wissen, dachte Cording, wo sie dann wohl landen würden ...
Als Maeva geendet hatte, hörte auch Cording auf mit der Massage.
„Wenn ich auf maorisch weiter rede, machst du dann trotzdem weiter?“, fragte sie und führte seine Hand ungeduldig in ihren Nacken.
„Kein Problem. Hauptsache du hörst nicht auf zu sprechen“, sagte er. „Aber dir ist hoffentlich klar, dass ich nichts von dem verstehe, was du mir jetzt sagen willst ...“
„Du verstehst das schon“, antwortete sie lächelnd und blickte ihm tief in die Augen, als sie ins maorische wechselte. Ihre tiefe, weiche Stimme wurde durch die eigene Sprache noch einmal veredelt, die tahiatianischen Vokalgesänge saßen als blitzende Krönchen darauf. Als sich seine Hand unter ihrem Pareu auf blankem Rücken den neuralgischen Punkten am Ausgang der Wirbelsäule näherte, gebot ihm Maeva durch einen heftigen Kuss Einhalt.
„Wir müssen gehen“, sagte sie, „ich möchte dir noch etwas zeigen, bevor wir Omai treffen.“
Die Fahrt entlang der Westküste war zwar beschwerlich, versöhnte sie aber mit herrlichen Ausblicken auf die Lagune, in der kleine Inseln die Köpfe hoben wie ertappte Seeungeheuer beim Nacktbaden, während sie zur Rechten mit dem Anblick rauschender Wasserfälle, üppiger Wiesen und leuchtender Obstgärten belohnt wurden. Gut, dass er mit dem Rauchen aufgehört hatte, die zweistündige Strampelei hätte ihm vor drei Monaten noch den Rest gegeben. So aber konnte er Maeva ohne große Schwierigkeiten folgen, nachdem sie die Räder abgestellt hatten und auf engem Pfad den Gipfel des heiligen Berges Temehani erklommen, von dem die Völker der Südsee glaubten, dass er für ihre Ahnen Paradies und Hölle zugleich war.
Auf dem polynesischen Olymp angekommen, heftete Maeva ihre Augen auf den Boden und wanderte behutsam im Kreis. Schließlich kniete sie nieder und winkte ihn zu sich. Sie zeigte auf eine weiße Blume, die Tiaré apetahi, das Wahrzeichen Raiateas. Im Gegensatz zu der Tiaré, die sie im Haar trug — nach ihrer Verlobung in Point Venus wieder auf der linken Seite — verfügte diese nicht über acht, sondern nur über fünf Blütenblätter, die auch nicht von der Mitte auseinander liefen, sondern sich alle derselben Seite zuneigten. Die Blüte war eingefasst von einem Kranz fleischiger, gezackter Blätter, die sie umstanden wie eine Leibwache.
„Die Tiaré apetahi ist einzigartig auf der Erde“, bemerkte Maeva. „Sie wächst ausschließlich auf dem Gipfel des Temehani. Bisher ist jeder Versuch, sie woanders anzusiedeln, fehlgeschlagen. Botaniker in aller Welt streiten heute noch, warum das so ist. Wir wissen warum ...“
„Warum?“, fragte Cording.
Maeva schien seine Frage überhört zu haben. Sie saß mit geschlossenen Augen vor ihm, als würde sie beten.
„Wusstest du, dass sich in keiner der polynesischen Sprachen ein eigenständiges Wort für Religion findet?“, fragte sie, ohne die Augen zu öffnen.
„Nein, wusste ich nicht.“
„Warum ist das so? Was glaubst du?“
Cording erinnerte sich, dass dies auch für die nordamerikanischen Indianerkulturen zutraf. Aber er verzichtete auf den Hinweis, um sich nicht in seinem jämmerlichen Halbwissen zu verstricken.
„Welche Energie lässt dein Herz schlagen?“, hakte Maeva nach. „Oder bist du an eine Steckdose angeschlossen?“
Cording fühlte sich nicht wohl bei diesem „Verhör“, eine simple Frage hatte ausgereicht, ihm das gesamte Defizit der abendländischen Denkweise vor Augen zu führen.
„Wir haben das Wort Religion nicht nötig“, fuhr Maeva fort, „das ganze Leben ist Religion für uns. Wir machen keinen Unterschied zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt. Hier wie dort ist alles von dem selben Geist durchdrungen. Jede materielle Erscheinung besitzt ihr eigenes Mana, das uns auf magische Weise miteinander verbindet, uns sozusagen zu einem Körper verschmelzen lässt. Unter Mana verstehen wir die spirituelle Energie, die den Dingen und Personen innewohnt. Es ist die universelle Kraft, die jede materielle Form mit Leben erfüllt. Ob Stein, Pflanze, Tier oder Mensch: alles ist beseelt, alles besitzt sein eigenes energetisches Kraftpotential. In seiner elementaren Bedeutung meint Mana einfach Macht. Ein Mensch, der sich durch große Fähigkeiten, Kraft und Selbstvertrauen auszeichnet, besitzt ein bedeutendes Mana und damit zwangsläufig auch eine große spirituelle Energie. Diese Untrennbarkeit spirituellen wie weltlichen Denkens hatte für uns allerdings verheerende Folgen, als die polynesische Kultur auf die Europäer traf. Da wir der Meinung waren, dass weltliche Macht zwangsläufig auch spirituelle Macht repräsentierte, unterwarfen wir uns den Eroberern ohne nennenswerten Widerstand. Ein verhängnisvoller Irrtum, der uns nicht ein zweites Mal passieren darf. Aita!“
Maeva hatte die Augen während des gesamten Vortrages geschlossen gehalten. Jetzt blickte sie Cording prüfend an, als wollte sie sich vergewissern, dass ihre Worte auf fruchtbaren Boden gefallen waren. Dann strich sie mit der flachen Hand über die Tiaré apetahi, näherte sich ihr bis auf wenige Millimeter — berühren tat sie die Blüte jedoch nicht. Kein Polynesier würde es wagen, die heilige Blume anzufassen, geschweige denn, sie zu pflücken.
Auf dem Weg zurück ins Tal achtete Cording auf jeden seiner Schritte. Er zweifelte nicht daran, dass der kleinste Fehltritt, der ihn mit der Blume in Kontakt brachte, verheerende Folgen für ihn haben würde. Die Grenzen zwischen Aberglaube und Gewissheit verschwammen für ihn immer mehr, je länger er auf Tahiti weilte.
Auf dem Rückflug nach Papeete teilte ihnen Omai mit, dass die Inselbewohner sich bereit erklärt hatten, seinen Plan zu unterstützen.
„Wenn nicht die Leute von Raiatea, wer denn sonst ..“, fügte er lachend hinzu.
Den Plan selbst wollte er noch immer nicht verraten. Cording war jedoch sicher, dass Maeva davon wusste, denn sie lächelte in diesem Augenblick genauso zufrieden wie ihr Bruder.
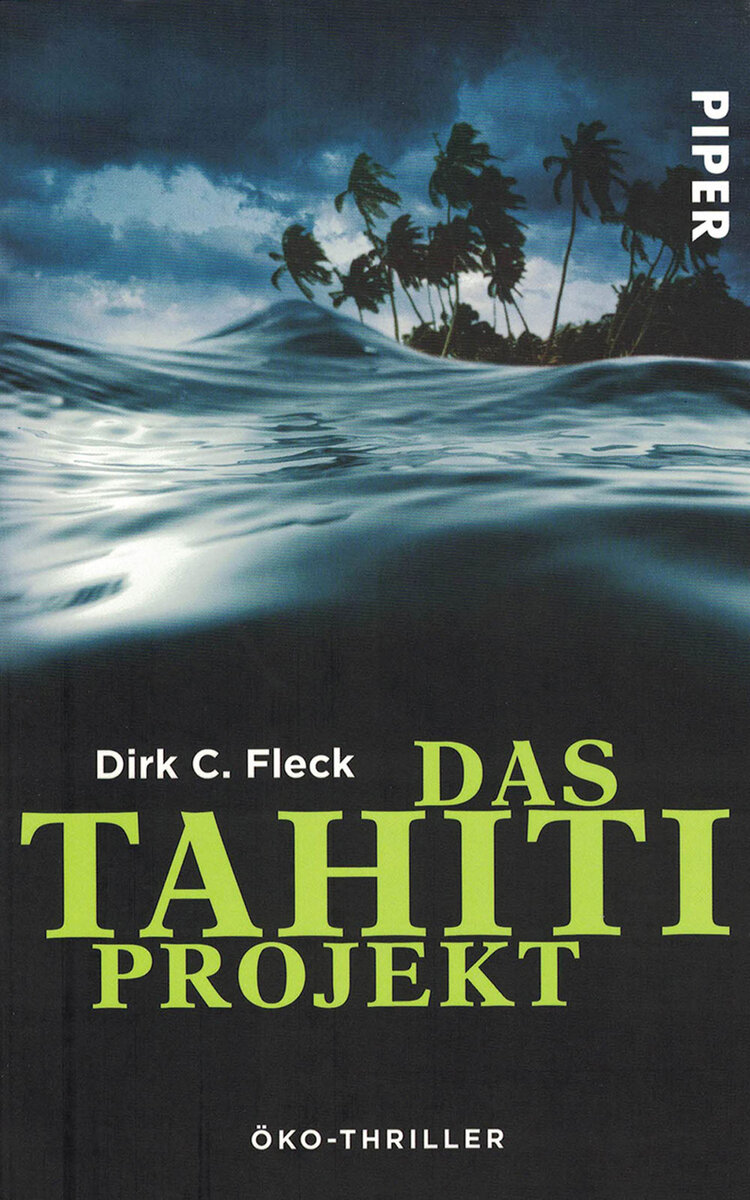
Hier können Sie das Buch bestellen: equilibrismus.org

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
*Die Erklärungen der im Roman verwendeten Fachbegriffe sowie Hinweise für interessierte Leser auf weiterführende Literatur oder Webseiten befinden sich im Buch. Obwohl das „Tahiti-Projekt“ ein Zukunftsroman ist, sind die in ihm dargestellten technischen Lösungen und sozioökologischen Modelle keine Fiktion: sie existieren bereits heute! Das einzig Fiktive ist die Annahme, dass irgendwo auf diesem Planeten tatsächlich mit konkreten Veränderungen in Richtung auf eine zukunftsfähige Lebensweise begonnen wurde.