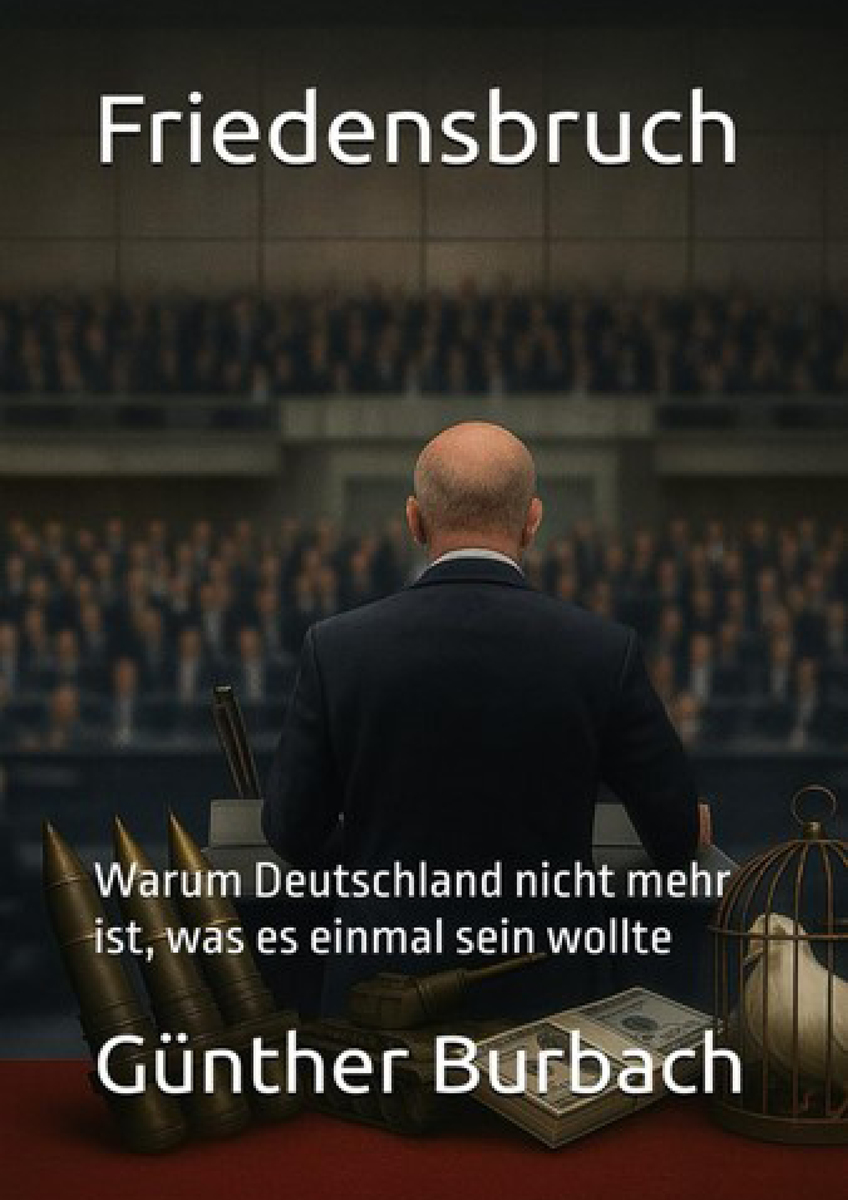Erinnerungsbruch — Wie eine Haltung verloren ging
„Nie wieder Krieg“, dieser Satz stand sinnbildlich für das moralische Fundament der Bundesrepublik Deutschland. Er war keine bloße Formel aus der Mottenkiste der Geschichte, sondern Ausdruck eines politischen und gesellschaftlichen Konsenses, der sich tief in die kollektive Identität eingebrannt hatte. Geprägt durch die unfassbaren Verbrechen des Nationalsozialismus und die totale Zerstörung des Zweiten Weltkriegs, war es das Versprechen einer Gesellschaft an sich selbst, nie wieder den Weg der Gewalt zu beschreiten. Aus dieser historischen Schuld erwuchs eine politische Kultur, die auf Zurückhaltung, Vermittlung und Diplomatie setzte und in der das Militärische nur als äußerstes Mittel gedacht war.
Diese Haltung spiegelte sich in konkreten politischen Entscheidungen: den bewussten Verzicht auf eigene Atomwaffen, der Integration in westliche Bündnisse bei gleichzeitiger Begrenzung militärischer Ambitionen und der Ausrichtung der Bundeswehr als reine Verteidigungsarmee. Der Kniefall Willy Brandts in Warschau 1970 wurde zum Symbol eines neuen außenpolitischen Ethos: der Demut statt Machtpolitik. Helmut Schmidt bemühte sich trotz NATO-Doppelbeschluss um die Balance zwischen Verteidigungsbereitschaft und Gesprächsbereitschaft. Helmut Kohl wusste, dass die Wiedervereinigung nur unter Einhaltung einer friedlichen Grundordnung möglich war, mit dem festen Versprechen gegenüber Gorbatschow, dass von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgehen werde.
In der Gesellschaft war diese Friedensorientierung tief verankert. Die Friedensbewegung der 1980er-Jahre mobilisierte Hunderttausende. Parolen wie „Schwerter zu Pflugscharen“ oder „Frieden schaffen ohne Waffen“ standen nicht nur auf Bannern, sondern auch in Schulbüchern, Kirchenpredigten und Talkshows. Der Pazifismus war Teil des Bildungsauftrags.
Auch wenn er mitunter idealistisch erschien, war er Ausdruck eines ehrlichen Ringens um Verantwortung.
Selbst in der Phase schleichender Veränderungen blieb dieser moralische Kompass zunächst intakt. Die Beteiligung am Kosovokrieg 1999 unter Rot-Grün war eine Zäsur, zweifellos. Doch sie wurde als Dilemma kommuniziert, nicht als Triumph. Joschka Fischer sprach vom „letzten Mittel“, nicht vom ersten. Es war eine Entscheidung unter Rechtfertigungsdruck, begleitet von innerparteilichem Protest, farbigen Demonstrationen und öffentlichen Debatten. Der moralische Konflikt war sichtbar und wurde auch geführt.
Die folgenden Auslandseinsätze, insbesondere in Afghanistan, Somalia oder Mali, wurden zwar zunehmend routinisiert, aber nie kritiklos. Die Bundeswehr blieb unter Beobachtung — durch Parlament, Medien und Öffentlichkeit. Man konnte über ihre Einsätze streiten. Und genau das tat man auch. Bis zum 24. Februar 2022.
Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine änderte sich alles — nicht schleichend, sondern schlagartig. Innerhalb weniger Tage vollzog sich ein politischer, rhetorischer und gesellschaftlicher Bruch, der bis heute kaum aufgearbeitet ist.
Die „Zeitenwende“-Rede von Olaf Scholz am 27. Februar 2022 war dabei nicht nur ein historischer Moment, sie war ein massiver Eingriff in das moralische Selbstverständnis der Republik.
Scholz verkündete ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, ohne breite Debatte, ohne öffentliche Vorbereitung. Die Bundestagsfraktionen spendeten stehenden Applaus. Der Begriff „Zeitenwende“ wurde zum Euphemismus für einen radikalen Kurswechsel, der mit der deutschen Erinnerungskultur brach. „Nie wieder Krieg“ galt fortan nicht mehr als Absage an militärische Eskalation, sondern als Begründung für militärisches Engagement. Aus der Mahnung wurde ein Befehl: Nie wieder Schwäche zeigen. Nie wieder abseits stehen. Nie wieder zaudern.
Die Medien flankierten diese Wende mit beispielloser Geschlossenheit. Waffenlieferungen wurden als „moralisch geboten“ bezeichnet, Diplomatie als Schwäche. Wer zur Deeskalation riet, wurde als „Putinversteher“ diffamiert. Die alte Friedenssprache — Völkerrecht, Interessenausgleich, Gesprächsbereitschaft — wurde verdrängt durch Begriffe wie Abschreckung, Wehrhaftigkeit, Frontstaat.
Gleichzeitig begannen Politiker, eine neue Rolle für Deutschland zu definieren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von „neuen Verantwortungen“, Außenministerin Annalena Baerbock erklärte: „Wir führen einen Krieg gegen Russland.“ Der Verteidigungsminister forderte „Kriegstüchtigkeit“, die Bundeswehr startete Social-Media-Kampagnen mit Slogans wie „Mach, was wirklich zählt“.
Diese diskursive Transformation war kein Zufall. Sie war gewollt, gelenkt und erfolgreich. Innerhalb weniger Wochen wurde eine pazifistische Leitkultur ausgehöhlt, delegitimiert und durch eine martialische Rhetorik ersetzt. Was früher als Lehre aus der Geschichte galt, wurde nun zur Last der Geschichte erklärt. Die Erinnerung wurde nicht mehr als Bremse gesehen, sondern als Ballast.
Dieser Erinnerungsbruch ist mehr als eine historische Fußnote. Er ist ein dramatischer Wendepunkt. Denn er verschiebt nicht nur das politische Koordinatensystem, er verändert das Denken einer Gesellschaft.
Er zerstört jene moralische Reserve, die einst half, nicht jeden Krieg reflexhaft mitzutragen. Und er bereitet den Boden für das, was folgt: eine Republik im permanenten Ausnahmezustand, mit Kriegslogik im Parlament, im Feuilleton, im Alltag. Besonders deutlich lässt sich dieser Bruch auch anhand der Bundestagsdebatten und Abstimmungen der Jahre 2022 und 2023 nachvollziehen. Während in früheren Jahrzehnten Auslandseinsätze stets kontrovers diskutiert und in Einzelfällen mit namentlicher Abstimmung beschlossen wurden, gab es nach dem 24. Februar 2022 kaum noch nennenswerte Debatten über den grundsätzlichen Kurs der Bundesregierung. Die Zustimmung zum Sondervermögen der Bundeswehr erfolgte mit großer Mehrheit, lediglich die Linksfraktion und Teile der AfD stimmten dagegen. Kritische Stimmen innerhalb der Regierungskoalition verstummten entweder oder fanden außerhalb des Parlaments kaum Gehör.
Historiker wie Jürgen Habermas warnten früh vor einer „neuen Militärdoktrin im moralischen Gewand“, blieben jedoch marginalisiert. Auch das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) stellte in internen Analysen fest, dass sich die öffentliche Wahrnehmung deutscher Sicherheitspolitik innerhalb weniger Monate tiefgreifend verschoben habe, nicht zuletzt durch eine politische Rhetorik, die historische Erfahrungen bewusst ausklammere.
Auch der Umgang mit Erinnerungsorten änderte sich. Die Stiftung Deutsches Historisches Museum beispielsweise verzichtete in Ausstellungen zunehmend auf explizite Hinweise zur Friedenspolitik der Nachkriegszeit. Veranstaltungen zum Antikriegstag oder zur Wehrmachtsausstellung wurden seltener, dafür stiegen die Besucherzahlen bei Bundeswehrpräsentationen und Veranstaltungen mit sicherheitspolitischem Fokus.
Der öffentliche Raum spiegelte die neue Realität wider: Mahnmale verblassten, während militärische Paraden und Rekrutierungsevents in Großstädten zunahmen.
Diese Verschiebung bleibt nicht folgenlos. Studien des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) aus dem Jahr 2023 zeigten, dass besonders junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren dem Begriff „Friedenspolitik“ heute deutlich weniger Relevanz beimessen als noch vor zehn Jahren. Stattdessen gewinnen Begriffe wie „Verantwortung“, „Durchsetzungsfähigkeit“ oder „Bündnistreue“ an Zustimmung, nicht selten in Abgrenzung zur früheren deutschen Haltung.
Der Erinnerungsbruch ist damit auch ein Bildungsbruch. Und er ist Ausdruck eines tiefer liegenden Problems: Die politische Mitte hat ihre moralischen Grundlagen verändert, ohne dies öffentlich zu reflektieren. Der Satz „Nie wieder“ bleibt, aber seine Bedeutung ist eine andere geworden.
Die Zeitenwende als politische Umcodierung
Als Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar 2022 im Deutschen Bundestag von einer „Zeitenwende“ sprach, markierte dies mehr als nur eine politische Kurskorrektur. Es war ein bewusster Akt der rhetorischen Umcodierung: Die Grundsätze deutscher Außen- und Sicherheitspolitik wurden nicht nur neu formuliert, sondern historisch aufgeladen und moralisch alternativlos gemacht. In der Rhetorik der Regierung wurde das militärische Handeln nicht bloß legitimiert, sondern zur historischen Pflicht erhoben. Die Sprache selbst wurde zur Waffe, zur Waffe gegen Zweifel, Zurückhaltung und Kritik.
Die Scholz-Rede war gespickt mit Begriffen, die Dringlichkeit, Verantwortung und Geschlossenheit suggerierten: „Putins Krieg“, „unser Land“, „historischer Moment“, „Wehrhaftigkeit“, „Solidarität“. Das Wort „Frieden“ tauchte nur am Rande auf und nie als Ziel durch Verhandlung, sondern stets als etwas, das durch militärische Stärke erreicht werden müsse. Auch der Begriff „Diplomatie“ wurde vermieden. Stattdessen dominierte die Idee, man müsse nun „entschlossen handeln“, „unsere Freiheit verteidigen“ und „endlich liefern“, sowohl rhetorisch als auch militärisch.
Diese Wortfelder sind kein Zufall. Sie sind Teil eines strategischen Framing-Prozesses, in dem Gewalt nicht als tragisches Scheitern erscheint, sondern als legitimes, ja notwendiges Mittel. Die 100 Milliarden Euro „Sondervermögen“, die noch in derselben Sitzung angekündigt wurden, sind Ausdruck dieser neuen Haltung. Interessanterweise wurde dieser Begriff gewählt, um das Wort „Schulden“ oder „Rüstungsetat“ zu vermeiden, ein sprachlicher Taschenspielertrick, der politische Sprengkraft entschärft.
Dabei wurde auf eine bewährte psychologische Technik gesetzt: die Moralisierung des Konflikts. Es geht nicht um Interessen, sondern um Gut gegen Böse. Nicht um Geopolitik, sondern um Werte. Wer nicht mitzieht, so das implizite Narrativ, steht auf der falschen Seite der Geschichte.
Kritik wird dadurch nicht nur delegitimiert, sondern moralisch entwertet. Wer sich gegen Waffenlieferungen ausspricht, steht schnell unter Rechtfertigungsdruck, nicht nur politisch, sondern gesellschaftlich.
Diese Verschiebung war kein rein deutsches Phänomen, doch in Deutschland fiel sie besonders stark aus. Das liegt an der besonderen Rolle der deutschen Erinnerungskultur: Die geschichtliche Verantwortung wurde nun nicht mehr als Verpflichtung zur Deeskalation verstanden, sondern zur militärischen Intervention. Aus „Nie wieder Krieg“ wurde „Nie wieder wehrlos“. Aus historischer Demut wurde strategischer Führungsanspruch. Die Umcodierung war damit vollständig und in ihrer Wirkung tiefgreifend.
Die Medien übernahmen diese neue Codierung nahezu geschlossen. Die Schlagzeilen klangen wie Durchhalteparolen: „Zeitenwende jetzt umsetzen“, „Endlich rüstet Deutschland auf“, „Führung statt Zaudern“. Politiker, die noch vor Kurzem gegen Aufrüstung gewettert hatten, überboten sich nun in Forderungen nach mehr Munition, mehr Gerät, mehr Milliarden. Es entstand eine politische Atmosphäre, in der abweichende Meinungen kaum noch Platz fanden. Die parlamentarische Debatte wurde zur Bühne der Einigkeit, selten zuvor war der Bundestag so geschlossen wie in der Zeit nach Scholz’ Rede.
Interessant ist auch, was nicht gesagt wurde. Kein Wort über die NATO-Osterweiterung. Kein Hinweis auf die jahrzehntelangen Versäumnisse in der Diplomatie. Kein Eingeständnis eigener Fehler, etwa bei Minsk II. Stattdessen ein neues Selbstbild, das auf Wehrhaftigkeit, Stärke und moralischer Überlegenheit beruhte. Deutschland sah sich nicht mehr als Mittler, sondern als Frontstaat der westlichen Allianz.
Diese neue Rolle wurde nicht hinterfragt. Sie wurde angenommen und sofort in konkrete politische Maßnahmen gegossen. Die massive Erhöhung des Wehretats, die Beschaffung von F-35-Kampfflugzeugen, die Stationierung schwerer Waffen an der Ostflanke — all das geschah unter dem Deckmantel der „Zeitenwende“. Der Begriff wurde zum Totschlagargument: Wer dagegen war, stellte sich gegen den Lauf der Geschichte.
Doch Geschichte ist nie alternativlos. Und Sprache ist nie unschuldig. Die politische Umcodierung, die mit Scholz’ Rede begann, war kein Reflex, sie war das Ergebnis gezielter Machtrhetorik.
Sie veränderte nicht nur die politische Linie Deutschlands, sondern auch das Denken seiner Bürger. In dieser neuen Sprache ist kein Platz mehr für Grautöne, für Zweifel, für Vermittlung. Sie kennt nur noch Fronten, außen wie innen.
Damit ist die „Zeitenwende“ nicht nur eine historische Wende. Sie ist ein sprachlicher Umbruch, ein psychologischer Umbau und ein gefährlicher Rückfall in jene Muster, von denen Deutschland glaubte, sie überwunden zu haben. Auffällig ist, wie stark diese Umcodierung auch von Meinungsinstituten und regierungsnahen Thinktanks gestützt wurde. Bereits im März 2022 veröffentlichten das Institut für Demoskopie Allensbach und die Körber-Stiftung Umfragen, laut denen sich eine knappe Mehrheit der Bevölkerung erstmals für eine aktivere Rolle Deutschlands in der Weltpolitik aussprach, insbesondere mit Blick auf militärische Mittel. Während solche Umfragen früher auf breite Ablehnung stießen, wurden sie nun als Beleg für einen angeblich gewachsenen Realismus gefeiert.
Hier können Sie das Buch bestellen: „Friedensbruch: Warum Deutschland nicht mehr ist, was es einmal sein wollte “

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .