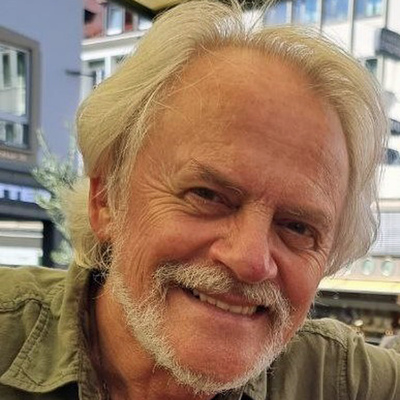Eine Weile, nachdem man mich gebeten hatte, meine Gedanken zum Thema „Heimat“ niederzuschreiben, bemerkte ich meine Verwirrung. Still im Kämmerlein hatte ich kein Problem mit dem Begriff; öffentlich war das etwas ganz anderes. Eines war mir aber schnell klar: Heimat und Nation haben nur sehr bedingt etwas miteinander zu tun. Und mit dem ideologisch aufgeladenen „Vaterland“ hat die Heimat schon gar nichts zu tun — wenn man davon absieht, dass sich natürlich auch die Heimat nationalistisch aufladen und gegen andere verwenden lässt: „Meine Heimat, nicht die deine!“
Verblüffend, dass es für Heimat keine Eins-zu-eins-Übersetzung ins Englische gibt. Haus wird mühelos zu house, Stadt zu town oder city, Land zu country — aber Heimat? Heimat ist ein durch und durch deutsches Wort, schillernd in seinen kulturellen und vor allem emotionalen Aspekten. Der „Heimat“ am nächsten kommt für mich die Umschreibung: The place where I feel at home.
Der Körper der Familie
Womit wir uns bereits meinem Verständnis von Heimat annähern. Ein Teil meiner anfänglichen Verwirrung rührt von der Erkenntnis, dass ich nicht nur eine, sondern mehrere Heimaten habe. Die solideste ist in der Erinnerung geborgen: das Nest, als das ich meine Familie als Kind empfand. Es war ein klarer Bezugspunkt, ein Ort der Stabilität. Ich fühlte mich mehr als zugehörig, ich war ein Teil von etwas. Familie war um mich, aber auch in mir. Das Wissen, dass die anderen, auch unter vielleicht schwierigen Umständen, zu mir halten würden, und ich zu ihnen. Wir waren wie Körperteile, die erst zusammen einen Körper ergaben.
Ich schreibe das in der Vergangenheitsform, weil von der Kernfamilie nur noch mein Bruder übrig ist, aber ihm gegenüber hat sich diese Wahrnehmung gehalten — bei aller physischen und oft auch weltanschaulichen Distanz.
Sprache als Heimat
Zur Heimat-Vielfalt gehört für mein Empfinden sehr stark die Sprache. Das merke ich daran, dass mir Menschen mit deutlich bayerischem Akzent erst einmal sympathisch sind, und zwar umso mehr, je ferner ich dieser Heimat bin; denn bis zu meinem 19. Lebensjahr habe ich mich in einem bayerischen Sprachraum aufgehalten. Das „erst einmal“ will ich später ausführen, an dieser Stelle nur auf dieses sich schnell einklinkende Vorurteil hinweisen. Interessanterweise bleibt dieser Effekt aus, wenn Menschen — wie meine Eltern — Hochdeutsch reden. Offenbar hat das etwas Klinisches.
Ebenso rasch verbinden sich mir Sprache und Heimatgefühl, wenn ich jemanden Englisch mit schottischem Akzent sprechen höre; denn wichtige Teile meiner Biografie wurden dort geprägt. Auch Schottland, insbesondere die sehr spezifische Mentalität der Schotten und Bilder der Highlands stimulieren meine Heimatgefühle ähnlich stark, wenn nicht stärker als altbayerische Inspirationen. Und eine dritte sprachliche Heimat schließt sich an: der schwäbische Akzent. Denn die erste noch kindliche, doch schon eindeutige Verliebtheit galt einer Schwäbin, mit der ich zwei oder drei Wochen in den Sommerferien am Strand verbrachte. Meine Begeisterung für die Urlaubsfreundin ging so weit, dass meine Kameraden mich auslachten, als ich heimkehrte. Ich sprach nämlich nicht mehr Bayerisch, sondern Schwäbisch.
Keine Heimatgefühle bei geistiger Fremdheit
Ich kann also eine Art Heimat-Entwicklung feststellen: die Familie als engster Kreis, dann die bayerische Umgebung, dann die Erweiterung ins Schwäbische und endlich die ins Schottische. Alle vier wohnen mehr oder weniger gleichberechtigt in mir. Womit ich beim obigen „erst einmal“ wäre. Heimatgefühle gegenüber Personen schwinden rasch, wenn sie meiner geistigen Heimat zu fremd sind.
„Fremd“ als Gegenbegriff zu „heimatlich“ passt an dieser Stelle deshalb so gut, weil mich Menschen mit einem exklusiven Heimatgefühl befremden; damit meine ich Menschen, die unfähig sind, Menschen und Kulturen eines anderen Lebensraums als gleichwertig anzusehen und ihnen folglich respektvoll zu begegnen.
Meine erste diesbezügliche Erinnerung hat sich mir bei französischen Gastschülerinnen eingeprägt, die ich mit circa 16, 17 Jahren kennenlernte. Sie waren allen Ernstes der Meinung, alle französischen Autos und Flugzeuge seien die besten, folglich alle deutschen, englischen oder amerikanischen schlechter. Das erschien mir schon damals absurd.
Eine Tragödie: seine Heimat verlieren
Das Wort Heimat wird mir dann zum Negativbegriff, wenn er anderen ihr Recht auf Heimat verweigert. Dazu gehört, so paradox dies im ersten Augenblick klingen mag, die Unfähigkeit, sich vorzustellen, dass andere Menschen ebenso an ihrer Heimat hängen wie unsereins. Und dass es schmerzlich für sie ist, ihre Heimat verlassen zu müssen — aus welchen Gründen auch immer. Jemanden, der seine Heimat verloren hat — meinen Eltern ging es so —, auch noch zu missachten, zu diskriminieren oder sogar zu verhöhnen, ist für mich ein Zeichen menschlicher Unreife, um es gelinde zu formulieren.
Aber vielleicht muss man erst einmal im fernen Ausland geweilt haben, um zu wissen, dass Menschen unter manchmal grotesk erscheinenden Umständen an ihrer Heimat festhalten.
So weiß man beispielsweise, dass Dörfer, die mehrfach von Lava verschüttet wurden, ständig wieder neu besiedelt werden, weil sie eben „die Heimat“ sind. Ich vermute, dass Menschen einer mobilitätsgetriebenen Industriegesellschaft wie der unseren sich ein echtes, tief verbundenes Heimatgefühl, wie es etwa die letzten Regenwaldvölker noch haben, nicht vorstellen können. Wenn sie ihr Territorium verteidigen und sich Bulldozern in den Weg stellen, verteidigen sie nicht nur ein Stück Land vor ausbeuterischen Übergriffen, sie kämpfen um ihr Leben.
Die erweiterte Familie
Seit Jahren hat sich meine Kernfamilie verstreut. Nur ein Sohn lebt in der Nähe. Eine Schwägerin wohnt in den USA, ein Sohn ist nach Guatemala ausgewandert, eine Tochter macht sich eben, mit ihrem bolivianischen Lebenspartner, auf den dauerhaften Weg nach Spanien. Es kann also gut sein, dass ich mich dem Spanischen unter Heimataspekten nähern werde, zumal es eine spanische Entsprechung für Heimat gibt: hogar. Hogar ist ein Ort, an dem man sich emotional geborgen fühlt, weshalb hogar manchmal sogar synonym für familia genutzt wird; die Ursprungsbedeutung, nämlich Feuerstelle, können wir nachempfinden, wenn wir an ein gemeinsames Lagerfeuer denken.
Und je mehr ich im Laufe der Jahrzehnte feststellen konnte, dass es überall auf der Welt wunderbare Menschen gibt — und meist herzlichere als in meiner Heimat —, habe ich begonnen, die Menschheitsfamilie als meine Familie zu begreifen, und die Erde infolgedessen als meine Heimat.
So ganz abgeschlossen ist dieser Prozess noch nicht. Er vertieft sich noch. Eins ist aber schon heute klar: Alles, was dieser neuen, großen Familie das Leben schwermacht, betrachte ich nicht als freundlich, sondern als feindlich. Das wird wohl auch so bleiben.
Wer nun meint, hier einen Widerspruch analysiert zu haben, dem sei gesagt: Ich habe geschrieben „alles“, nicht „alle“. Denn Menschen, die sich in lebensfeindliche Prozesse einspannen lassen und ihnen dienen, sind in den seltensten Fällen Täter. Meistens sind sie verblendet, denn sie handeln ihren und meinen Interessen zuwider, unseren Interessen! El mundo es nuestro hogar.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .