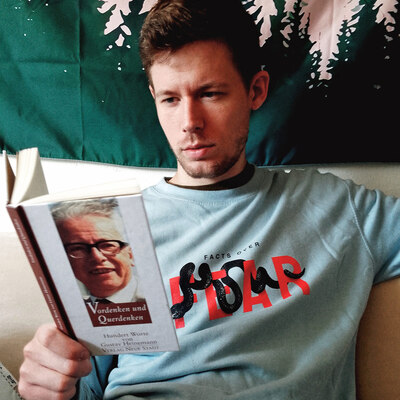Ein lauter Knall beantwortet die Frage nach der Kriegstüchtigkeit der versammelten Zivilisten am Vorplatz der Riem-Arcaden in München. Was war geschehen? War in einem der Dachgeschütze, die auf den ausgestellten Panzerfahrzeuge angebracht sind, doch noch eine Patrone enthalten gewesen? Und hatte ein Jugendlicher, der in den Fahrzeugen probeliegen — pardon: probesitzen — durfte, aus Versehen den Abzug betätigt? Nein. Der Explosionsknall rührte von einer Darbietung der Bundeswehrfeuerwehr her. Den Schaulustigen demonstrierte die Militärfeuerwehr, wie laut der Knall einer einfachen Spraydose sein kann, gefolgt von einer kontrolliert und künstlich herbeigeführten Fettbrand-Explosion.

Foto: Nicolas Riedl
Beide Male schrecken die Menschen zusammen. Dabei sind diese Detonationen und diese Explosionen in ihrer Heftigkeit weit entfernt von einer hochgehenden Handgranate oder gar einer Fliegerbombe.
Offenkundig wurde hier das in der Bevölkerung vielfach vorhandene Zerrbild, das die Bundeswehr bei ihrer 70. Geburtstagsfete im zivilen Raum verbreitete: Der Bund als ein Arbeitgeber mit Abenteuer-Garantie, vielfältigen Aufstiegschancen und integriertem Sportteil. Und sinnstiftend sei die Arbeit dort selbstverständlich — wegen unserer Demokratie und so. Die Verstümmelung oder gar das möglicherweise grausame Sterben als potenzielles Berufsrisiko hingegen wurde konsequent ausgeblendet..
„Dann macht es ‚Blub Blub Blub Blub‘!“
Die Bundeswehr hatte für ihre Truppen-Tuning-Messe aus ihrem Fuhrpark eine vielfältige Auswahl an Fortbewegungsmitteln mitgebracht, die sie vor den Toren des Konsumtempels stolz präsentierte: große gepanzerte Fahrzeuge, kleine Panzer, die wohl einen niedlichen Eindruck erwecken sollten, Transportfahrzeuge und sogar ein Kampfjet waren aus den Hangars geholt worden.

Foto: Nicolas Riedl

Foto: Nicolas Riedl

Foto: Nicolas Riedl

Foto: Nicolas Riedl

Foto: Nicolas Riedl
Groß und Klein, aber ganz besonders Letztere, durften staunend auf den Cockpit- und Fahrersitzen dieser beweglichen Tötungsmaschinen Platz nehmen. Ganz allgemein war der hohe Anteil an Kindern bedenklich, die im Beisein der Eltern und Soldaten die Militärgeräte wie große Spielzeuge bestaunen durften. Eine kritische Einordnung durch die Eltern war weder ersichtlich noch vernehmbar. Ausführlich und stolz wurde von Erklärtafeln und dem anwesendem Truppenpersonal beschrieben, was diese Gerätschaften so alles können. Wie sich die Ergebnisse ihres Einsatzes auf die betroffenen — beziehungsweise getroffenen — Menschen auswirken, wurde dagegen geflissentlich verschwiegen.

Foto: Nicolas Riedl

Als wäre es ein Spielplatz. Kinder turnen auf einem Kampfjet. Foto: Nicolas Riedl
Ein vorbeikommender Familienvater erklärte seinem Sohn sehr kinderfreundlich, und damit eben auch sehr realitätsfern, die Funktionsweise eines Dachgeschützes: „Dort hier, da kommen die Patronen rein und dann macht es ‚Blub Blub Blub Blub‘“. Was die so „geblubten“ Projektile dann im Körper des getroffenen Menschen anrichten – das verriet er ebenfalls nicht.
Vom Konsum zum Kampf
In zweierlei Hinsicht ist es bemerkenswert, dass die Bundeswehr ihre Karriere-Kolonne ausgerechnet vor den Säulen eines Konsumtempels campieren ließ. Zum einen wird hierbei — unfreiwillig — sichtbar, was eigentlich verteidigt und aufrechterhalten werden soll: jene ökonomische Ordnung eines Profit-Regimes, hinter der sich die ständig abgefeuerten Worthülsen von „Demokratie“, „Grundrechten“ und „Freiheit“ verbergen. Die Früchte dieser Ordnung stehen in ebendiesen Shopping-Centern all jenen zur Verfügung, die sie sich — noch — leisten können. Die implizite Botschaft, die dabei mitschwingt, wenn das Militär vor einem Einkaufszentrum Nachwuchs anwirbt, lautet: „Ihr genießt die Wonnen des Shoppens? Dann kämpft mit uns, damit auch weiterhin die Regale voll bleiben!“

Foto: Nicolas Riedl
Dass es bei Kriegen nie um die vorgeschobenen, hehren Ziele geht, sondern unter anderem um die Sicherung von Ressourcen-Nachschub — das ist in militarismuskritischen Kreisen längst eine Binse. Doch das Bild der von Firmenlogos erleuchteten Militärfahrzeuge macht diese unausgesprochene Beziehung zwischen Konzerninteressen und staatlichen Kampftruppen dankenswerterweise überdeutlich sichtbar.

Feldjäger vor den Toren des Konsum-Tempels. Foto: Nicolas Riedl

Das Militär im Lichte der Markenlogos. Foto: Nicolas Riedl
Der zweite Aspekt, der den Ort des Soldaten-Scoutings so bemerkenswert macht, ist das Sinn-Vakuum, das einer Shopping-Arcade und gleichermaßen ihren Besuchern innewohnt. Es ist ein Ort, der seiner künstlichen Natur nach vollständig sinnentleert ist. Überall, hinter jedem Schaufenster, lockt das Versprechen nach Befriedigung eines Bedürfnisses, das mit keiner noch so prall gefüllten Shopping-Tüte gesättigt werden kann. Und mit schrumpfenden Geldbeträgen auf dem Konto schwinden — analog zur Kaufkraft beim Einzelnen wie im Kollektiv — die Illusionen, die innere Leere auf diese Weise füllen zu können. Die Shopping-Center als Hedonismus-Tempel des postheroischen Zeitalters können in der sogenannten Zeitwende ihre Versprechungen nicht mehr einlösen. Wo vormals Sinnmangel noch durch Konsum betäubt werden konnte, entsteht nun das Bedürfnis nach Sinnsuche. Und hier kommt die Bundeswehr ins Spiel, die mit der Versprechung daherkommt, ebendiesen Sinn anzubieten — im Kampf für die oben genannten Platzhalter.
Der Postheroismus der Wendezeit weicht dem Neo-Heroismus der Zeitenwende.
Die Ironie liegt dabei auf der Hand — die Kämpfe bei der Armee dienen der Aufrechterhaltung des Lebensstils, der dieses Sinnvakuum erst hat entstehen lassen — jenes Vakuum, das nun die jungen Menschen in die Reihen der Armee treibt.

Abseilen statt abhängen. Foto: Nicolas Riedl
„Wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst!“ – Wirklich?
Als 2016 bei der Bundeswehr eine neue Epoche der Außenkommunikation mit jungen Menschen anbrach, lautete einer der ersten Slogans: „Wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst.“ Den hat die Bundeswehr nun knapp zehn Jahre später recycelt — hoffend, dass das nach der langen Zeit niemand bemerkt. So wurden Tragetaschen mit ebenjenem Slogan an die Passanten verteilt.

„Wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst.“ Foto: Nicolas Riedl
Während 2016 dieser Satz noch irgendwo halbwegs glaubwürdig erschien, wird er durch die derzeit allerorts angeheizte Wehrpflicht-Debatte ad absurdum geführt. Ein Dagegen-Sein wäre dann naturgemäß rechtlich nicht mehr möglich und — mit Blick auf Paragraph 89 Strafgesetzbuch sowie einem möglichen Spannungsfall dann wohl auch nicht mehr publizistisch oder in anderen Formen der Meinungsäußerung.
Generell schwang bei dieser Veranstaltung die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit durchgehend mit, auch wenn Letztere im Verborgenen blieb. Allein bei der Selbstzuschreibung, man würde auch für das Recht der eigenen Kritiker kämpfen — da blitzte an diesem Spätnachmittag die kaschierte Wirklichkeit durch Risse in der aufgesetzten Fassade.
Um 17:00 formierte sich ein von der Partei Die Linke organisierter Gegenprotest am Rande des Ausstellungsbereichs. Eine halbe Stunde zuvor hatte ich mich unauffällig neben einen jungen BR-Reporter gestellt, der den Bundeswehr-Pressesprecher — erwartungsgemäß unkritisch — interviewte. Dieser gab unter Anderem zum Besten, dass für diesen Tag mehrere Gegendemonstrationen angemeldet worden seien. Man sei gewillt, auch mit den Kritikern ins Gespräch zu kommen und einen Dialog zu führen. Für Kritik sei man offen.
So weit die fabelhafte Welt der Floskeln. Mit der Wirklichkeit kollidierte dieser Anspruch vielleicht nicht, doch zumindest streifte er sie. Der mehrere Dutzend Mann und Frau starke Gegenprotest — bestehend aus Rede- und Musikbeiträgen — zog erwartbar auch die Aufmerksamkeit der anwesenden Soldaten auf sich, insbesondere der am Rande postierten Feldjäger. An diesen ging ich in Hörweite langsam vorbei. Einer der älteren Feldjäger — dem Anschein nach der Truppenkopf — murmelte kopfschüttelnd: „Was für ein armseliger Haufen!“ Ein anderer Soldat stellte sich für ein Handyfoto, das seine Kameradin schoss, nahe des Demobanners und zog spottend eine Grimasse, während er den Daumen anhob. So stellte sich die proklamierte Kritikfähigkeit im Lichte des Realitätschecks dar.

Foto: Nicolas Riedl
Der Protest der Linken war erfrischend altmodisch und treu gegenüber den ursprünglichen Werten. Die Gender-Phase schien ihr Ende gefunden zu haben. Die Redebeiträge wurden in normalem Deutsch vorgetragen. Auch bewies man Humor, als bei der Verlesung der Demonstrationsauflagen ironisch auf das Mitführverbot von Waffen hingewiesen wurde.

Foto: Nicolas Riedl
Es war ein klassischer, antimilitaristischer Protest, der dennoch nicht eines gewissen, bitteren Beigeschmacks entbehrte: Von der Corona-Opposition war in den Reihen niemand zu sehen, und es wäre wohl auch nicht möglich gewesen.
Bei OP-Masken war man sich uneins. Doch die geeinte Ablehnung des Stahlhelms vermag es derzeit immer noch nicht, die Corona-Gräben zu überwinden, um geeint auf ein Ende der Militarisierung hinzuwirken.
Dabei standen und stehen Corona und die Zeitenwende in der gleichen Kontinuität des Krieges – der eine richtete sich nach innen, der andere nach außen.

Foto: Nicolas Riedl

Die gepanzerten Fahrzeuge kehren in ihr natürliches Reservoir zurück. Foto: Nicolas Riedl

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .