Auf der Brücke der „South Pacific“ herrschte hektische Betriebsamkeit. Kapitän Willis, der das Kommando über die kleine Tankerflotte vor Makatea führte, hatte angesichts der Zyklonwarnung den Befehl erteilt, die Schürfarbeiten unverzüglich einzustellen. Global Oil legte zwar energisch Protest ein, aber dies hier war eine seemännische Entscheidung, darüber hatten die in Dallas nicht zu befinden.
„Martha“ raste schnurstracks auf die Marquesas zu, der Zyklon hatte in den letzten Stunden an Größe und Geschwindigkeit enorm zugenommen. Es würde bis tief in die Nacht dauern, bis die komplizierten Schürfeinrichtungen sicher im Bauch der Schiffe verstaut waren, bis die hochsensiblen Tiefseekollektoren und die kilometerlangen Ketten mit den Schaufelbaggern geborgen und die Luken dicht waren. Viel Zeit, um die Anker zu lichten und die drei Schiffselephanten behutsam um die Insel in den Windschatten zu dirigieren, blieb dann nicht mehr. Im Rücken Makateas wären sie hinter diesem hundert Meter hohen Phosphatblock in Sicherheit.
„Mr. McEwen aus Dallas, Sir!“, meldete der erste Offizier und reichte Willis den Hörer.
„Sie werden sich keinen Zentimeter von der Stelle rühren!“, hallte es dem Kapitän entgegen. „Jede Stunde, die wir verlieren, kostet den amerikanischen Steuerzahler Millionen. Falls Sie meinem Befehl nicht Folge leisten, werde ich dafür sorgen, dass sie noch heute suspendiert werden — und zwar vom Präsidenten der Vereinigten Staaten persönlich. Ist das klar, Kapitän?!“
Ohne darauf einzugehen legte Willis auf.
„Die Leute sollen sich mit dem Einholen der Baggerketten beeilen“, sagte er betont sachlich zu den umstehenden Offizieren, denen die Erleichterung ins Gesicht geschrieben stand.
Willis zog sich zurück. Er hatte während der langen Dienstjahre auf See gelernt, seine innere Uhr minutengenau einzustellen. Nach exakt vier Stunden Schlaf, wachte er auf. Er erkundigte sich telefonisch nach dem Stand der Dinge und war erfreut zu hören, dass alle Tanker zum Ablegen bereit waren. Zum Glück würden sie bei ihrem Ausweichmanöver nahe an der Küste bleiben können, Makatea fiel nach allen Seiten hin steil ab.
Als er auf die Brücke zurückgekehrt war, spürte Willis die Vibrationen der angeworfenen Turbinen in seinen Gliedern, die das Schiff langsam in Fahrt brachten. Sie steuerten eine Meile auf die offene See hinaus. Wenn es nach ihm gegangen wäre, war der Stillstand in polynesischen Hoheitsgewässern damit beendet. Aber da es nicht nach ihm ging, gewann er der kurzen Verbundfahrt, die von ihm größtes Geschick erforderte, alle Freuden ab, die er in den letzten Wochen als Verwalter eines festgezurrten Hebetankers hatte entbehren müssen. Gegen drei Uhr morgens waren die „South Pacific“, die „Dallas“ und die „Shanghai“ mitsamt der drei Zerstörer, die die US-Marine zu ihrem Schutz entsandt hatte, an der Südküste Makateas in Deckung gegangen.
Entgegen aller Voraussagen hatte „Martha“ nicht das geringste Interesse an Polynesien. Der Zyklon hatte kurz vor den Marquesas eine überraschende Kehrtwendung vollzogen und steuerte nun auf die chilenische Küste zu. Bis er dort ankäme, würde er sich vermutlich ausgepustet haben. Den Müllteppich hatte er tausend Meilen südlich von Hawaii liegen lassen. Seit Tagen versuchten die Menschen dort bereits vergeblich, sich unter der schmutzigbunten Plastikdecke frei zu strampeln, die der Orkan vor ein paar Tagen über die Insel geworfen hatte. Auf Hawaii zeugten mittlerweile nur noch die glühenden Lavaströme von natürlicher Reinheit.
In Erwartung des Zyklons hatte Cording nichts anderes getan, als alle anderen Bürger Tahitis auch: er half Häuser zu sichern, Geräte zu verstauen, Boote einzuholen und Fahrzeuge in Deckung zu bringen. Sämtliche Einwohner waren auf den Beinen, um dafür zu sorgen, dass ‚Martha’, deren erste Ausläufer bereits zu spüren waren, so wenig Angriffsflächen wie möglich vorfand. Die Schutzmaßnahmen liefen äußert effizient und ohne jede Hektik ab, als seien sie eingeübt. Jeder Tahitianer schien genau zu wissen, wo sein Platz war und was er dort zu tun hatte. Kaum war die Arbeit getan, versammelten sich die Menschen in den Gemeindehäusern vor den Fernsehern und verfolgten die Wetterberichte.
Als spät in der Nacht feststand, dass der Wettergott in einem nicht nachvollziehbaren Kraftakt die Katastrophe abgewendet hatte, begannen die Leute zu tanzen. In den Straßen Papeetes, an den Stränden und in den Dörfern. Allein auf dem One-Tree-Hill hatten sich über zweitausend Menschen versammelt, um dem Himmel Dank zu sagen für die Gnade, die ihnen zuteil geworden war. Cording und Maeva befanden sich mitten unter ihnen. Irgendwann verbreitete sich das Gerücht, dass die Regatta nach Makatea am nächsten Morgen gestartet würde.
Die Sonne schoss ihre Goldpfeile über den Horizont und ließ die Gesichter von mehr als hunderttausend Menschen erstrahlen, die sich entlang des Hafens von Papeete und seiner nordseitigen Lagune eingefunden hatten, um die Armada zu verabschieden. Während es über Nacht noch heftig geregnet hatte, war der Himmel jetzt klar. Er war so blank geputzt, dass jeder Blick nach oben den Betrachter sofort in den unendlichen Raum katapultierte — es schien, als zeigte sich das Firmament nur deshalb so transparent, weil es die Menschen dazu ermutigen wollte, das Unmögliche zu wagen.
Von dem Ponton aus, der in der Hafenmitte verankert war, bot sich Cording ein prächtiger Blick über das von Booten besetzte Hafenbecken und auf die Uferpromenade. Auf dem Platz To´ata hatten die Tänze* begonnen, die im Rhythmus* der Toere und des Pahu die alten tahitianischen Legenden interpretierten. Die ersten Krieger bstiegen ihre Boote.
Es war nicht einfach, unter tausenden von Pahi und Va’a das richtige Boot herauszufinden. Cording, Maeva und Steve wurde die Ehre zuteil, das Spektakel an Omais Seite beobachten zu dürfen. Von hier aus würde der Präsident das Startsignal geben. Außer ihnen und Omai waren nur noch dessen Minister, ein Schamane und das Aufnahmeteam von EMERGENCY TV anwesend, das erst ein paar Stunden zuvor auf Tahiti gelandet war, nachdem sich der Sturm gelegt hatte.
In wenigen Minuten würden sie Zeuge werden, wie das Wasser im Hafenbecken aufwirbelte und Tausende von Booten an ihnen vorbeizogen, um den Ozean auf eine Weise zu erobern, wie es in Polynesien seit Jahrhunderten nicht mehr geschehen war. Vierundzwanzig Stunden rechnete man für die Überfahrt nach Makatea. Sollten sie es schaffen, die Zeitvorgabe einzuhalten, würden sich die Besatzungen der Hebetanker und die Herrschaften auf den Zerstörern der US-Marine morgen Früh in einen Albtraum verwickelt sehen.
Als der letzte Krieger Platz genommen hatte, raffte Omai sein weißes Gewand und trat ans Mikrofon.
„Liebe Schwestern und Brüder, die ihr aus ganz Polynesien gekommen seid, um uns zu unterstützen“, begann er seine Ansprache, „wir Tahitianer danken euch!“
Ergriffen lauschte er dem Beifall, der ihm entgegenbrandete.
„Wir haben uns zusammengeschlossen, um der Welt zu beweisen, dass wir für unsere Lebensweise einstehen. Wir treten an, um den Hochmut zweier Supermächte zu brechen, die unsere Herzen mit Füßen treten.“
Seine Worte hallten als Echo von den Häusern des Boulevard Pomare wider, was Omai dazu zwang, hinter jedem Satz eine Pause einzulegen.
„Wenn Amerikaner und Chinesen uns fragen würden: ‚Was um Himmels Willen ist eure Lebenseinstellung? Wofür kämpft ihr?‘, so würden wir ihnen antworten: Unsere Lebenseinstellung ist einfach: wir sind des festen Glaubens, dass uns die ganze Welt gehört ...“
Ein infernalisches Gebrüll erhob sich in den Booten und entzündete sich am Ufer.
„Aber der Meinung sind wir doch auch!, würden sie erstaunt antworten“, fuhr Omai fort. „Sie verstehen dabei nur nicht, dass alles, was ihnen und uns gehört, heilig ist ... Dass sie es nicht vernichten dürfen, sondern beschützen müssen, wenn sie reich werden wollen ... Ich wünsche allen Kriegern, die bereit sind, den Weg über das Meer zu wagen, eine glückliche Überfahrt ... Wir sehen uns vor Makatea!“
Omai schwenkte die Startflagge. Das Wasser stob auf, als hätte sich ein Piranhaschwarm über die Kanus hergemacht, die im Rhythmus scharfkantig skandierter Gesänge Kurs auf die Hafenausfahrt nahmen. Es dauerte über zwei Stunden, bis die letzten Boote aus der Umklammerung befreit waren, und sich an den Schwanz dieses seltsamen Wesens mit den blinkenden Ruderblattschuppen hängen konnten, das sich den Ozean eroberte wie eine freigelassene Seeschlange.
Am Ufer war es ruhiger geworden. Viele Tahitianer folgten der Armada am Strand, sie winkten und warfen Blumen in die Wellen. Nach zwei Kilometern schwenkten die Boote auf die offene See. Die Gesänge, die aus den Pirogen herüber schollen, wurden leiser, kamen nur noch bruchstückhaft mit dem Wind.
Maeva nahm Cording und Steve bei der Hand und lief mit ihnen zu den Steinhebern, den Früchteträgern, den Feuerläufern und ins Zelt mit den erschöpften Tänzern. Rudolf, der unauffällig in ihrer Nähe geblieben war, mahnte zum Aufbruch. Er fuhr sie zum Flughafen, wo sie den Skycat bestiegen und höflich gebeten wurden, in der Sofaecke Platz zu nehmen und sich ruhig zu verhalten. Sie hatten tatsächlich eine Sofaecke in ihrem Aero-Studio!
Cording blickte seine Freunde der Reihe nach an: da saßen sie und schauten verzückt den Fernsehleuten zu, die Signale austarierten, Außenkameras schwenkten und jede Menge Bilder auf die Monitore holten. Links Maeva, in der Mitte Steve, rechts außen Rudolf. Der Moderator fummelte nervös an seinem roten, mit Hibiskusblüten bedruckten Hemd herum. Anscheinend wusste er nicht, ob er es reinstecken oder über der Hose tragen sollte. In einer halben Stunde wollten sie vom Begleitboot auf den Skycat umschalten, live und weltweit. Da konnte man sich schon Sorgen machen, ob das Tropenhemdchen korrekt saß. Wo war Omai?
„Im Cockpit“, sagte Maeva. „Möchtest du zu ihm?“
Cording schüttelte den Kopf. Der weiße Wal, in dessen leuchtendem High-Tech-Bauch sie gefangen waren, verlor gerade die Bodenhaftung. Das entnahm er dem Screen, auf dem das winkende Flughafenpersonal immer kleiner wurde. In der Kabine selbst war keinerlei Erschütterung zu spüren.
Nettes Kino. Luftkissenkino, antiseptisch. Unter ihnen zogen die Häuser von Faaa hinweg. Der Moderator stellte sich in Positur, während sein Toningenieur den ausgestreckten Zeigefinger unter die Nase stieß, und einen warnenden Blick in ihre Richtung warf.
Wie gerne hätte Cording jetzt in einem der Boote gesessen, denen sie hinterher jagten und die sich bereits im Focus der Kameras befanden. Stattdessen hockte er in dieser fensterlosen Höhle und konsumierte das Ereignis als elektronische Kost auf der Videowand. Und das nach den Vorgaben eines Regisseurs, der sich als Meister der schnellen Schnitte verstand. Aber einen solch brutalen Bildersalat aus tätowierten Fratzen, schäumenden Bugwellen, einstechenden Ruderblättern, geblähten Segeln, vibrierenden Trommelfellen und springenden Delphinen hielt kein Mensch auf Dauer aus, zumal man die Schnipsel aus zwei Perspektiven empfing, aus der Luft und vom Wasser aus. Da musste Ruhe rein, Bedenkzeit, Erklärung. Mit welchem Konzept war EMERGENCY TV hier angetreten? Hatten sie überhaupt eines oder behandelten sie den Zug der Pirogen wie ein Rock-Konzert?
Die Arroganz des leitenden Redakteurs brachte Cording auf die Palme. Was er bisher ablieferte, trug nicht im Geringsten zum Verständnis einer Aktion bei, die von Menschen ausgeführt wurde, welche sich sowohl dem weltlichen wie dem spirituellen Reich zugehörig fühlten, und die den Glauben daran weder abzulehnen noch aufzugeben vermochten. Cording hielt es nicht länger auf seinem Sitz. Er stellte sich dem Engländer vor, der die Reportage zu verantworten hatte.
„Sie sind Cording?!“, fragte der Angesprochene erfreut. „Ich habe schon überall nach Ihnen gesucht, aber Sie waren nicht aufzutreiben. Ich bin ein großer Fan von Ihnen, das können Sie mir glauben. Ohne Ihren Tahiti-Bericht hätte ich mich bei diesem Job glatt überfordert gefühlt ...!“
Er schüttelte Cording kräftig die Hand und bat ihn in sein ‚Büro’ neben der Monitorwand.
„Ich stelle mir das so vor“, begann er voller Enthusiasmus, „sobald sich die Boote auf hoher See befinden und die Bergrücken Tahitis hinter ihnen verschwunden sind, schalten wir in die Verpflegungsküchen auf den Begleitfähren. Ich möchte die Logistik dieses Unternehmens aufdröseln, das ist ja unvorstellbar, was sich hier abspielt. Anschließend soll eine Helmkamera in eines der großen Pirogen steigen und die Stimmung an Bord einfangen. Dann sind Sie dran. Sie berichten von Ihrer Zeit auf Tahiti, Sie fungieren praktisch als unser Co-Kommentator. In der Nacht würzen wir die Berichterstattung durch Schaltungen nach London und Paris, wo die Menschen das vorsintflutliche Spektakel auf öffentlichen Plätzen verfolgen. Glauben Sie, dass es zu Gewalttätigkeiten kommt? Was meinen Sie?“
„Weiß nicht“, antwortete Cording. „Liegt nicht an diesen Leuten. Hören Sie, wir haben den Präsidenten an Bord, warum lassen wir ihn nicht zu Wort kommen? Ich weiß, dass er den Skycat bald verlassen wird, um in das traditionelle Königskanu zu steigen, das der Clanchef von Raiatea zur Verfügung gestellt hat.“
„Omai ist schon eingeplant“, erwiderte der Engländer stolz. „Wir spielen einen Film über ihn ein, eine Art Porträt. Ich habe es in London produziert, ist nicht übel geworden. Der Mann gibt ja ne ganze Menge her.“
„Wissen Sie, Mr ...“
„Rooney. Paul Rooney.“
„Paul ... Wissen Sie, was eine wirklich gute Idee wäre? Wenn Sie Omai bitten würden, die Armada zu erklären. Bis auf eure Presseyacht und den vier Versorgungsdampfern sind dort unten ausschließlich Boote traditioneller Bauart auf dem Wasser. Mit solchen Booten waren die Polynesier früher in den Weiten des Pazifiks Monate unterwegs, ohne dass sie von außen gefilmt und bekocht worden wären. Lassen Sie Omai die Bootstypen erklären, das macht er sicher gerne.“
„Ich weiß nicht ..“, zögerte Rooney, „dies ist eine Fernsehshow, da darf man sich solch didaktischer Elemente nur sehr begrenzt bedienen. In einem Artikel geht das, das haben Sie ja bewiesen ...“
„Es funktioniert in Ihrer Show genauso, Paul“, beruhigte ihn Cording und machte sich auf zum Cockpit. Als er Omai von seinem Einsatz überzeugt und bei Rooney abgeliefert hatte, setzte er sich wieder zu Maeva in die Sofaecke.
Omai bat den Regisseur, mit der Kamera an die Spitze des Zuges zu fahren, dort wo ein 36-sitziges Reise-Va’a den moderaten Takt angab.
„Soll ich mit diesem Bild auf Sendung gehen?“, fragte der Regisseur.
Omai nickte, setzte die Kopfhörer auf und begann, das Reise-Va’a zu erklären. Die Boote der Gesellschaftsinseln, so Omai, ließen sich in zwei Klassen aufteilen. Va’a und Pahi. Ein normales Va’a diente zum Fischfang und war im Gegensatz zum Pahi für lange Reisen nicht geeignet. Die Va’a hatten ein um anderthalb Meter erhöhtes Heck, waren vorne ziemlich flach und an der Spitze mit einem Brett ausgestattet, das einen Meter über den Bug ragte. Ein Reise-Va’a hingegen bestand aus zwei Bootskörpern, die miteinander verbunden waren. Wie alle Va’a hatte es gerade Seitenwände und einen flachen Boden.
Im Gegensatz zu den Pahi, deren Seiten nach außen gewölbt waren und einen spitzen Boden besaßen, der wie ein Kiel wirkte. Die gebogenen Seiten erlaubten das Mitführen viel größerer Lasten und erhöhten die Sicherheit, weshalb man sie vorzugsweise für Kämpfe und auf langen Reisen einsetzte.
Omai wies darauf hin, dass die Boote im Vergleich zu ihrer Länge sehr schmal waren, was die Gefahr in sich barg, dass sie leicht kenterten. Um das zu verhindern, waren die Polynesier auf die Idee gekommen, zwei sich gegenseitig stabilisierende Bootskörper miteinander zu verbinden oder zumindest mit einem Ausleger zu versehen. Im Gegensatz zu anderen Völkern benutzten die Südseebewohner zum Steuern keine Ruderpinne, sondern die Paddel.
Cording beobachtete den Regisseur, der abseits am Mischpult saß und dem es tatsächlich gelang, Omais Ausführungen mit adäquaten, ruhigen Bildern zu begleiten. Die Lektion in polynesischer Bootskunde dauerte fast dreißig Minuten. In dieser halben Stunde hatte Cording das Gefühl, zum Pirogenexperten zu reifen. So erfuhr er, dass die Rümpfe der Kanus an Bug und Heck von gleicher Gestalt waren. Sie konnten sich ohne zu wenden in beide Richtungen bewegen. An flachen Sandstränden war das beim Landen und Ablegen von großem Vorteil. Bei Segelbooten galt, dass die Mannschaft beim Kreuzen das Segel samt Mast nehmen konnte, um es am anderen Ende des Schiffes wieder einzupflanzen. Auf diese Weise wurde erreicht, dass sich Mannschaft und Ausleger immer auf der Windseite des Bootes befanden. Das polynesische Segel, welches einem mit der Spitze nach unten zeigenden Dreieck glich, erlaubte sogar ein Kreuzen gegen den Wind.
Als Omai seine Ausführungen beendet hatte, nickte Paul Rooney zufrieden mit dem Kopf.
„Okay, wir wassern!“, rief er. „Omai steigt aus!“
„Wir gehen mit!“, rief Cording.
„Das geht nicht! Ich brauche Sie hier.“
„Tut mir leid, Paul, wir steigen aus!“
Cording war es inzwischen egal, was EMERGENCY TV sendete, er wollte diese außergewöhnliche Regatta als freier Mensch erleben, frei von irgendwelchen journalistischen Zwängen.
Der Skycat schaukelte in den Wellen. Ein ungewöhnliches Gefühl nach dem schwerelosen Flug. Ein Zodiac nahm sie auf. Da sie weitab des Pirogenschwarms an dessen westlicher Flanke gelandet waren, dauerte es einige Minuten, bis sie das Königskanu erreicht hatten, das in der konisch zulaufenden Spitze der Armada platziert war.
Omai setzte seinen Fuß an Bord des festlich geschmückten Schiffes, das einem westlichen Katamaran nicht unähnlich war. Die 36 maorischen Krieger stellten die Ruder auf, erhoben sich und streckten ihrem Präsidenten Grimassen schneidend die Zunge entgegen, um gleich darauf in ein donnerndes „Aita!“, auszubrechen. Omai nahm die traditionelle Huldigung ohne Regung entgegen und setzte sich auf den Thron, der auf einer zwischen den Bootskörpern angebrachten Plattform installiert war. Von nun an würde er wortlos geradeaus schauen, seine Augen würden nicht ermüden, bis die Armada ihr Ziel erreicht hatte. Der Mann auf dem Thron war das spirituelle Kraftwerk des Unternehmens. Omai stellte sich dieser Aufgabe zum ersten Mal in dieser Form.
Das Zodiac nahm nun Kurs auf die „Auckland Ferry“ und Cording wurde plötzlich klar, dass er dieses Seeabenteuer, diesen Aufstand der polynesischen Seele nicht von innen heraus erleben durfte. Ihm war ein Platz auf der Fähre zugewiesen worden. Die Fähre hielt allerdings einen beträchtlichen Abstand und so fanden sich Steve, Rudolf, Maeva und er schließlich in den Sesseln der Bar vor dem Fernseher wieder.
„Was hatten die herausgestreckten Zungen zu bedeuten?“, fragte er Maeva.
„Die Krieger zeigen ihrem Häuptling durch diese Geste, dass sie genügend Mana in sich tragen, um den Gegner vor Angst erstarren zu lassen.“
„Und warum bist du nicht bei deinen Leuten?“
„Weil ich bei dir bin“, flüsterte sie und lehnte den Kopf an seine Schulter.
Cording blickte nur noch ab und zu auf den Bildschirm. Bei einer dieser Gelegenheiten stellte er zu seiner Überraschung fest, dass mehr Frauen in den Booten saßen, als er vermutet hatte. Ihre Kanus hielten gut mit, fielen im Tempo keineswegs ab. Als die Nacht hereinbrach, weckte er Maeva, die ihm schlaftrunken in die Kabine folgte, wo sie sich eng umschlungen aufs Bett fallen ließen.
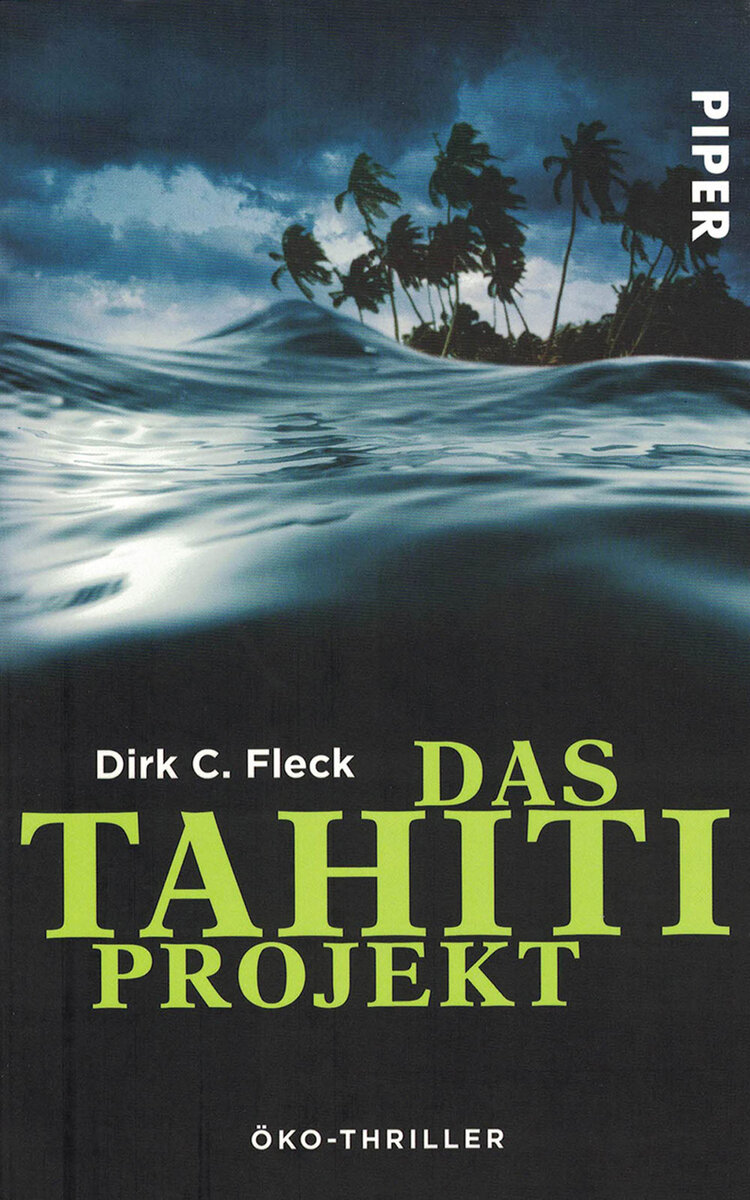
Hier können Sie das Buch bestellen: equilibrismus.org

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
*Die Erklärungen der im Roman verwendeten Fachbegriffe sowie Hinweise für interessierte Leser auf weiterführende Literatur oder Webseiten befinden sich im Buch. Obwohl das „Tahiti-Projekt“ ein Zukunftsroman ist, sind die in ihm dargestellten technischen Lösungen und sozioökologischen Modelle keine Fiktion: sie existieren bereits heute! Das einzig Fiktive ist die Annahme, dass irgendwo auf diesem Planeten tatsächlich mit konkreten Veränderungen in Richtung auf eine zukunftsfähige Lebensweise begonnen wurde.





