Alex Carey war ein Mann analytischen Denkens. Und gerade das machte ihn zu einem scharfsinnigen Kritiker der vielleicht mächtigsten und am wenigsten kontrollierten Kraft unserer Zeit: der Unternehmenspropaganda. Während sich viele Zeitgenossen in den 1970er und 1980er Jahren mit der Propaganda totalitärer Regime beschäftigten — etwa der Meinungskontrolle der Sowjetunion, der Chinas oder anderer neofaschistischer Diktaturen — lenkte Carey schon früh den Blick auf etwas viel Subtileres, was offenbar kaum Beobachtung fand: die systematische und gut geschmierte Beeinflussungsapparatur der öffentlichen Meinung in westlichen Industrieländern. Gelenkt wird sie durch große Unternehmen der westlichen Hemisphäre, die sich selbst als Demokratie versteht und die dies der ganzen Welt auch erklärt.
Die Architektur der Meinungskontrolle
Im Titel von Careys Buch steckt schon die ganze Wahrheit: Die Idee der Demokratie ist für die Wirtschaftseliten — die in anderen Zeiten noch als Räuberbarone firmierten und so als das benannt wurden, was diese Elite meist ausmacht — kein segensreicher Zustand, sondern ein ausgesprochenes Risiko. Denn die Menschen könnten Entscheidungen treffen — den Konsum ebenso betreffend wie auch die Politik —, die dem Profitstreben großer Konzernmaschinerien entgegenstehen. So könnten Arbeiter und Angestellte etwa zu viel Rechte einfordern. Oder aber die Gesellschaft spricht sich für eine starke Umverteilung aus, fordert Regulierungen und setzt so, kurz gesagt, das Gemeinwohl vor die individuellen Gewinnansprüche der Unternehmer.
Careys zentrale These ist schier naiv, ja eigentlich fast schon zu einfach, um wahr zu sein: In den westlichen Ländern des 20. Jahrhunderts — wie gesagt: Demokratien, wie sie selbst von sich behaupten —, vor allem in den Vereinigten Staaten, ist eine gigantische Industrie der Meinungskontrolle konstruiert worden.
Ihr Ziel: die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass ihre eigenen Interessen mit denen der Großunternehmen deckungsgleich sind. Carey formulierte es folgendermaßen:
„Drei Entwicklungen haben das 20. Jahrhundert geprägt: das Wachstum der Demokratie, das Wachstum der Unternehmensmacht — und der Aufstieg der Unternehmenspropaganda als Mittel, ersteres zu begrenzen im Interesse des zweiten.“
Carey spielt damit auf „die Erfindung der Public Relations“ an, ganz besonders auf einen Mann namens Edward Bernays (1891 bis 1995), einem Neffen von Sigmund Freud, des Begründers der Psychoanalyse. Dieser Bernays gilt nicht nur als Vater ebenjener PR, sondern auch als überzeugter Ingenieur der gesellschaftlichen Konsensbildung. Bernays verstand es meisterlich, psychologische Einsichten mit politischer Strategie zu verknüpfen — er setzte die Erkenntnisse der noch jungen psychologischen Wissenschaft ein, um etwa das amerikanische Volk für den Eintritt in den Ersten Weltkrieg zu gewinnen oder um Frauen das Rauchen als Akt der Emanzipation zu verkaufen. Carey dokumentiert in seinem Werk minutiös, wie sich diese Techniken im Laufe des 20. Jahrhunderts institutionalisierten.
Vor allem in den USA entstand eine regelrechte Architektur aus PR-Firmen, Denkfabriken, Wirtschaftsverbänden und Lobbygruppen, deren einziges Ziel es war — und nach wie vor ist —, die öffentliche Meinung nach den Vorstellungen der Mächtigen zu formen und zu kontrollieren.
Dabei setzten die Kontrolleure nicht etwa Werbung im klassischen Sinne ein, sondern bemühten sich um ein tiefes Eingreifen in das gesellschaftliche Verständnis von Politik, Wirtschaft, Arbeit und Freiheit.
Ein berühmtes Beispiel, das Carey immer wieder aufgreift, ist die Reaktion der Wirtschaft auf den New Deal unter Franklin D. Roosevelt in den 1930er Jahren. Die wirtschaftliche Elite erkannte in den sozialstaatlichen Reformen nicht nur eine Gefahr für ihre Profite, sondern einen gefährlichen Dammbruch — wenn der Staat einmal beginnt, sich aktiv in die Wirtschaft einzumischen, wo würde das letztlich enden? Die Antwort war eine mediale Gegenoffensive von beispiellosem Ausmaß: Radiosendungen, Unterrichtsmaterialien, gefälschte „Leserbriefe“, Studien, sogenannte „Volksaufklärung“ im Namen der Wirtschaftsfreiheit.
Die Botschaft war immer dieselbe: Der Staat ist schlecht, der Markt ist hingegen gut. Und wenn du deinen Job behalten willst, dann halte dich besser fern von der Politik. Dieses Denken zog sich über die Reaganomics der 1980er Jahre bis in die heutige Zeit hinein: Es gilt als absolut amerikanisch, wer eine stärkere Wirtschaftskontrolle durch den Staat fordert, der bedient sich unamerikanischer Umtriebe.
Kontrolle durch Konsenssimulation
Careys Beobachtungen sind heute, 30 Jahre nach der postumen Veröffentlichung seiner Gedanken, von wahrhaft schmerzhafter Aktualität.
In einer Welt, in der Google und Meta Platforms mehr über unsere Psyche wissen als wir selbst, in der Unternehmen wie Amazon und viele andere Konzerne wie etwa Nestlé als „gute Arbeitgeber“ und „Partner der Gesellschaft“ auftreten, scheinen seine Erkenntnisse zu einer traurigen Wirklichkeit gefunden zu haben.
Carey hat recht behalten: Die effektivste Form der Macht ist diejenige, die uns glauben lässt, wir seien frei und wollten genau das, was zufälligerweise auch die Profitinteressen des Kapitals will.
Was Careys Betrachtungen jedoch besonders bemerkenswert macht, ist sein Fokus auf die Propaganda nach innen — nämlich in die Betriebe, in Form von Botschaften an die Belegschaften. In mehreren Kapiteln beschreibt er, wie Unternehmen in den Vereinigten Staaten seit den 1940er Jahren systematisch „Mitarbeiterkommunikation“ als Waffe gegen Gewerkschaften und politische Organisation nutzen. Firmenzeitschriften, Schulungsvideos, interne Trainings — all das wurde fein austariert, um das Narrativ vom „gemeinsamen Interesse“ von Chefetage und Arbeitern zu stärken.
Gewerkschaften wurden dabei nicht als legitime Interessenvertretung dargestellt, sondern als organisierte Störenfriede, als wohlstandszersetzende Fremdkörper, manchmal sogar als „kommunistische Agenten“.
Das erinnert frappierend an den zeitgenössischen Unternehmens- und Businesssprech, in denen Angestellte entweder zu „Mitarbeitern“ oder zu „Teammitgliedern” verbrämt werden, um damit die Hierarchien auszublenden. Dass Bisschen an Mitbestimmung, das in Unternehmen dann doch existiert, wird zum Beispiel als „Kultur der Offenheit“ verkauft und Kritik als „Kommunikationsproblem“. Die Sprache der Unternehmen ist heute weich, freundlich und integrativ, sie kommt mit einem blendenden Stewardessen-Lächeln daher — und doch steckt dahinter nur eine Strategie: Kontrolle durch Konsens. Oder besser gesagt: durch Konsenssimulation.
Carey glaubte an die Idee der Demokratie, anders als etwa der besagte Edward Bernays — nur zweifelte der Australier an der real existierenden Version der Demokratie der westlichen Hemisphäre. Die formale Demokratie, die sich durch Wahlen, Parlamente oder Pressefreiheit definiert, reicht seines Erachtens nicht aus, wenn die ökonomische Macht ungleich verteilt bleibt und diese Macht systematisch genutzt wird, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Für Carey ist Demokratie nicht, alle paar Jahre zu einer Wahl zu gehen — sie ist vielmehr ein Prozess der informierten Teilhabe. Und genau dieser Prozess wird durch die permanente Flut von wirtschaftsfreundlicher Propaganda unterwandert. Auf diese Weise werden etwa Klasseninteressen unterminiert, weil das effektive System der Bewusstseinslenkung so tief in den Alltag westlicher Gesellschaften greift, dass niemand mehr über gegensätzliche Interessen innerhalb der Wirtschaft sprechen kann.
Ja, die Demokratie ist in Gefahr!
Ob sich dieser Alex Carey darüber wundern würde, dass in der heutigen Welt Konzerne Black Lives Matter unterstützen und Regenbogenflaggen auf ihre Logos kleben, während sie Nachhaltigkeitsberichte öffentlich machen? Gleichzeitig bekämpfen sie selbstverständlich weiterhin Arbeitnehmervertretungen und jeden gewerkschaftlichen Eingriff in ihre Autonomie, versuchen Steuerzahlungen zu vermeiden und scheren sich nur bedingt um die Folgen von Umweltbelastungen, die durch ihre Produktions- und Herstellungsabläufe entstehen. Für ganz widersprüchlich würde Carey das wohl nicht halten, sondern vermutlich sähe er darin die nächste Stufe der Propaganda — eine weitere Möglichkeit, die Demokratie von jeglichem Risiko zu befreien. Denn so neutralisiert man Kritik.
Die Assimilation identitätspolitischer und sozialer Themen ins Repertoire der Unternehmenskommunikation ist jedenfalls ein Kniff, der direkt aus dem Kopf des Masterminds Bernays stammen könnte.
Der Woke Capitalism ist eine Immunisierungsstrategie — und wenn die nicht mehr aufgeht, wie derzeit in einigen US-amerikanischen Unternehmen, in denen die Belegschaften ihren Unmut kundtun, dann schafft man ihn eben wieder ab und ersetzt ihn durch neue Strategien, die das Zeug dazu haben, die Gesellschaft nach Vorstellung der Unternehmen zu narkotisieren.
Carey schrieb zu seiner Zeit noch über Radiospots, Zeitungsanzeigen und TV- Inszenierungen. Algorithmisch gesteuerte Mikropropaganda, wie wir sie heute kennen und sie uns nicht mehr wegdenken können, weil sie uns omnipräsent erscheint, kannte der Autor noch nicht. Für die Unternehmen ist es einfacher geworden, mit Ängsten zu spielen oder hehre Gefühle zu bedienen, um die Stimmung in den Betrieben und im ganzen Land zu lenken. Sie haben sich die modernen Plattformen angeeignet, erreichen dort die Adressaten ihrer bewusstseinskontrollierenden Inhalte in personalisierter Form und werden damit „zum guten Freund“ der User — zum ehrlichen Makler, der es doch nur gut mit einem meint.
Die Relevanz von Careys umfangreichen Geschichte der PR liegt heute nicht nur in seinen historischen Analysen, sondern auch darin, dass er eines deutlich zeigt: Ja, die Demokratie ist in Gefahr! Und sie ist beschädigter, als die meisten denken. Und die Beschädigung kommt nicht etwa von der AfD oder irgendwelcher — ob vermeintlich oder nicht — rechtsgerichteter Gruppierungen, sondern aus der Mitte der Gesellschaft.
Die Gesellschaften des Westens sind zu Gebilden mutiert, in denen Unternehmenspropaganda dominiert — und auch von den Politikern bedient wird. Sie sind zu sanften Diktaturen transformiert. Zu Systemen, die den Willen des Souveräns untergraben, indem sie diesen fest an ihre Brust drücken, immer fester und fester. Sie ersticken den Volkswillen durch eine liebevolle Umarmung. Wie diese Propaganda arbeitet, kann jeder heute täglich beobachten. So auch aktuell, wenn man den Bürgern weismachen will, dass Opferbereitschaft in ihrem Sinne sei. Denn wenn sie ihre Kinder in einen Kampf für diese Gesellschaft schicken, wie es der Althistoriker Egon Flaig neulich in der Kulturzeit bei 3sat erklärte, dann seien das ihre ureigensten Interessen. Wer seinen Carey gelesen hat, weiß sofort, was gespielt wird.
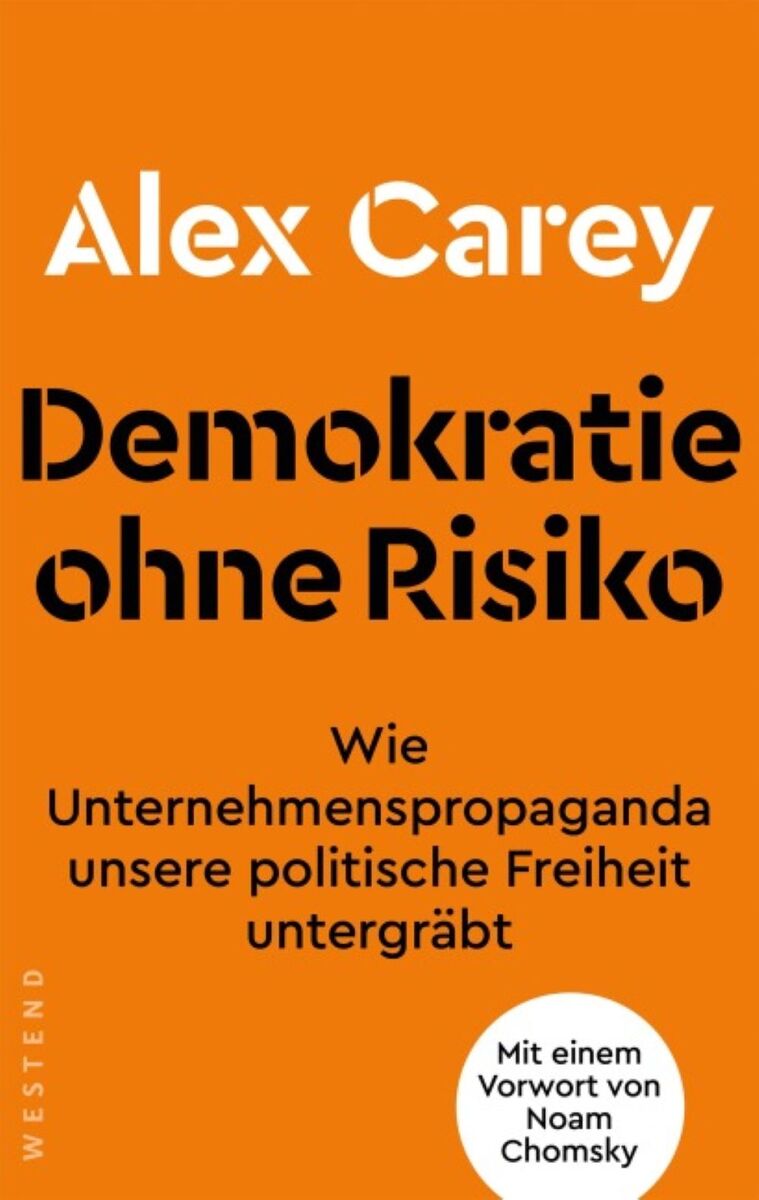
Hier können Sie das Buch bestellen: Buchkomplizen

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .





