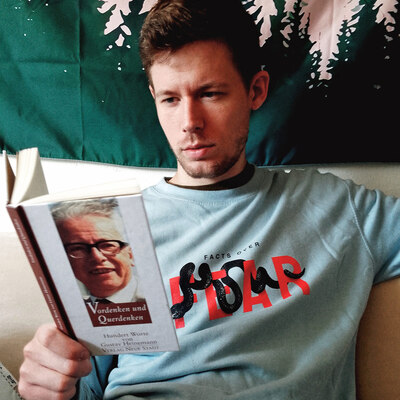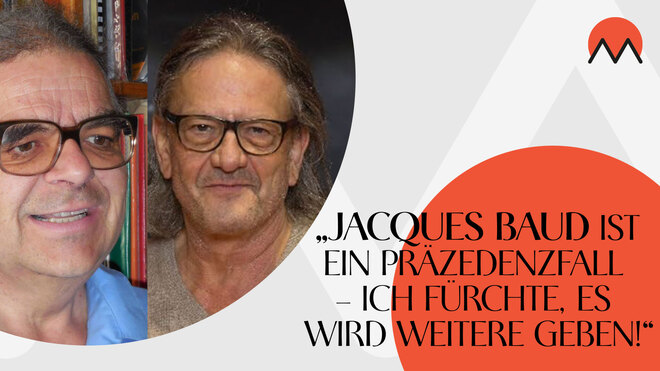„Von oben sieht die Stadt aus, als wenn ein beklopptes Kind seine Bauklötze wahllos in der Landschaft verstreut hätte, mit dem Ziel, das abscheulichste machbare Muster zu erzeugen.“ (Prinz Pi, „Trümmer“)
Die Würfel-Wüste, nach der diese Beitragsserie benannt ist, kann wörtlich und nicht allein im übertragenen Sinne für die architektonische Ödnis verstanden werden. Um das näher zu erläutern, möchte ich mit einer persönlichen Sinneserfahrung einsteigen: Es ist eine warme Mai-Nacht. Ich befinde mich in einem üppig begrünten Park auf dem Nachhauseweg. Der Uhrzeiger bewegt sich in Richtung der Zwölf und die Temperaturen nach unten. Ich überlege, die Jacke aus dem Rucksack zu holen und sie mir überzuziehen, entscheide mich dann aber dagegen. Nach wenigen Minuten erreiche ich eine Neubausiedlung, bestehend aus den mehrstöckigen Tetris-Türmen, denen wir uns im Folgenden widmen werden. Kalt und abweisend stehen sie da im kühlen Mondscheinlicht. Doch so kalt, wie sie äußerlich wirken, so wärmend ist ihr Habitat. Kaum habe ich den Park verlassen, um mir meinen Weg zwischen den Betonklötzen zu bahnen, da verschwindet das Gefühl von Kälte binnen einer Minute. Die gesamte Fläche an und um diese Gebäude ist komplett versiegelt. Hier wachsen nur vereinzelt künstlich eingepflanzte Bäume, die — wenn überhaupt — erst in wenigen Jahren ihre volle Blüte entfalten werden. Woher sollen auch die Wurzeln, umzingelt von Asphalt, ausreichend Wasser bekommen? Die gesamte Gegend ist artifiziell, widernatürlich — unmenschlich.
Ich bin um diese Uhrzeit allein auf diesen neu angelegten Straßen und blicke an den kühl-weißen, makellos glatten, abstoßenden Hausfassaden zum lichtverschmutzten Himmel empor.
In manchen Fenstern flackert das bläuliche Licht großer Smart-TVs. Jeder lebt hier vereinzelt nebeneinander her. So etwas wie Nachbarschaft gibt es hier nicht. Fühlt sich hier irgendjemand zuhause, frage ich mich. Kann man sich hier überhaupt zuhause fühlen?
Alleine, wie ich hier durch die Straßen wandle, fühle ich mich als Mensch von diesem SimCity-artig aus dem Boden gestampften Viertel abgestoßen — verloren in seinen zubetonierten Häuserschluchten. Es ist kein Vergleich mit den urigen, verwinkelten, verspielten und geschichtlich gewachsenen Vierteln mit ihren Altbauten, Zinnentürmen, Torbögen und den teils bis heute mit Kopfsteinpflaster überzogenen Straßen, die einen zum Verweilen, Staunen und Heimelig-Fühlen einladen. Diese Würfel-Wüsten bieten ihren Bewohnern zwar rein materiell alles Notwendige — doch sind sie auf seelischer Ebene eines menschlichen Daseins nicht würdig.
Was ich hier beschrieb, ist selbstredend kein lokales, auf München beschränktes Phänomen. Es spielt keine Rolle, in welche Stadt ich reise. Die immer gleichen Würfel, Quader und eckigen Klötze begegnen mir überall. Abseits meiner Heimatstadt München sehe ich sie genauso, wirklich genau so, in Hamburg, Berlin, London, Bordeaux, Paris oder Rostock. Überall grassiert die Tetris-Pandemie und überzieht die Stadtbilder mit den offenkundig normierten, glatten, farblosen Quaderbauten, die in ihrem Inneren sowohl Gewerbe als auch Wohnungen beheimaten. Wobei weniger von „Heimat“ die Rede sein kann, als von Einschachtelung der Menschen in Wohn- und Arbeitsräume innerhalb einer größeren Beton-Legebatterie. Diese Bausünden betreffen nicht allein die mehrstöckigen Mehrfamilienhäuser. Selbst in schönen Villenvierteln, in Vororten und sogar auf dem Land ziehen es manche bewusst vor — denen man schlicht eine Geschmacksverwirrung attestieren muss — in quadratischen Würfeln zu leben, statt in traditionsreichen, detailverliebten, kurzum: in schönen Häusern. So finden sich in geradezu jedem wohlhabenden Villenviertel Einfamilienhäuser und noble Apartments, die in diesem „Stil“ errichtet werden.

Ein Würfel direkt neben einem Haus mit schönem Sattelgiebel. Foto: Nicolas Riedl

Ein Bauklotz inmitten eines schönen Villenviertels. Foto: Nicolas Riedl

Ein Landschaftsverbrechen! Das idyllische Panorama eines südfranzösischen Dorfes wird durch die gewaltsame Errichtung eines Betonwürfels entstellt. Foto: Nicolas Riedl
Diese Hässlichkeit widert mich derart an, dass ich schon länger darüber nachgedacht habe, sowohl dagegen anzuschreiben, als auch für etwas Neues und Besseres. Nur habe ich lange mit mir gehadert. „Darf“ ich überhaupt etwas über Stadtplanung und Architektur schreiben, wenn ich von selbigen im Grunde genommen gar keine Ahnung habe? Darf ich meinen Senf dazu geben, wenn ich nicht einmal die elementarsten Architekturstile unfallfrei ihrer jeweiligen Epoche zuordnen kann? Steht es mir unter diesen Voraussetzungen überhaupt zu, das zu kritisieren und ohne basale Grundkenntnisse in Architektur Gedanken darüber zu äußern, wie es schöner sein könnte?
Meine anfänglichen Zweifel verflüchtigten sich, nachdem ich mir klar machte, dass diese verbrecherisch hässliche Architektur keine Privatangelegenheit der jeweiligen Architekturbüros und Baufirmen ist. Es handelt sich schließlich um ein großflächiges Verschandeln des öffentlichen Raums — des Raums, der allen Menschen offensteht und die allesamt ein Anrecht darauf haben, dass er schön gestaltet ist. Schließlich ist dessen Instandhaltung und Pflege von den Steuern finanziert, die von den allermeisten hierzulande in horrenden Höhen an den Staat abgedrückt werden.
Während es für historische Gebäude strenge Denkmalregularien gibt, die modernisierende Eingriffe strikten Vorgaben unterwerfen, herrscht bei der Errichtung von Neubauten in Sachen ästhetischer Verantwortung traurige Narrenfreiheit. Den Menschen werden einander in ihrer Hässlichkeit sich überbietende Betonwürfel achtlos hingestellt.
Will heißen, wenn mir — und auch allen anderen — diese Architektur zugemutet wird, dann habe ich — dann haben alle — auch allemal das Recht, sie zu kritisieren. Darüber hinaus muss niemand ein Architekt sein, um der eigenen, sich aufdrängenden Empfindung beim Anblick bestimmter Gebäude Ausdruck zu verleihen. Wer noch mit offenen Augen durch die Welt geht — dazu später mehr —, kann schließlich klar benennen, was ein Gebäude oder eine Siedlung mit einem selbst auf der Gefühlsebene auslöst: ob es einem ein wohliges oder ein abstoßendes Empfinden verleiht.
Insofern habe ich es mir selbst erlaubt, diese Beitragsserie zu starten. Im ersten Teil dieser Serie werde ich nun den Fragen nachgehen, warum die Tetris-Pandemie in Deutschland auf besonders „fruchtbaren“ Boden fällt, woher die Faszination für die glatten Fassaden kommt, warum sich scheinbar so wenige Menschen an dieser Hässlichkeit stoßen und inwieweit diese Architektur damit beginnt, uns Menschen zu einem monotonen Einheitsbrei zu formen.
Würfel-Wüste im (post-)historischen Deutschland
Auf dem deutschen Boden, der vor 80 Jahren nahezu vollständig zerstört war, gedeihen Würfel-Wüsten besonders üppig. Von den Alpen bis zur Nord- und Ostsee finden sich eiligst aus dem Boden gestampfte Siedlungen. Diese mussten sowohl den durch Bombardements obdachlos gewordenen Menschen ein Dach über dem Kopf bieten, als auch wenige Jahre später den Wohnraum für die boomende Bevölkerungsanzahl bereitstellen.
Der im Eingangstext bereits zitierte Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich hat sich neben den maßgeblichen Analysen zur deutschen Nachkriegsgesellschaft auch mit der „Unwirtlichkeit unserer Städte“ befasst und aufgezeigt, wie diese Neurosen begünstigt. So schreibt er gleich zu Beginn seines gleichnamigen Buches:
„Unsere Städte und unsere Wohnungen sind Produkte der Phantasie wie der Phantasielosigkeit, der Großzügigkeit wie des engen Eigensinns. Da sie aber aus harter Materie bestehen, wirken sie auch wie Prägstöcke; wir müssen uns ihnen anpassen. Und das ändert zum Teil unser Verhalten, unser Wesen. Es geht um einen im Wortsinn fatalen, einen schicksalhaften Zirkel: Menschen schaffen sich in den Städten einen Lebensraum, aber auch ein Ausdrucksfeld mit Tausenden von Facetten, doch rückläufig schafft diese Stadtgestalt am sozialen Charakter der Bewohner mit.“ (1)
Folglich gilt für Häuser, was für Kleidung gilt: sie machen Menschen — und umgekehrt. Bei der Beschreibung seiner Empfindung, angesichts der Blocksiedlungen spricht er zugleich ein wesentliches Tabu an:
„(W)enn ich (…) diese Wohnblocks betrachte, dann erscheinen sie mir als der Inbegriff der Kapitulation vor der hohen Kopfzahl. Die Monotonie der Fensterreihungen der meisten Hochhäuser und der starren Addition von Siedlungshäusern ist ein abstoßender Beweis für die schwache Fähigkeit, gestalterisch mit den biologischen Prozessen (der Vermehrung) und den technologisch ausgelösten (der Ballung) Schritt zu halten.
Alle Städte hatten ein Herz. Die Herzlosigkeit, die Unwirtlichkeit der neuen Bauweise hat jedoch eine ins Gewicht fallende Entschuldigung auf ihrer Seite: das Tabu der Besitzverhältnisse an Grund und Boden in den Städten, welches jede schöpferische, tiefgreifende Neugestaltung unmöglich macht.“ (2)
Grund und Boden sind, nicht nur in Deutschland, überwiegend in der Hand weniger Besitzer. Das Habitat, auf dem sich die Würfel-Wüsten in Deutschland breitmachen, beträgt — Stand 2020 — gerade einmal 5,5 Prozent der deutschen Gesamtfläche. Davon fallen 1,7 Prozent auf Industrie und Gewerbe und 3,8 Prozent auf Wohnräume. Dieser sehr begrenzte Raum befindet sich in dem Besitz weniger. Wer kann von sich schon behaupten, überhaupt ein Stück Land zu besitzen, und wenn doch, wie groß ist dieses dann? Durch die ungleiche Verteilung von Grund und Boden ist ein Großteil der Bevölkerung auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, hinzunehmen, was ihnen die Grundbesitzer im Verbund mit den Architekturbüros und den Immobilienfirmen vorsetzen.
In sogenannten „boomenden Städten“ führt der starke Zuzug langfristig dazu, dass zur Deckung des Wohnungsbedarfs flächendeckend Quaderbauten aus dem Boden gestampft werden, die einem menschlichen Dasein nicht gerecht werden. Hierzu noch einmal Mitscherlich:
„Die Menschheit wächst mit einer zentrifugalen Progression, die alle Planung noch vor ihrer Verwirklichung überholt. Da werden Häuser über Häuser in wildem Durcheinander oder in erschreckender, starrer Gleichförmigkeit gebaut, ohne dass irgendjemand die spezifische Aufgabe in den Griff bekäme, in dieser (…) ‚explosiven Ballung‘ einen unersetzlichen Vorgang anzustoßen, und zwar das Einschwören, das Verpflichten der einzelnen Gruppenmitglieder, den Interessen der ganzen Gruppe den gebührenden Tribut zu entrichten. Da uns die technischen Möglichkeiten gegeben sind, die vernünftigsten Dinge der Welt ungehemmt für ideologischen Terror auszubeuten, kann alles leicht zum Unsinn entarten (…). Es steht also überhaupt nicht mehr in Frage, dass wir alte Städte, Gebilde, von denen wir wie von einer Vorzeit weit getrennt sind, neu schaffen, wiederbeleben, uns als Richtmaß vorhalten können. Unsere Aufgabe liegt in einer neuen Selbstdarstellung. Vorher muß von einer geschichtlichen Veränderung des Menschen selbst in einer von ihm geschaffenen neuen Umwelt Kenntnis genommen werden. Nichts anderes als ein in Städten geschultes Bewusstsein hat die technische Welt hervorgebracht — und diese technische Welt verlangt nun ihrerseits hohe Bewusstheit als Integrationsleistung. Hier sind wir stattdessen konfus, tränenreich, von allerlei Flucht- und Verleugnungstendenzen beherrscht (wie zum Beispiel die jährliche Urlaubsmigration zu noch ‚unberührten‘ Gestanden zeigen).“ (3)





Wie bei SimCity: Die Würfel fräsen sich in die Landschaft hinein. Fotos: Nicolas Riedl
Mitscherlich verweist darauf, wie die in Großstadtmolochen herangezüchtete Massengesellschaft die unterschiedlichsten Ausprägungen des Faschismus erst möglich gemacht hat — nicht nur, aber auch gerade in Deutschland. Mit den technologischen Möglichkeiten der vierten Industriellen Revolution potenzieren sich diese Methoden der Unterdrückung und der Freiheitsvernichtung um einen unberechenbaren Faktor. Insofern ist die Gestaltung unserer Städte im Kern und an den Rändern keine Nebensächlichkeit, kein vernachlässigbares First-World-Problem.
Das Designen des Urbanen wird darüber entscheiden, ob die Metropolen zu schönen und damit lebenswerten Freiräumen werden, oder ob sie weiter auf der Rutsche abwärts gleiten in Richtung dystopischer 15-Minuten-Freiluft-Gefängnisse.
Diese Bedeutungsschwere erkannte Mitscherlich bereits vor 60 Jahren, noch nicht ahnend, wie sich die Stadtgestaltung in den nächsten Dekaden entwickeln würde.
„So optimistisch sollten wir nicht sein, zu glauben, dass der Mensch in jedem Fall am Leben bleibt. Er bleibt vielleicht am Leben, die Frage ist aber, ob als freier, als einer also, der überhaupt mit diesem Wort Freiheit noch einen Sinn und ein Ziel verbindet. — Was aus dem Biotop unserer Städte wird, trägt zu der Entscheidung bei, welche Seite in diesem Geschichtsabschnitt den Wettlauf gewinnt.“ (4)
Wir werden auf den Aspekt der Freiheitseinschränkung im urbanen Raum in Teil zwei wieder aufgreifen und vertiefen. Zuvor wollen wir uns weitere Ursachen der städtischen Verscheußlichung ansehen.
Glätte und Screens
Gebäude müssen stets als Kinder ihrer Zeit betrachtet werden. In den Baustilen der unterschiedlichsten Epochen sind zumeist die zeitweiligen Ideologien in die Architektur eingeschrieben. Man denke hierbei allein an die Mächtigkeit ausstrahlenden Bauten des römischen Reiches, die von megalomanischer Wucht nur so strotzenden Kathedralen des Katholizismus oder die monotonen Wohnblöcke im Kommunismus, die mit ihrer Schlichtheit den kapitalistischen Protz kontrastieren sollten. Analog müssen auch bei der Würfel-Wüste die ideologischen Codes der Zeit herausgelesen werden. Was sagt diese Architektur über unsere Zeit aus, und ebenso über die Menschen, die in ihr wohnen?
Ohne langes Rätseln, denn es drängt sich geradezu auf, können diese aalglatten Bauten als die architektonische Spiegelung des digitalen, globalisierten, vereindeutigten Zeitalters begriffen werden. Die Fassaden sind glatt wie die Smartphone-Displays, das Erscheinungsbild ist steril wie die Benutzeroberfläche einer Applikation. Byung-Chul Han erkannte in „Die Errettung der Schönheit“ mit Verweis auf Edmund Burke das Glatte als das Sinnbild des heutigen Verständnisses von Schönheit.
„Die neuzeitliche Ästhetik des Schönen beginnt konsequenterweise bei der Ästhetik des Glatten. Schön ist für Edmund Burke vor allem das Glatte. Die Körper, die dem Tastsinn Vergnügen bereiten, sollten keinen Widerstand leisten. Sie müssen Glatt sein. Das Glatte ist als optimierte Fläche ohne Negativität. Es verursacht eine Empfindung, die ganz frei von Schmerz und Widerstand ist (…).“ (5)

Glatt wie ein Aal. Ein typisch moderne Hausfassade eines Quaderbaus. Foto: Nicolas Riedl
Was mit der Würfel-Wüstenbildung geschieht, ist ein Angleichen der analogen an die digitale Welt.
Die naturgegebene Rauheit des Analogen wird geglättet, sodass sie der digitalen Ebenheit immer näherkommt.
Zugleich ist die digitale Ebenheit selbst das Ergebnis einer Glättung, die in der vorangegangenen Dekade vollzogen wurde. Das lässt sich exemplarisch ablesen an der glattgeschliffenen Design-Sterilisierung, der sich nahezu alle Firmenlogos im Bereich der Plattformökonomie unterzogen haben.

Anfangs verspielt und schnörkelig — nach dem Rebrand steril, glatt und genormt: Firmenlogos im Wandel hin zur Angleichung. Foto: Netzfund.
Die glättende Evolution von Firmenlogos vollzieht sich auch bei solchen Unternehmen, die im ursprünglichen Sinne gar nichts mit der Onlinewelt zu tun hatten, gar schon lange vor dem Internet existierten, doch nun ihre vormals filigran designte Brand zu einem digital-kompatiblen Icon verzwergen, der von Schnörkel, Ecken und Kanten feingeschliffen ist.

Vom nicht-nachahmbaren Logo zum angeglichenen Icon. Modemarken-Logos im evolutionären Wandel hin zur digitalen Glätte. Foto: Netzfund.
Zurück zur analogen Welt, in welcher sich die oben dargestellte Glättung selbstähnlich vollzieht:
An die Stelle von verspielt gestaltete Hausfassaden mit Stuckverzierungen treten weichen Ebenen, die von Unebenheiten befreit sind. Statt Bordsteinkanten gibt es immer öfter nur noch farbliche Begrenzungen zwischen Bürgersteig und Straße, während letztere überhaupt nicht mehr mit Kopfsteinpflaster überzogen, sondern mit käsescheibenglattem Asphalt geteert wird.

Ein moderner Würfelbau steht direkt gegenüber einer verspielten, rauen und vielfältigen Hausfassade eines älteren Baus. Foto: Nicolas Riedl
Katalysiert wird diese Entwicklung durch die sprichwörtliche Digitalisierung des öffentlichen Raums in Gestalt der sich in viraler Geschwindigkeit ausbreitenden Installation von digitalen Screens allerorts, die ich bereits an anderer Stelle analysiert habe. Dabei habe ich herausgearbeitet, dass im urbanen Raum ein geradezu unentrinnbares Netz der visuellen Dauer-Beflimmerung geschaffen wird. Dieses Netz verstärkt die ohnehin schon hypnotische Sogwirkung der digitalen Räume, die mit jedem in Händen gehaltenen Smartphone über den Screen ein Einfallstor in das Analoge eröffnen.
Wenn wir über die Würfel-Wüsten sprechen, müssen wir somit über Screens im Allgemeinen sprechen. Der Filmtheoretiker Francesco Casetti beschäftigte sich eingehend mit der Beschaffenheit von Screens. Diese können nach dem Medientheoretiker Lev Manovich unterteilt werden in klassische Screens wie Fotos, Plakate, eingerahmte Bilder und Fenster und bewegliche, beziehungsweise dynamische Screens wie Smartphones, öffentliche Infoscreens und digitale Werbetafeln, TV und ebenfalls Fenster. Letzterer Screen-Typ ist für diese Betrachtung von besonderer Bedeutung.
Casetti schreibt dem Screen drei wesentliche Bestandteile zu: die Oberfläche, den Rahmen und die Spiegelfunktion.
- Die Oberfläche ist der Filter zwischen dem analogen Raum und dem, was sich jenseits des Screens befindet: ein Bild, der Raum hinter dem Fenster oder eben die digitalen Benutzeroberflächen und damit die Medieninhalte der digitalen Endgeräte.
- Der Rahmen begrenzt die genannte Oberfläche und bildet folglich die Pforte zwischen dem analogen und dem digitalen Raum unter der Oberfläche.
- Unter der Spiegelfunktion versteht Casetti unsere Identifikation mit den auf der Oberfläche gezeigten und vom Rahmen eingegrenzten Inhalten und Räumen jenseits des Screens. Wir identifizieren uns in irgendeiner Weise mit den Medieninhalten des Screens, sei es mit einer Malerei, einem Fernsehprogramm oder den vielschichtigen Inhalten, die die digitale Sphäre für uns bereithält. Bei einem Fenster identifizieren wir uns mit dem Blick nach draußen und mit unserem geographischen In-der-Welt-Sein: Was wir vor dem Fenster sehen, ist der Ort, an dem wir uns befinden, daran machen wir fest, wo in der Welt unser Sein stattfindet (6).
In der Natur des dynamischen Screens liegt es, so wiederum die These von Manovich, dass der dahinterliegende Raum des Digitalen den analogen Raum diesseits des Screens dominiert. Wohl evolutionsbedingt können wir Menschen nicht umhin, unseren Blick dorthin zu wenden, wo sich etwas tut, wo etwas in Bewegung ist. Manch einer wird das aus Lokalen kennen, die unsäglicherweise mit einem Fernseher ausgestattet sind, dessen umrahmte Oberfläche stets unseren Blick einfängt und uns den analogen Raum samt der Mitmenschen halb vergessen lässt, in dem wir uns physisch befinden.
Und hierin liegt der Knackpunkt, nämlich in der Dominanz des digitalen Raums gegenüber dem analogen. Diese Dominanz liefert eine plausible Erklärung dafür, warum diese Architekturverbrechen keinen großflächig vernehmbaren Aufschrei auslösen.
Das Schimmerlicht der Screens verbirgt die Hässlichkeit der Gebäude im Schatten der Aufmerksamkeit. Einfach ausgedrückt: Wer den überwiegenden Teil seines Daseins auf einen hellen Screen blickt — also mittlerweile ein Großteil der Menschen, vulgo Smombies — der nimmt weder von Schönheit noch von Hässlichkeit im Außen Notiz.
Wie ich es in eigenen Beobachtungen schon vielfach mit Entsetzen beobachtet habe, und wie es auch Tom-Oliver Regenauer in seinem Smombie-Artikel szenisch skizzierte, ist ein nicht unerheblicher Anteil der Menschen nicht einmal mehr von den atemberaubendsten Naturschauspielen, wie etwa einem Sonnenuntergang, aus dem Bannstrahl digitaler Endgeräte herauszulösen.
Wer beim Doomscrolling so vertieft ist, dass er selbst einem Himmelsspektakel die kalte Schulter zeigen kann, der kann es ebenso bei potthässlichen Würfel-Wüsten. Was spielt es denn für eine Rolle, ob die äußere Welt hässlich ist, wenn einem allseits die helle, freundliche, bunte Benutzeroberfläche des Digitalen entgegen strahlt?
Es ist durchaus vorstellbar, dass manche Menschen in dieser Sterilität Sicherheit finden. Wenn das Außen so glatt und geordnet ist wie die eigene Desktop-Oberfläche, dann ist alles schnell auffindbar. Und wenn die Unsicherheiten und Unwägbarkeiten der unberechenbaren Außenwelt berechenbar gemacht, quasi „ausgebügelt“ werden, dann kommt es nicht zu Überraschungen oder unerwarteten Fremdheitserfahrungen. Alles bewegt sich im vertrauten Rahmen des Erwartbaren. Dass diese Häuser und die darin befindlichen Wohnungen unpersönlich sind, ist sogar dankenswert für den neoliberal geprägten Menschen, dessen individuelle Ausdrucksweise hinlänglich verkümmert ist, beschränkt sie sich doch überwiegend auf die freie Wahl innerhalb von Warenkörben, was die Persönlichkeit zu einem durchsichtigen Schatten der eigenen Einzigartigkeit degradiert.
Diese Quadrathöhlen des „modernen Höhlenmenschen“ (Prinz Pi) stellen so etwas wie einen Gebrauchsgegenstand dar, der nach Bedarf gemietet werden kann, wie etwa ein Car-to-rent oder ein E-Scooter. Die Wohnungen sind schnell eingerichtet und ebenso schnell wieder ausgeräumt. Durch ihre Normierung lassen sie sich abgesehen von der Möblierung nicht sonderlich individuell gestalten, wie das etwa bei Altbauwohnungen noch der Fall ist, die durch ihre Macken, Ecken und Kanten einen Spielraum für Gestaltung offenlassen. Die Quadrathöhlen hingegen sind einheitlich geschnitten. In deren Räumen werden Brüche, wie etwa eine eingerissene Wand, angesichts der sonstigen Glätte augenblicklich als einschneidende, klaffende Wunde wahrgenommen. Sie sind vergleichbar mit den neueren Automodellen ab den 2010er Jahren, die sehr benutzerfreundlich, einfach zu bedienen aber nicht mehr selbst zu reparieren sind. Es sind schlicht nur noch zum bloßen Gebrauch gedachte Devices.
Beim Auszug aus diesen Batterien wird schlicht noch einmal geschwind über die glatten Flächen gewischt und schon sind die Räumlichkeiten besenrein. Nichts deutet mehr darauf hin, dass hier jemand gelebt hat, unter diesen Zimmerdecken wohnt man schließlich nur, man ist nur Nutzer, kein Beheimateter. Der Wohnraum selbst wird zu einer reinen Benutzeroberfläche, wie man sie von digitalen Endgeräten kennt.
Wird das Device gewechselt, werden die variablen Bestandteile aus Möbeln und Habseligkeiten schlicht auf das nächste Gerät übertragen. Die immer einheitlicher und nur dem Anschein nach individuelle IKEA-typische-Einrichtung vervollständigt die Angleichung der analogen Räume an die digitalen. Byung-Chul Han unterscheidet zu diesem Kontext passend zwischen dem Naturschönen und dem Digitalschönen:
„Das Naturschöne ist dem Digitalschönen entgegengesetzt. Im Digitalschönen ist die Negativität des Anderen gänzlich aufgehoben. Daher ist es ganz glatt. Es soll keinen Riss erhalten. (…) Das Digitalschöne bildet einen glatten Raum des Gleichen, der keine Fremdheit (…) zulässt. (…)“ (7)
Sinnhaftigkeit findet diese Architektur einzig und allein in der Funktionalität und Zuverlässigkeit. Schönheit als Selbstzweck existiert darin nicht, wird als Unsinn deklariert, als unnötiger Kostenpunkt. Darauf weisen in drastischen Worten die Designer Jessica Walsh und Stefan Sagmeister gleich auf der ersten Seite ihres Illustrationsbandes „Beauty“ hin:
„Einst eine universelle Sehnsucht, endet das Streben nach Schönheit zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einer Bruchlandung. Seitdem bekehren Designschulen ihre Studentinnen und Studenten zu modernistischen Prinzipien: Einheitlichkeit, Raster und rechtwinklige Kompositionen, gepaart mit einer Vorliebe für Schwarz, Weiß und Beige. Der gestalterische Ansatz beim Entwurf von Gebäuden, Produkten und grafischen Arbeiten wurde rein analytisch, die Materialauswahl gänzlich rational, die Funktionalität das alleinige Ziel. Architekten und Gestalter gerieten mit ihren Entwürfen in den Sog einer nahezu psychotischen Einförmigkeit“ (8)
Derart errichtete Siedlungen bilden das sterile Reservoir für entwurzelte und somit rein selbstbezogene Menschen, sowie jene Menschen, die noch weiter entwurzelt werden. Denn im seelischen Kern des Menschen — sofern dieser noch verwurzelt ist — ist die Empfindung von Schönheit angelegt. Das belegen Walsh und Sagmeister mit Verweis auf eine 2011 durchgeführte Studie. Dabei wurde mittels Gesichtsmuskel-Messungen die mimische Reaktion beobachtet, die Menschen auf millisekündig eingeblendete Bilder haben, deren Gezeigtes empirisch als „schön“ klassifiziert ist. Das Ergebnis war eindeutig: Die Menschen nehmen Schönheit unterbewusst wahr. Daraus folgt, dass die Hässlichkeit der Würfel-Wüsten von den Menschen, wenn schon nicht bewusst, dann zumindest unterbewusst wahrgenommen wird.
Jene Erkenntnis erst lässt ansatzweise erahnen, was dieser Baustil mit Millionen Seelen unter der Oberfläche des unmittelbar Sichtbaren anrichtet — dieser Anblick ist eine subtile Folter!
Im Lichte dieser Forschungsarbeit muss sich vergegenwärtigt werden, auf welche Mimik hin die Probanden beim Erblicken von Schönheit beobachtet wurden — selbstverständlich das Lächeln. Gezeigte Schönheit zauberte den Testpersonen ein Schmunzeln ins Gesicht. Was geschieht nun mit Menschen, die vielerorts und langanhaltend von Hässlichkeit umgeben sind? Wenn wir uns die Gesichter unserer Mitmenschen ansehen — ist ihnen die Tristesse der Würfel-Wüste schon ins Gesicht geschrieben?
Diesen Gedanken wollen wir an dieser Stelle in Ruhe sacken und nachwirken lassen und ergänzend dazu auf eine weitere Studie blicken, mit der Walsh und Sagmeister belegen, dass Schönheit nicht im Auge des Betrachters liegt, sondern eine universelle Empfindung ist, die allen Menschen innewohnt. Mittels eines elektronischen Armbandes maß der Neurowissenschaftler Collin Ellard die Emotionen der Probanden an unterschiedlichen, sich in ihrer Schönheit signifikant voneinander unterscheidenden Testorten. Er verknüpfte diese Daten mit den von den Testpersonen genannten Assoziationsbegriffen, die ihnen beim Erblicken dieser hässlichen oder eben schönen Orte in den Sinn kamen. Das wenig überraschende aber doch so entscheidende Ergebnis: Das psychische wie physische Wohlbefinden verbesserte oder verschlechterte sich in Abhängigkeit von der umgebenden Schönheit oder Hässlichkeit der Orte. (9) Das untermauert die oben getätigte Aussage, weswegen sie hier noch einmal wiederholt sei:
Hässliche Architektur ist Folter!
Ein Blick auf diese Entwicklung durch eine anthroposophische Brille legt den Verdacht nahe, dass hier — analog zu den im Eingangstext erwähnten „grauen Herren“ —, soratische Kräfte am Wirken sind. Ob man diese nun wörtlich oder nur als der Veranschaulichung dienende Metapher verstehen möchte, ist natürlich jedem selbst überlassen. Nach der Lehre Rudolf Steiners und all derer, die seine Forschung weitergedacht haben, zielt Sorat darauf ab, den Menschen in der irdischen, das heißt materiellen Sphäre zu binden, das seelische Fortkommen des Ichs zu verhindern und ihn, den Menschen, sodann auch zu animalisieren. Erscheinungsmerkmale Sorats sind der Missbrauch moderner Wissenschaften, ihre Pervertierung in das Unmenschliche, und ebenso die Durchdigitalisierung aller Lebensbereiche.
Die genannten Kriterien sehen wir in der Würfel-Wüste vollumfänglich erfüllt: Die Anordnung der Wohneinheiten erinnert, wie schon ausgeführt, an Legebatterien, in denen die zu Arbeits- und Konsumvieh degradierten Menschen, sediert mit seichten Unterhaltungsangeboten und anderen Eskapismus-Möglichkeiten, eingepfercht werden. Die künstliche Landschaft innen wie außen lässt jede Natürlichkeit vermissen und erinnert ihre Einwohner — oder auch Insassen — in jedem Augenblick an das rein materielle Dasein.
Die architektonische Gleichförmigkeit lässt die Seele verkümmern, sie kann sich nicht entfalten. Die Flächenversiegelung symbolisiert die gekappte Verbindung zur Erde, zur Mitwelt im Allgemeinen. Diese Trennung ist der digitalen Sphäre inhärent, weil diese Sphäre, wie Jochen Kirchhoff einmal ausführte, keine Wurzeln in der wirklichen Welt hat.
In dem Zusammenhang mit der Angleichung des Analogen an das Digitale ist es außerdem bemerkenswert, inwieweit die in Würfel-Wüsten errichteten Smart-Homes den Smartphones ähneln, was die Art und Weise der „Bedienung“ anbelangt. In „Undinge“ wies Han auf die etymologische Herkunft des Digitalen hin: „Digital geht auf digitus zurück, was der Finger bedeutet. Mit den Fingern zählen und rechnen wir. Sie sind nummerisch, das heißt digital. Heidegger unterscheidet die Hand ausdrücklich von Fingern.“ (9)
In den smarten Würfel-Wüsten-Wohnungen wird immer weniger Hand angelegt, sondern vielmehr, wie auf einer Displayoberfläche, gewischt, getippt und geswiped: Bedienfelder auf Herdplatten statt Regler, Touch-Flächen auf Spiegeln statt Lichtschalter. Und auch die akustische Ebene ersetzt zunehmend das Hand-Anlegen. „Hey Alexa, fahr die Jalousien runter“, befehligt man den Home-Assistenten, statt selbst den Gurt zu ziehen.
Alles wird einfacher und vermeintlich sicherer in diesem Habitat, das den Komfort maximieren und das Ungestüme der Natur bannen, verbannen soll. Die Natur muss draußen bleiben — draußen vor der Tür und draußen vor den Fenstern.
Über die Fenster in diesen Gebäuden muss im Speziellen ebenfalls gesprochen werden, denn ihre fast immer gleiche Form und die damit einhergehenden Implikationen untermauern die These über die entfremdende Wirkung dieser Architektur. Es sind gerade die Fenster, die das wohl einzige und zugleich kollektive Wiedererkennungsmerkmal dieser Bauweise darstellen. Es handelt sich um kleine, schmale, hochkantige Fenster, die manchmal in der unteren Hälfte noch über angebrachte Gitterstäbe verfügen. Sie werden auch als „französische Balkone“ bezeichnet.

Kein Panorama-Blick. Alle Fenster sind schmal. Nur, warum? Foto: Nicolas Riedl
Es sei hier an die weiter oben schon erwähnten Herren Casetti und Manovich erinnert. Fläche, Rahmung und die Spiegelfunktion bilden nach Casetti einen Screen, der nach Manovich sowohl bei einem Fenster (statischer Screen) als auch bei einem Smartphone (dynamischer Screen) gegeben sein kann. Woran erinnert diese spezifisch hochkantige Fensterform? Ganz richtig: an Smartphones! Was sagt es folglich aus, wenn die Fenster in diesem Baustil den Smartphones nachempfunden sind? Der Medienethiker und Podcaster Aron Morhoff bemerkte zu Inhalten im Hochformat, mit Bezugnahme auf Marshall McLuhan, sehr trefflich an: „Das Medium selbst ist die Botschaft. (...) Ein Querformat eignet sich besser, um Landschaften, einen Raum oder eine Gruppe abzubilden. Das Hochformat entspricht grob den menschlichen Maßen von der Hüfte bis zum Kopf. (...) Das Hochformat hat die Medieninhalte unserer Zeit noch narzisstischer gemacht.“ Diese Schmalfenster symbolisieren den schwindenden Weltbezug der Bewohner, analog zu dem gesteigerten, narzisstischen Selbstbezug. Fenster dieser Art bezwecken gar nicht mehr, wie bei früheren, wesentlich breiteren Bautypen, einen Ausblick auf die Welt da draußen zu gewähren, sondern dienen einzig der natürlichen Illumination der Räumlichkeiten während der Tageslichtzeiten.

Fenster so schmal wie ein Smartphone. Foto: Nicolas Riedl
Warum sollten diese Fenster auch einen Ausblick nach draußen ermöglichen, wenn es dort ohnehin nichts weiter zu sehen gibt, als Gebäude, die genauso monoton sind wie jenes, in dem man selbst haust? Das neue Fenster zur Welt ist der 8K-Breitbildfernseher, der scheinbar nicht genug Zoll Diagonalbreite aufweisen kann. Das ist eine erstaunliche Invertierung der Verhältnisse: Im vordigitalen Zeitalter waren die Fenster breit und die Mattscheiben der Röhrengeräte schmal. Heute ist es genau umgekehrt. Diese Umkehrung zementiert die weltliche Obdachlosigkeit des Menschen in der Würfel-Wüste. Hierzu noch einmal Han:
„Die digitalisierte Welt ist eine Welt, die die Menschen gleichsam mit ihrer eigenen Netzhaut übersponnen haben. Diese menschlich ver-netzte Welt führt zu einer permanenten Selbstbespiegelung. Je dichter das Netz gesponnen wird, desto gründlicher schirmt sich die Welt vom Anderen, vom Draußen ab. Die digitalisierte Netzhaut verwandelt die Welt in einen Bild- und Kontrollschirm. In diesem autoerotischen Sehraum, in dieser digitalen Innerlichkeit ist kein Staunen möglich. Gefallen finden die Menschen nur noch an sich selbst.“ (11)
Die Zeichen an den Wänden, an den Wänden dieser hässlichen Gebäude, sind untrüglich: Dieser Baustil ist der sehr aufdringliche Vorbote einer sehr düsteren, technokratischen, soratisch anmutenden, durchdigitalisierten, 15-Minuten-City-Dystopie, deren noch ausbremsbares Entstehen wir im zweiten Teil behandeln werden.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
(1) Siehe Mitscherlich, Alexander „Die Unwirtlichkeit unserer Städte“, Frankfurt am Main, 1965, Suhrkamp Seite 9
(2) Siehe am angegebenen Ort, Seite 9
(3) Siehe am angegebenen Ort, Seite 17 Fortfolgende
(4) Siehe am angegebenen Ort, Seite 26
(5) Siehe Han, Byung-Chul: „Die Errettung des Schönen“, Frankfurt am Main, 2020, S. Fischer, Seite 26
(6) Vergleiche Casetti, Francesco: „The Lumiere galaxy - Seven key words for the cinema to come“, New York, 2015,
Seite 157 bis 159.
(7) Siehe Han, 2020, am angegebenen Ort, Seite 36
(7) Siehe Han, 2020, am angegebenen Ort, Seite 36 Fortfolgene
(8) Siehe Walsh, Jessica; Sagmeister, Stefan: „Beauty“, Mainz, 2018, Seite 5
(9) Vergleiche Ebenda, Seite 5 Fortfolgende, sowie Seite 134.
(10) Siehe Han, Byung-Chul: „Undinge: Umbrüche der Lebenswelt“, Berlin, 2021, Ullstein, Seite 81.
(11) Siehe Han, 2020, am angegebenen Ort, Seite 37 Fortfolgene