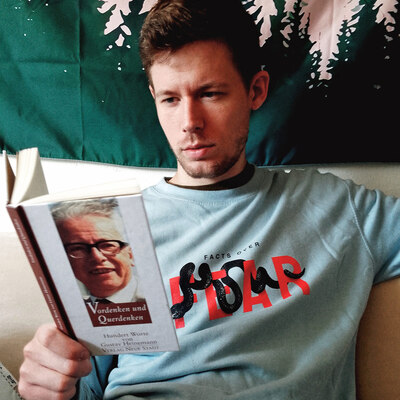Die nachfolgende Kartierung der — scheinbaren — Auswege aus der Würfel-Wüste nimmt neben dem architektonischen Aspekt auch die Menschen als handelnde Subjekte in den Fokus. Im vorherigen Teil wurde ausführlich aus dem scharfsinnigen Text „Die Zeit der toten Städte“ von Michael Sailer zitiert. Die wichtigste Frage, die Sailer darin gestellt hat, wird uns durch den gesamten Beitrag begleiten: „Wer hat sie, die Städte, gemacht?“ Wer sind die handelnden Subjekte, die die Städte errichten, sie gestalten, sie mit Leben füllen? Sind das alle Bewohner? Oder ist das Recht auf Stadtgestaltung nur wenigen Auserkorenen vorbehalten?
Des Weiteren werden wir immer wieder auf eine Gruppe von Menschen zurückkommen, die der urbane Raum zwangsläufig hervorbringt und die in manchen Fällen — wie wir noch sehen werden — verdrängt oder wie von Michel Foucault beschrieben, in Kerker-Systeme verbannt und damit aus dem öffentlichen Raum getilgt werden. Die Rede ist von Obdachlosen, Verrückten, Verbrechern, gar Gangmitgliedern, denen die Verwahrlosung des Stadtbildes angelastet wird, während sie selbst Opfer, das tragische Endergebnis dessen sind, was die Ballung von Millionen Menschen auf engsten Raum mit jenen macht, die mit den ökonomischen und sozialen Erfordernissen des städtischen Lebens nicht mehr Schritt halten können. Viele der im Folgenden präsentierten Lösungen werben damit, dass in ihren Konzepten die genannte Menschengruppe weniger wird oder nicht mehr länger vorkommt.
Zwischen Transformation und Schönmalerei
Bereits im ersten Teil zitierte ich aus dem Illustrationsband „Beauty“ von Jessica Walsh und Stefan Sagmeister. (1) Das Werk der beiden Designer ist ein großartiger Inspirationsgeber für die Gestaltung von Schönheit und ebenso ein flammendes Plädoyer, in die Welt wieder mehr Schönheit einfließen zu lassen, die, empirisch belegbar, im Schwinden begriffen ist. So viel Schönes dieses Werk in Bild und Text auch bereithält, so manches daran ist doch zu schön, um gänzlich wahr zu sein.
Die Würfel-Wüsten — auch wenn sie in dem Werk nicht als solche bezeichnet werden — spielen eine seitenfüllende Rolle. Mit einer statistisch überaus relevanten Anzahl an Teilnehmern ermittelten die beiden Designer über Instagram-Fragerunden, welche Form und Farbe im Zusammenspiel als die hässlichste wahrgenommen wird. Das Ergebnis: das braune Rechteck. (2) Nun sind die Würfel-Wüsten weitestgehend in Anthrazittönen gehalten, doch sind braune Rechtecke im Stadtbild keineswegs eine Seltenheit. Kurzum: Die Scheußlichkeit der Würfel-Wüsten ist statistisch evident.
Die Lösungsansätze und Beispiele von Walsh und Sagmeister für das Eindämmen oder die Neuaufforstung der Würfel-Wüsten sind durchaus beeindruckend — nur eben nicht immer konsequent zu Ende gedacht. In dem Kapitel „Transformierende Schönheit“ heißt es in der Einleitung: „Schönheit verändert nicht nur unser Empfinden, sondern beeinflusst auch unser Handeln. Sie verwandelt uns.“ (3)
Zur Einführung belegen die beiden das mit einer eigenen Auftragsarbeit in New York. Der zur Verschönerung eingewiesene Patient ist eine hoffnungslos versiffte Unterführung in Brooklyn. Mit einem Budget von 5.000 US-Dollar zauberten die beiden mit Spraydosen ein großes, kunstvolles „Yes“ auf die Wände des Unortes. Und siehe da — fortan wurde die Wand nicht länger als Pissoir missbraucht. Stattdessen pilgerten seither verheiratete Paare hier hin, um sich vor dem leuchtenden „Yes“-Schriftzug im Hintergrund abzulichten. Die Botschaft: Schönheit erzeugt so viel Ehrfurcht, dass die Menschen vor ihr es nicht länger wagen, sie zu verschandeln. So weit, so schön.
Als weiteres Beispiel — ebenfalls aus dem Big Apple — ziehen die Designer die Renaturierung der sogenannten High Line heran, eine 1980 stillgelegte Hochgleisbahn, die einst den Güterzugverkehr nach Manhattan ermöglichte. Nach ihrer Außerbetriebnahme wurde die lange Schienenbrücke dem Verfall überlassen und drohte, abgerissen zu werden. Eine Bürgerinitiative, die in dem verwaisten Brückengelände ein Potenzial erkannte, beauftragte ein Architekturbüro mit der Aufgabe, den Geisterort in einen „Place to be“ zu verwandeln.
Seitdem ist die längliche Brücke eine bei Touristen wie Einheimischen beliebte Grünfläche geworden, die zugleich milliardenschwere Neubauprojekte in das Viertel West Chelsea lockte. Dieses Transformationsprojekt soll nicht nur die Blaupause für ein paar Dutzend ähnlich gearteter Projekte weltweit sein; euphorisch wird zudem hervorgehoben, dass es in und um die Parkanlage herum keine Vermüllung mehr gäbe und in den ersten beiden Jahren nach der Eröffnung im Jahr 2009 an diesem Ort kein einziges Verbrechen verzeichnet worden sei.
Während die beiden Transformationsbeispiele aus New York nur punktuelle Bereiche der Stadt betreffen, zeigen Walsh und Sagmeister anhand des albanischen Künstlers Edi Rama, wie eine ganze Stadt einer Schönheitskur unterzogen werden kann. Der noch zu Sowjetzeiten großgewordene Künstler Rama zog nach Paris und kehrte nach dem Zerfall des Ostblocks in das ebenso zerfallene Tirana zurück. Mit der Ambition, die albanische Hauptstadt von der post-sowjetischen Tristesse zu erlösen, ging er in die Politik. Zunächst als Kulturminister, später, um die Jahrtausendwende, als Bürgermeister von Tirana. Mit aus Deutschland akquirierten Geldern veranlasste er kurzerhand, die Gebäude der hässlichen Stadt mit bunten Farben zu überziehen und zahlreiche illegale Bauten wieder abzureißen, bis die gesamte Metropole zu einer riesigen Villa Kunterbunt und schließlich zu einem Touristenmagneten wurde. Sein Verdienst wurde 2004 mit der Verleihung des World Mayor Award gewürdigt.
Anschließend präsentieren die beiden Autoren das Favela Painting Project in Rio de Janeiro. Initiiert wurde es von dem niederländischen Designer Jeroen Koolhaas und dem Künstler Dre Urhahn. Gemeinsam mit der Gemeinde entwickelten sie ein Konzept, das trostlose Armenviertel mit einem farbenprächtigen Muster zu überziehen. Die Verwandlung des Viertels fand zahlreiche Nachahmer in Südamerika.
Auch die brasilianische Metropole São Paulo wurde einer Transformation unterzogen. Auf Geheiß des Bürgermeisters Gilberto Kassab wurden die Gebäude zwar nicht in bunte Farben getaucht, aber dafür per Gesetz von ihren Plakatflächen und anderer Außenwerbung befreit. Dasselbe geschah mit Bussen und Taxen. Ebenso wurde das Verteilen von Flugblättern untersagt. Örtlichen Künstlern war es gestattet, die Hausfassaden mit Malereien im Sinne der ehemaligen Werbetreibenden zu verzieren, solange sie auf die Verwendung von Markensymbolen verzichteten. Das Ergebnis war ein von visueller Verschmutzung befreites Stadtbild.
Diese radikale Verbannung der Werbung inspirierte wiederum das ecuadorianische Quito, einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Geschäftsinhabern war es fortan nur noch gestattet, ihre Waren und Dienstleistungen mit einheitlichen Metallschildern oberhalb des Ladeneingangs anzubieten. Das beendete den immer schriller werdenden Überbietungswettbewerb, bei dem die Geschäftsinhaber mit immer noch größeren und noch aggressiver blickenden Anzeigetafeln um die Aufmerksamkeit der potenziellen Kunden buhlten. Aus dem Schatten des abebbenden Werbetafelmeeres trat die historische Architektur wieder zum Vorschein.
Ein Schwenk zurück in die USA, nach Philadelphia: Dort präsentieren Walsh und Sagmeister das 1984 lancierte Mural Arts Programm. Dieses verwandelte die Hausfassaden der Stadt nach und nach in eine riesige Kunstgalerie und trug so zur Verbesserung der städtischen Lebensqualität bei.
Wahrlich rebellisch und button-up ist der Fall der indischen Stadt Rajasthan. Angehörige der „unteren Kaste“ begannen „unerhörterweise“ damit — unter dem Vorwand, dass dies gegen Moskitos schütze — ihre Häuser blau anzumalen, etwas, das eigentlich allein der „oberen Kaste“ vorbehalten ist. Das Blau ist nämlich mit dem Gott Shiva assoziiert. Die Bewohner haben damit nicht nur der Hierarchie des Kastensystems die Stirn geboten, sondern zugleich ihrer Stadt ein schöneres Antlitz verliehen. (4)
Walsh und Sagmeister resümieren:
„Die praktische Anstrengung von Designern und den Bewohnern, die Attraktivität einer Stadt zu steigern, untermauert unsere Überzeugungen. Der einfache Akt des Malens — oft unter der Verwendung von Farben, die orthodoxe Modernisten nie genehmigen würden — hat zu einer signifikanten Verbesserung der Lebensqualität in einer Reihe von aufstrebenden Städten geführt. Durch diese Beispiele wird klar, dass die Kraft der Schönheit das Leben verändern kann. Unsere Überzeugung ist nicht theoretisch — sie wurde von Philadelphia, bis Rio, von Tirana bis Seoul bewiesen.“ (5)
Nun wenden wir die beiden eingangs genannten Fragestellungen auf die hier beschriebenen Fallbeispiele an: Wer hat die Stadt gemacht und was hat es mit den dahinterstehenden Menschen auf sich, die sich hinter der Bezeichnung „Verbrechen“ verbergen, deren Rückgang im Zuge der Verschönerung lobend hervorgehoben wird?
Beginnen wir mit der Frage der Städtemacher: Von wem ging die Initiation zur Umgestaltung der Städte aus? Die Antwort fällt dabei sehr ambivalent aus. Mal kam der Anstoß zur Veränderung, was die Beteiligung der Gesamteinwohner betrifft, von unten, von der Basis her. So etwa in Rajasthan, wo sich Menschen kollektiv entschlossen die Häuser entgegen kastensystemischer Ge- und Verbote blau anzustreichen. Ähnlich verhielt es sich teilweise bei der New Yorker High Lane, deren Umgestaltung immerhin von einer Bürgerinitiative ausging, ebenso bei den Wandbemalungen in Philadelphia. Das Favela Painting Project in Rio war immerhin in der Umsetzung noch ein gemeinschaftliches Projekt der Anwohner, wenngleich die Aktion in dezent kolonialistisch anmutender Weise von zwei Niederländern angestoßen wurde. Ein fahler Beigeschmack bleibt: das unausgesprochene Motto:
„Wir weißen Europäer gehen jetzt mal in die Armenviertel der Schwellenländer und zeigen diesen unterentwickelten Menschen, wie Schönheit geht.“
Gänzlich umgekehrt verhält es sich bei den Fallbeispielen aus São Paulo, Quito, Tirana und Brooklyn. Hier treten wenige Schönheits-Messiasse auf, die die Schönheit überstülpen oder gesetzlich von oben herab verordnen. Hier ließe sich natürlich einwenden: „Na, zum Glück macht mal jemand was, statt nur zu meckern!“ Und sicherlich kann sich das Ergebnis sehen lassen. Doch muss hier die Frage gestellt werden, wie nachhaltig eine Verschönerung ist, mit der die Menschen, die Einwohner der Stadt zwangsbeglückt werden? Im Falle von Tirana waren gerade einmal 60 Prozent der Einwohner mit den Verschönerungsmaßnahmen zufrieden. Den anderen vierzig Prozent — immerhin mehr als ein Drittel — war das Ganze wohl zu bunt.
Ob Schönheit oder Hässlichkeit von oben verordnet wird — in beiden Fällen werden die Einwohner zu einer Masse degradiert, die die realisierte Vorstellung von Schönheit und/oder Effizienz der Stadtplaner einfach erdulden muss. Das einzelne Subjekt kann sich nicht als selbstwirksam und schöpferisch erleben, sondern bekommt, wie ein Sims in einer SimCity von einer gestalterischen Macht ungefragt etwas vorgesetzt.
Hinzu kommt, dass die Verschönerung die Lebensumstände der Einwohner nicht zwangsläufig verbessert — im Gegenteil. Walsh und Sagmeister beenden das genannte Kapitel mit der Beschreibung eines ebenfalls aufgehübschten Viertels in Seoul, das durch Wandmalereien so schön, ja zu schön wurde, sodass im Lichte dieser Schönheit Schatten heraufzogen. Gemeint sind die Touristenhorden, die das einst heruntergekommene Stadtviertel belagern und es dadurch so unbewohnbar machen, dass manche der Einwohner die schönen Waldbemalungen wieder überschmierten. Die von Selfie-Salafisten belagerten Bewohner der Pariser Rue Crémieux können, untermalt von französischen Akkordeons, ein trauriges Lied davon singen.
Der Fluch, der diesen Segen wie ein Schatten begleitet, führt uns zur zweiten Frage, nämlich der nach den Verbrechen und der Obdachlosigkeit, die infolge der Verschönerung zurückgegangen seien sollen.
Es klingt nach einer utopischen Zauberformel: Wir nehmen einfach Pinsel und Spraydose, malen damit die ganze Welt bunt an — und schon verschwinden Verbrechen und Armut.
Diese Vorstellung ist natürlich traumtänzerisch, selbst wenn es auf den ersten Blick erscheint, als ließe sich Kriminalität einfach in Schönheit ertränken. Menschen begehen schließlich nicht ausschließlich deswegen Verbrechen, weil die Gegend um sie herum derart hässlich ist, sondern aus ökonomischen und sozialen Nöten heraus. Der ökonomische Faktor findet bei Walsh und Sagmeister leider kaum Beachtung, was bedauerlich ist, weil es den Gesamtblick versperrt. Bei dieser Gesamtperspektive würde man nämlich sehen, dass zweifelsohne durch die Verschönerung die Obdachlosigkeit und die Kriminalität — konkrete die Kleinkriminalität — aus den Vierteln zurückgeht oder gänzlich verschwindet — mitsamt der Menschen!
Die Verschönerung der Viertel ist prinzipiell dem Phänomen der Gentrifizierung nicht unähnlich. Die Viertel werden nach außen und auch nach innen hin saniert, von vormaligen Scherbenvierteln zu In-Vierteln aufgewertet, einhergehend mit steigenden Lebenserhaltungskosten, die sich manch — notgedrungen kriminelle — Ureinwohner nicht mehr werden leisten können und infolge dessen gezwungen sind, umzuziehen. Die Delikte werden durch die Verschönerung nicht weniger, sie verlagern sich lediglich in unverändert hässliche Viertel. Selbstredend steigt mit der Lebensqualität eines Viertels zugleich die Sicherheitsgewährleistung durch den Staat, der sich die steuerliche Lukrativität des neuen Hip-Viertels nicht durch Kleinganoven schmälern lassen möchte. Entsprechend wird es für Kleinkriminelle schwieriger, in den aufgepeppten Vierteln ihre soziale Schieflage durch Raub- und Drogenhandelsdelikte aufzubessern.
Wenn man sich konkret das Beispiel der begrünten High Line im New Yorker Stadtteil Chelsea ansieht, dann spricht selbst der als Beleg verlinkte Artikel der New York Times davon, dass der Rückgang der Kriminalität anderen Faktoren zuzurechnen ist — etwa der Tatsache, dass die hochgelegene Grünanlage links und rechts von Fenstern, und damit von potenziellen Zeugen, umgeben ist. Ebenso ist der High Line Park mit unzähligen Kameras ausgestattet, die Kleinkriminelle von ihrer Tat abhalten.
Es wäre zu schön und zu einfach, eine Kausalität herzustellen, wonach ein Mehr an Schönheit, ein Weniger an Kleinkriminalität und Obdachlosigkeit bedeuten würde. Umgekehrt ist schließlich auch zu bedenken — das als kurzer Einschub —, dass es in der DDR im Vergleich zum Westen keine nennenswerte Bandenkriminalität und Obdachlosigkeit gab. Das war auf verschiedenartigste Faktoren zurückzuführen — die Schönheit der Gebäude war sicherlich keiner davon. Auch in zum Teil trostlosen bis potthässlichen Gegenden können die Quoten an Obdachlosigkeit und Kleinkriminalität gering sein, wenn die ökonomischen Rahmenbedingungen dies ermöglichen. Zu welchem Preis das geschieht, ist noch einmal ein Thema für sich — der Planwirtschaft soll hier keinesfalls das Wort gesprochen werden.
Kehren wir zum Abschluss dieses Abschnitts noch einmal zu der schwindenden Kleinkriminalität zurück, wobei hier das Anfangswort „Klein“ stets betont wurde — das nämlich aus gutem Grund. Blicken wir noch ein letztes Mal auf das Beispiel des durch die High Line aufgewerteten Viertels New Chelsea in NYC und greifen erneut die These auf, wonach die Kriminalität zurückgegangen sei. Dass sich die Kleinkriminalität örtlich wohl nur verlagert hat — man betrachte hierbei nur die ab 2009/10/11 konstant gebliebene Kriminalitätsstatistik — haben wir bereits herausgearbeitet. Zur Abrundung sei ergänzt, dass die eine Kriminalität wohl schlicht durch eine andere ersetzt wurde.
Walsh und Sagmeister schwärmen von den dortigen milliardenschweren Neubauprojekten, respektive neuen Wohnungen für Wohlhabende — Gebäude, die im Übrigen teilweise ebenso den Kriterien von Würfel-Wüsten-Häusern entsprechen. Das nur als Randnotiz. Die sich hieraus ergebende Frage lautet: Wer garantiert denn, dass diese Menschen, die neuen Bewohner von New Chelsea nicht ebenfalls kriminell sind? Eben nicht kleinkriminell, sondern großkriminell? Die Straßengangster in Jogginghose und Lederjacke mögen verschwunden sein, doch an ihre Stelle sind womöglich Verbrecher in Anzug und Schlips getreten — jene, die an der nahegelegenen Börse in Manhattan vielleicht mit Rüstungsverkäufen Reibach machen, durch Lebensmittelspekulationen Menschen in den Hungertod treiben oder anderorts Existenzen in den Ruin treiben mit dubiosen Immobiliengeschäften — Geschäfte, die vielleicht sogar im Zusammenhang stehen mit Würfel-Wüsten, womit sich der Teufelskreis schließt.
Freie Privatstädte
Das in libertären Kreisen vielgepriesene Konzept der freien Privatstädte — ebenso wie das der Charter Cities — ist ein Themenkomplex, der ganze Bücher füllt. Um zu erörtern, ob Städte dieser Art eine probate Lösung für die Würfel-Wüstenbildung bieten — die Vermutung liegt schließlich nahe —, sollen an dieser Stelle die Grundrisse, reduziert auf das Wesentlichste, grob skizziert werden — ebenso die elementaren Punkte der ökonomischen und ideologischen Kritik.
Dem Konzept der freien Privatstädte liegt das Leitmotiv zugrunde, eine unternehmerisch geführte, administrierte und verwaltete Stadt innerhalb einer Sonderentwicklungszone — also einer Enklave innerhalb eines Nationalstaates — zu errichten. Während die außenpolitischen Belange und Rechte des Gastgeberlandes unangetastet bleiben, wird den betreibenden Unternehmen und Institutionen der Sonderentwicklungszone, respektive der freien Privatstadt, auf dem zugeteilten Gebiet das Recht eingeräumt, die Infrastruktur, die Wirtschaft und die Gewährleistung der Sicherheit sowie den Schutz des Eigentums nach eigener Fasson zu gestalten.
Gemäß libertärer, anti-etatistischer und marktliberaler — oder auch marktradikaler — Weltanschauung, wird Staat und Steuererhebung als illegitim und ob der einseitigen „Vereinbarung“ als Räuber und Raub begriffen. Dem hält das Konzept der freien Privatstadt entgegen, dass die Vereinbarung beidseitig, zwischen dem dienstleistenden Stadtbetreiber und seinen Einwohnerkunden geschlossen wird. Der privatwirtschaftliche Stadtverwalter bietet im Gegenzug zu einer regelmäßigen Gebührenzahlung die Gewährleistung von Funktionalität, Sauberkeit, Sicherheit und Wahrung des Privateigentums für die freiwillig zugezogenen Bewohner der Stadt, die unter diesen Gesichtspunkten als „Vertragsbürger“ verstanden werden.
Die Verwalter der unternehmerisch geführten Stadt hätten demnach ein ureigenes Interesse, jedwede Form der Lebensqualität aufrechtzuerhalten, da andernfalls die Vertragsbürger auswandern und die Stadt infolge dessen langfristig — wie ein Unternehmen mit schlechter Dienstleistung — bankrottgehen würde. Der Anreiz für den gastgebenden Nationalstaat, einen Teil seiner Autonomie abzutreten, sei der durch die Sonderentwicklungszone magnetisch angezogene Wohlstand und die Lukrativität, die sich durch die Oase der Prosperität mehren würden. Die wohl bekannteste Stadt dieser Art — deren Anzahl bis heute noch sehr überschaubar ist — ist das auf der honduranischen Insel Roatán gelegene Próspera.
Man könnte nun annehmen, dass sich hier — auf dem freien Markt — Schönheit durchsetzen könnte, sofern sie wirklich gefragt wäre. Die Errichtung von Schönheit könnte schließlich auch in das Leistungsportfolio des städtischen Dienstleisters einfließen.
Doch wie sieht die Realität der freien Privatstädte aus? Der Soziologe Andreas Kemper hat zu diesem Themenkomplex ein kritisches Standardwerk mit dem Titel „Freie Privatstädte: Labore für einen neuen Manchesterkapitalismus“ verfasst. Trotz mainstreamiger Färbung und der durch Gendersterne erschwerten Lesbarkeit ist die Lektüre über weite Strecken erhellend — gerade, wenn es darum geht, die dahinterliegenden Netzwerke (Atlas Network, Cato Institute, Mises Institute), Denkschulen und Ideologien zu erkennen. Ökonomisch basiert dieses Städtekonzept auf den Ideen und Vorstellungen der Chicago-Boys, sowie der Österreichischen Schule der Nationalökonomie. Kemper verwendet für die Bezeichnung der Privatstädte den Begriff des „Enklaven-Propritarismus“ — also die Absonderung eines (Staats-)Gebiets, auf welchem das Eigentum ungehindert von staatlichen Interventionen schalten und walten kann.
Autobiografisch bringt er die Privatstädte in Verbindung mit industriellen Arbeitersiedlungen, in denen er selbst groß geworden — Siedlungen, deren gesamtes Gefüge nach der arbeitgebenden Fabrik und ihren Besitzern ausgerichtet war. Demokratische Prinzipien, die vorher schon strukturell an der Werkspforte ihr Ende finden würden, wären nach Kemper in freien Privatstädten vollends ausgehebelt, da Kapitalinteressen nicht mehr durch einen dazwischengeschalteten (Sozial-)Staat abgefedert würden.
Wie Kemper belegt, scheuen sich Initiatoren und Befürworter dieser Konzepte auch nicht, die „Demokratie“ — was immer das heute noch bedeuten mag — offen abzulehnen. Auf dem historischen Zeitstrahl zeichnet er nach, dass die Entstehung von Sonderentwicklungszonen und der in ihnen entstehenden Privatstädte keineswegs auf der viel beschworenen, beidseitigen Vereinbarung zweier auf Augenhöhe befindlicher Vertragspartner fußt, sondern häufig auf Putschen gegen linke Staatsführer, derer man sich entledigen musste, um den Weg für diese Projekte freizumachen. Darüber hinaus haben einige Vordenker der freien Privatstädte, wie er zu Beginn des Buchs aufzeigt, auch keinerlei Berührungsängste mit rassenbiologischen Denkweisen — Denkweisen, die diese teils sehr unverhohlen zum Ausdruck bringen und mit denen sie begründen, warum es dem vermeintlich überlegenen, weißen Mann obliege, die Städte zu gestalten. (6)
Soweit die kritische Einordnung von Andreas Kemper. Über die Demarkationslinien der Mainstream-Kritik hinaus ist in diesem Zusammenhang — und im Bezug auf die in Teil 2 skizzierten Smart-Cities — anzumerken, dass in Privatstadtprojekten wie Próspera vielerlei derer investiert sind, die im Bereich von Big-Tech und Observationsökonomie Rang und Namen haben, etwa Sam Altman (OpenAI) oder PayPal-Mafiachef Peter Thiel (Palantir).
Durch die innere Rechtsautonomie ist es den Betreibern darüber hinaus möglich, auf verschiedenen Feldern — etwa dem der medizinischen Experimente — in einer Weise zu operieren, wie es auf dem Territorium herkömmlicher Nationalstaaten mit der gültigen Rechtsprechung kaum vereinbar und denkbar wäre. So gibt es in Próspera Gen-Therapie-Kliniken, die ihren Kunden ein verlängertes, verjüngtes, gar ewiges Leben verheißen. Spätestens hier sollten sämtliche Alarmglocken schrillen!
Dass den betreibenden Privatstädtlern weder am Wohlergehen der Bevölkerung noch an Fairness gelegen ist, zeigte sich schlussendlich dann, als es der honduranischen Regierung unter Xiomara Castro mit der Sonderzone zu bunt wurde und sie damit begann, einige der gewährten Sonderrechte zu entziehen. Statt mit Einsicht reagierten die Investoren mit einer Klage vor dem „völlig neutralen“ Schiedsgericht „International Center for Settlement of Investment Disputes“ (ICSID) — der Streitwert: knapp elf Milliarden US-Dollar, also rund ein Drittel des honduranischen Bruttoinlandsprodukts. Bei der Castro-Regierung handle es sich selbstverständlich – wie könnte es auch anders sein — um „Sozialisten“.
Nach dieser notwendigerweise umfassenden Einführung in die Thematik, betrachten wir die Privatstädte nun im Lichte unserer Kernfragen: Wer hat die Stadt gemacht? Welche Rolle kommt den Menschen in prekären Situationen zu? Und schließlich: Haben die freien Privatstädte architektonisch einen erstrebenswerten Gegenentwurf zu den Würfel-Wüsten zu bieten?
Die erste Frage — jene nach den Machern der Stadt — ist schnell beantwortet: Es sind nicht die Menschen selbst, die diese Städte aus dem Boden ziehen, sondern eine Handvoll Baufirmen, die im Auftrag von Großinvestoren die Gebäude in die Landschaft meißeln. Von organischem Wachstum kann keine Rede sein — freie Privatstädte entstehen nicht historisch, sondern folgen rein funktionalistischen Gesichtspunkten. Sie sind das in Beton gegossene Habitat von Francis Fukuyamas 1989 proklamierten „Ende der Geschichte“, wonach sich die freie Marktwirtschaft nach dem überwundenen Kampf der Systeme als letztgültiges System durchgesetzt und den auf Veränderung und Verbesserung zielenden Antriebsmoment der Geschichte zum Erliegen gebracht habe.
Die in ihnen lebenden Vertragsbürger sind weniger als Einwohner, sondern vielmehr als Nutzer beziehungsweise Kunden zu verstehen — nicht als Menschen, die an diesem Ort verwurzelt sind oder ihn gar als Heimat bezeichnen könnten. Und selbst jene „Ureinwohner“, die sich auf dem Gebiet dieser Sonderverwaltungszonen befinden — in Próspera sind 90 Prozent der Mitarbeiter (!) Honduraner —, sind keine Einwohner im herkömmlichen Sinne, sondern Angestellte. Das bestätigt, dass Kempers Analogie zu den rings um die Fabrik errichteten Arbeitersiedlungen nicht weit hergeholt ist. Man bedenke in diesem Zusammenhang, dass sich in Deutschland so mancher, der etwas von einer „BRD GmbH“ raunt, schon darüber echauffiert, dass der Pass als „Personalausweis“ bezeichnet wird. Währenddessen ist der Unternehmerstaat in solchen Zonen wahrhaftig verwirklicht.
Doch zurück zum ahistorischen Charakter dieser Städte: Als „historisch“ zu bezeichnen ist allenfalls die strukturelle Selbstähnlichkeit mit Monarchien und Fürstentümern des vergangenen Jahrtausends. Ein Muster werden all jene erkennen, die sich bereits mit der in Europa noch viel zu wenig, aber in den USA umso mehr beachteten und bereits realisierten Denkrichtung und Ideologie der „Dunklen Aufklärung“ beschäftigt haben. Stichwortgebende Namen lauten hierbei Curtis Yarvin und Nick Land. Ein elementarer Eckpfeiler dieser Ideologie ist die Vorstellung, ein Land müsse wie ein Konzern geführt werden. Insofern sind Städte wie Próspera für diesen Zweck genau das, was Kemper in seinem Untertitel beschreibt: ein Versuchslabor.
Vor diesem Hintergrund liegt die Antwort auf die Frage nach dem Verbleib der prekären Menschen nahe: Sie bleiben fern. Próspera-Mitinvestor Titus Gebel (Free Cities Foundation) — ein in diesem Zusammenhang besonders wichtiger Name — formulierte es in einem Gespräch mit dem Ludwig von Mises Institut sehr unverblümt: „Die ZEDE wird sich vorbehalten, etwa Schwerkriminelle, Kommunisten und Islamisten nicht aufzunehmen.“ Schwerkriminell sind natürlich immer nur die anderen, respektive die ökonomisch schlechter Gestellten — wir hatten diese Gegenüberstellung bereits im vorangegangenen Abschnitt in Bezug auf New Chelsea.
In dieser verengten und projizierenden Betrachtungsweise werden Schwerkriminelle stets als Menschen mit angeborener Charakterverdorbenheit betrachtet und nicht als die Opfer ökonomischer Ungerechtigkeiten, die zumeist von jenen hervorgebracht und nachhaltig aufrechterhalten werden, die sich selbst nie, aber stets die anderen als Schwerkriminelle definieren.
Dabei unterscheiden sich die zwei Formen der Kriminalität — die Kleinst- und Schwerkriminalität einerseits, Großkriminalität andererseits — schlicht darin, dass letztgenannte aufgrund der finanziell haushohen Besserstellung in der Lage ist, ihre strukturelle Kriminalität zu legalisieren und mit PR-Strategien zu legitimieren. So gelten im urbanen Raum weltweit jene als kriminell, die in den Brennpunkten und Slums mit Raubdelikten ihr Überleben sichern — nicht jedoch die Anzugträger in den Glastürmen, die diese Verknappung und Umverteilung strukturell zementieren.
Die freien Privatstädte, die die Sicherheit als einen der Top-Sales-Pitches wie eine Monstranz vor sich hertragen, versprechen im Grunde genommen den Schutz der Vermögenden und der gehorsamen Bediensteten vor jenen vielen Menschen, die in den Profit-Regimen finanziell wie sozial unter die Räder kommen und dabei nicht den „Anstand“ besitzen — so die zynische Logik der Meritokratie —, sich widerstandslos ihrem mangels Leistungsbereitschaft selbstverschuldeten Elend hinzugeben.
Es kristallisiert sich das Bild der freien Privatstädte heraus, als abgeschiedenes Ressort des Wohlstandes und der unbegrenzten Möglichkeiten, während die übrigen urbanen Räume zu einer Smart-City-Wüste mit begrenzten Möglichkeiten verkommen sollen. Wer „artig“ ist, kann dort ein Dasein als digital sedierter, neo-feudal versklavter Bürger führen. Für alle übrigen — Obdachlose wie Aufmüpfige — wartet bereits eine für die Kaste der Besitzenden lukrative Gefängnisindustrie, die „all the useless people“ (Yuval-Noah Harrari) dankend und einkerkernd in Empfang nimmt.
Wer genau wissen will, welches Menschenbild und soziales Verständnis den Erbauern der freien Privatstädte zugrunde liegt, muss nur den Worten des leitenden Architekten von Próspera, Patrik Schumacher lauschen. Schumacher, vormals Marxist und heute bekennender Neoliberaler, ist Vordenker der Parametrismus-Architektur und arbeitete bis zu ihrem Tod 2016 mit der Top-Architektin Zaha Hadid zusammen. Seitdem leitet er ihr Architekturbüro, Zaha Hadid Architects — auf das wir später noch zurückkommen werden.
Über die Architektur-Bubbles hinaus erlangte Schumacher unrühmliche Bekanntheit, als er den wohl größten Shitstorm der jüngsten Architektur-Geschichte erntete, nachdem er lapidar forderte, 80 Prozent des Londoner Hyde Parks zuzubetonieren — mit der Begründung, dass die meiste Grünfläche ohnehin nicht genutzt werde.
Entlarvend ehrlich ist Schumacher in einem Interview, das er 2018 der Zeit gab. Auf die Frage des Interviewers Tobias Timm, welche politische Strömung hinter dem Parametrismus stecke, antwortet er:
„Der Neoliberalismus. Der Neoliberalismus muss jetzt radikalisiert werden. Genauso wie die Architektur, die bisher in Retro-Stilen verharrt. Wir haben uns mit dem Parametrismus noch nicht hegemonial durchgesetzt. Aber der große Schub für den Parametrismus wird kommen, es gibt dazu keine Alternative.“
Entgegen seinem sonstigen Pochen auf die Prinzipien des freien Marktes und der Freiwilligkeit, plädiert er hier für hegemoniale Durchsetzung und nutzt dabei selbstverständlich die altbekannte TINA-Formel des Neoliberalismus: There is no alternative!. Auf die Frage, ob er „den Wunsch vieler Menschen nach einem kleinen, gemütlichen Eigenheim mit Giebeldach“ verstehen könne, antwortet Schumacher konstant totalitär:
„Selbstverständlich. Aber man sollte nicht immer seinen Gefühlen folgen. Für das eigene Lebensglück und die damit zusammenhängende Attraktivität und Produktivität muss man eine passende ästhetische Sensibilität für die moderne Welt entwickeln. Eigenbrötler, die sich aus dem Chaos der Großstadt zurückziehen, schneiden sich von Möglichkeiten ab. Der Nostalgie des kleinen Gartens sollte man auf keinen Fall frönen. (…) Ich möchte fußläufig wohnen. Ich will schnell ins Büro, zwischendurch in die Ausstellung, einen Vortrag anhören oder ein breakfast networking meeting haben. Dann habe ich schon wieder neuen Input für die Arbeit. Ich will upgedatet sein, sonst schneide ich mir meine Karrieremöglichkeiten ab.“
Es entbehrt dabei nicht einer gewaltigen Ironie, dass Schumacher in diesem Interview überall den Sozialismus und den eingreifenden Staat wittert, der die Mechanismen des freien Marktes stören würde, während er selbst in der Totalität und Übergriffigkeit, die er beim (Sozial-)Staat angeprangert, anderen Menschen seine Wunschvorstellung von einem guten Leben aufoktroyiert. Wer der Idylle des suburbanen Häuschens mit Garten nachhängt, würde sich von den Möglichkeiten abschneiden — natürlich ist es umgekehrt! Wer nicht im urbanen Raum leben möchte, wird von den Möglichkeiten abgeschnitten, die im außerstädtischen Kern schlicht eintrocknen, wie Schumacher im weiteren Verlauf des Gesprächs unverändert entlarvend zum Besten gibt. Er bejaht die Frage, ob er „gegen die soziale Durchmischung der Stadt“ sei:
„Empirische Studien belegen, dass die verordnete Mischung die intendierte soziale Mobilität nicht geliefert hat, sie fördert vielmehr Konflikte zwischen den Milieus. Auch das könnte der Markt besser regeln. Es müssen nicht alle Einkommensgruppen im Stadtzentrum sitzen. Meine Mitarbeiter sollten hier im Zentrum wohnen, weil sie in die Ausstellungen, in den Pub, in Kulturinstitutionen gehen müssen, um sich weiterzubilden. Die Sicherheitsleute und das Reinigungspersonal haben andere Prioritäten, haben andere Karriereentwicklungen, die brauchen doch nicht in der Stadt zu wohnen. Die arbeiten weniger hart; wenn die eine Stunde länger in der Bahn sitzen, ist das nicht tragisch. Da gehen weniger Produktivitätskapazitäten verloren.“
Auf den Einwand von Timm, dass Menschen hierdurch von „sozialer Mobilität abgeschnitten“ werden würden, antwortet er nicht minder kaltschnäuzig:
„Soziale Mobilität lässt sich nicht staatlich verordnen. Bei manchen klickt es einfach nicht, da findet eine Integration aufgrund von eigener Feindseligkeit oder anderen persönlichen Barrieren nicht statt, egal wo man wohnt. Umverteilung ist auch immer die Belohnung von Versagen und macht das Versagen damit zur Option.“
Wir halten die verordneten Visionen Schumachers fest, der Mann, der als Bürostuhlwärmer ernsthaft glaubt, härter zu arbeiten als eine Putzkraft: Für die Kaste der CEOs und Konzern-Funktionseliten ist futuristische Parametrismus-Architektur im urbanen Raum vorgesehen, während der „Service-Pöbel“ aus der unteren Kaste sein trauriges Dasein am trostlosen Stadtrand fristen darf — selbstredend nicht in Einfamilienhäusern mit Garten, sondern in genau dem, worum sich diese Beitragsserie dreht: den Würfel-Wüsten.
Es ist ratsam, das gesamte Interview zu lesen, um in der Tiefe zu begreifen, wes Geistes Kind in der Ideologie der Privatstädte schlummert. Er macht gar keinen Hehl daraus, dass er für die Abschaffung von Mietpreisbremsen und Sozialleistungen, sowie für soziale Kontrolle per Social-Credit-System ist. Wer nichts „verbricht“, habe schließlich auch nichts zu befürchten. Ganz offen tritt seine Verachtung für Schwache und „Faule“ zutage, während ihm der Interviewer zugleich entlockt, wo diese herkommt. Nachdem Schumacher mit Blick nach Vietnam davon schwärmt, wie erstrebenswert es doch sei, wenn es kein System gäbe, auf das man sich verlassen könne — ein System, das harte Arbeit abverlangt und auch den Kindern entsprechend Druck auferlegt —, fragt Timm den Anarchokapitalisten nach seiner Kindheit:
„Es gab ziemlich viel Druck. Und einen harten Vater, der sehr streng war. Meine Verantwortung war es, einen guten Schulabschluss zu schaffen, die Studienwahl stand mir dann frei.“
Man muss nun wirklich kein Psychologe sein, um zu erkennen, dass Schumacher wohl das Kindheitstrauma seines strengen Elternhauses reinszeniert und — mehr noch — dieses der ganzen Welt überstülpen möchte. Alles soll von dieser Sphäre aus „Überwachen und Strafen“ (Foucault) einverleibt, alles in das kalte Raster von rein verstandesmäßiger Logik und kalter Rationalität eingewoben werden. Die Einwohner sollen sich stets der Leistung einfordernden Instanz ausgesetzt sehen, die in Schumachers Kindheit, der eigenen Aussage nach, der Vater gewesen ist. Das Bürgerrecht auf Schwäche gibt es nicht.
Wärme und Herzlichkeit sucht man in diesen Städten vergebens. Woher soll beides auch entspringen, wenn diese Orte von verletzten Kindern errichtet werden, die selbiges offenkundig nie erfahren haben?
Den Worten Schumachers ist zu entnehmen, was Roland Rottenfußer einmal vortrefflich über die Nekrophilie schrieb: die nackte Angst vor dem Lebendigen, dem Leben an sich. Das findet Ausdruck in der Abwertung des Häuschens mit Garten oder in dem Vorhaben, den Hyde Park zu 80 Prozent in Asphalt zu ersticken. Die Begründung spielt dabei eine entscheidende Rolle: Er, der Park, würde größtenteils nicht genutzt werden, er bezwecke damit nichts. Das Grün der Natur, ergo das Leben selbst, wird allein im Lichte der Zweckmäßigkeit betrachtet. Fehlt der Zweck, so entzieht Schumacher dem Grün seine Daseinsberechtigung. Die Bäume und Wiesen dürfen nicht um ihrer selbst willen dort stehen, dort sein, dort leben. Wer selbst nie um seiner selbst willen sein durfte, verweigert später auch allen anderen dieses Recht — ob Bäume oder Menschen, das spielt dann keine Rolle mehr.
Um dieses Bild abzurunden, werfen wir — wie bereits angekündigt — einen Blick auf das schon erwähnte Zaha Hadid Architects-Architekturbüro, das Schumann seit 2016 leitet. Eines der herausragendsten Projekte ist die Errichtung einer Stadt, die es nicht gibt. Nein, die Rede ist nicht von Bielefeld, sondern von Liberland. Das ist keine physisch existente, sondern eine rein virtuelle (!) Stadt, die einzig allein in Mark Zuckerbergs Metaverse, kurz Meta, existiert, ein Nicht-Ort aus Bits und Bytes, Nullen und Einsen, in dem sich Menschen mit aufgesetzten VR-Brillen in Form von Avataren „begegnen“ können.
Wir halten fest: Der Chefarchitekt der bekanntesten Privatstadt ist ein Mann, dessen Unternehmen eine virtuelle Stadt errichten lässt und der gleichzeitig am liebsten Quadratkilometerweise Grünflächen zubetonieren möchte.
Man kommt nicht umhin, festzustellen, dass dieses Konzept zu nichts führt, außer vom Regen in die Traufe oder auch in eine Heiß-Kalt-Dusche: Würfel-Wüsten in den Außenbezirken und einer kalten, futuristischen Architektur-Arktis im urbanen Kern. Bei den freien Privatstädten schließt sich der Kreis mit der Analyse aus Teil 1 und Teil 2.
Solcherlei Städte führen genau in Richtung der Smart-Cities, die im zweiten Teil skizziert wurden und verschärfen die in Teil eins genannten Ursachen: Ungleiche Besitzverhältnisse an Grund und Boden, schwindender Weltbezug der Menschen im digitalen Zeitalter bei gleichzeitiger Angleichung des Analogen hin zum Digitalen, versinnbildlicht durch die Glätte, die im Parametrismus genauso vorzufinden ist, wie in den Würfel-Wüsten. Der Fluchtpunkt in digitale Sphären wie der Meta-City Liberland setzt dem Ganzen das I-Tüpfelchen auf.
Ab dem vierten Teil und allen weiteren, die noch folgen werden, wenden wir uns realen Lösungen zu.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .
Quellen und Anmerkungen:
(1) Vergleiche Walsh, Jessica; Sagmeister, Stefan: „Beauty“, Mainz, 2018
(2) Vergleiche Ebenda, Seite 118 Fortfolgende
(3) Siehe Ebenda, im Kapitelverzeichnis auf der zweiten Seite.
(4) Vergleiche Ebenda, Seite 150 Fortfolgende
(5) Siehe Ebenda, Seite 176
(6) Vergleiche Kemper, Andreas: „Privatstädte: Labore für einen neuen Manchesterkapitalismus“, Münster, 2022